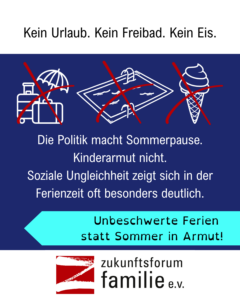AUS DEM ZFF
NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT
BMBFSFJ: Bundesfamilienministerium und Wall starten Kampagne für „Hilfen im Netz“
Lina Larissa Strahl unterstützt als Projektbotschafterin Kinder von psychisch und suchtkranken Eltern
Rund 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche sind in Deutschland im Verlauf eines Jahres mit einer psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung eines Elternteils konfrontiert. Das hat Folgen für die psychische Gesundheit und Bildung vieler der betroffenen Kinder, viele leiden sogar ihr Leben lang unter den Folgen. „Hilfen im Netz“ bietet kostenlose und anonyme Beratung und Unterstützung. Mit einer jetzt gestarteten bundesweiten Plakatkampagne werden Kinder und Jugendliche auf dieses Angebot aufmerksam gemacht.
Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Mareike Lotte Wulf, erklärt dazu: „Das Projekt ‚Hilfen im Netz‘ stellt durch seinen uneingeschränkten und niedrigschwelligen Zugang zum Hilfesystem eine wichtige Unterstützung für betroffene Kinder und Jugendliche bereit. Uns geht es darum, die mentale Gesundheit der jungen Menschen langfristig zu stärken. Damit Ratsuchende die passende Unterstützung erhalten und das Projekt wirksam werden kann, müssen aber zuallererst die Zugangswege bekannt sein. Die Kampagne trägt somit maßgeblich zur Aufklärung in der Gesellschaft bei.“
„Hilfen im Netz“ stellt eine kostenlose und anonyme Telefon- und Onlineberatung für Kinder und Jugendliche aus sucht- und psychisch belasteten Familien, ihre Angehörigen und Fachkräfte bereit, daneben gibt es auf der Website hilfenimnetz.de eine digitale Landkarte mit bundesweiten Hilfeangeboten. Über eine Postleitzahlsuche sind dort bundesweit analoge Hilfeangebote vor Ort zu finden. Durchgeführt wird das Projekt von NACOA Deutschland e.V. und KidKit (Drogenhilfe Köln). Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) fördert das gesamte Projekt wie auch die aktuelle Kampagne.Substanzielle Unterschiede zeigen sich beim Einkommen. Personen, die als armutsgefährdet gelten, fühlen sich einsamer als Personen mit mittleren und höheren Einkommen. Ebenso deutlich sind die Unterschiede beim Erwerbsstatus: Erwerbstätige fühlen sich weniger einsam als Nicht- Erwerbstätige, allerdings nur im Erwerbsalter (43 bis 65 Jahre). Ab 66 Jahren, also dem üblichen Ruhestandsalter, gibt es keine signifikanten Unterschiede im Einsamkeitsempfinden zwischen Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen und denen, die es nicht tun.
Der Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl liegt das Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Als Botschafterin von „Hilfen im Netz“ nutzt sie ihre Social-Media-Kanäle, um auf die Angebote des Projekts hinzuweisen. Auch die Plakat-Kampagne wird sie mitbewerben.
Lina Larissa Strahl: „Gerade junge Menschen brauchen Anlaufstellen, die leicht zugänglich und vertrauenswürdig sind, wenn sie sich in einer emotionalen und psychischen Notlage befinden – genau dafür steht “Hilfen im Netz”. Ich freue mich, dass ich Botschafterin dieser tollen Initiative bin. Mich dafür einsetzen zu können, dass Kinder und Jugendliche aus psychisch und suchtbelasteten Familien die Hilfe bekommen, die sie dringend benötigen, liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte stets dazu ermutigen, sich jemandem anzuvertrauen und nach Hilfe zu fragen, denn oft verspüren Betroffene eine große Erleichterung und fühlen sich weniger allein, sobald sie es geschafft haben, den ersten Schritt zu machen.“
Der Außenwerber Wall unterstützt das Projekt als Medienpartner bundesweit mit insgesamt 4.000 Flächen für City Light Poster, die kostenlos über einen Zeitraum von acht Wochen zur Verfügung gestellt werden.
Patrick Möller, Geschäftsführer von Wall: „Wir als Außenwerber freuen uns, die Plakatkampagne für die Online-Plattform hilfenimnetz.de mit unseren Werbeflächen unterstützen zu können. Betroffene und deren
Angehörige können so schnell und in großer Zahl erreicht werden. Sie haben den ersten Kontakt mit der Online-Plattform über die Plakate und wissen so, wo sie an zuverlässige Informationen kommen können. Wir hoffen auch, dass mehr Menschen dafür sensibilisiert werden, dass hilfenimnetz.de erste Anlaufstelle für echte Hilfe ist.“
Hintergrund
KidKit (Drogenhilfe Köln) ist ein seit dem Jahr 2003 bestehendes digitales Informations-, Beratungs- und Hilfeangebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 21 Jahren, die in Familien mit Suchterkrankungen, (sexualisierter) Gewalt und psychischen Erkrankungen aufwachsen.
NACOA Deutschland e.V. ist die 2004 gegründete deutsche Interessenvertretung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (ehemalige Kinder), die von der Alkohol- oder Drogenabhängigkeit oder auch durch nicht-stoffliche Süchte ihrer Eltern belastet sind.
Wall ist der Berliner Außenwerber und Stadtmöblierer mit analogen und digitalen Werbeflächen sowie Transportmedien in mehr als 20 deutschen Großstädten, darunter alle Millionenstädte (Berlin, Hamburg, München und Köln). Wall ist Teil JCDecaux-Gruppe, der Nummer 1 der Außenwerbung weltweit.
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 17.07.2025
BMBFSFJ: Alterssurvey zeigt: Menschen in der Lebensmitte stärker einsam als im Rentenalter
Ministerin Prien: „Psychisches Wohlbefinden besser durch soziale Begegnungen und dem Gefühl, gebraucht zu werden“
Wie einsam sich ein Mensch fühlt, steht in einem statistischen Zusammenhang mit seinem Alter, seinem Einkommen und der Frage, ob er oder sie einem Beruf nachgeht. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Deutschen Alterssurveys, die das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zum Thema Einsamkeit vorgenommen hat. Die Ergebnisse zeigen: Etwa jede elfte befragte Person ab 43 Jahren fühlte sich „sehr einsam“. Dabei fühlen sich die ab 76-Jährigen durchschnittlich weniger einsam als die Gruppe der 43- bis 55-Jährigen. Neben Alter und Geschlecht spielt der sozio-ökonomische Status – abgebildet über Einkommen und Erwerbsstatus – eine wichtige Rolle.
Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien: „Einsamkeit betrifft längst nicht nur ältere Menschen – auch in der Lebensmitte ist sie weit verbreitet, oft unsichtbar und unterschätzt. Studien zeigen sogar: Gerade in dieser Lebensphase ist das Gefühl zwar nicht für alle, aber doch für einige besonders ausgeprägt. Zwischen beruflichem Druck, familiären Verpflichtungen und gesellschaftlichen Erwartungen fehlt vielen das Erleben von echter Verbundenheit. Die Folgen sind gravierend – für die psychische Gesundheit, das soziale Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb setzen wir gezielt dort an, wo Menschen einander begegnen: im Arbeitsleben, im Ehrenamt, in Schulen, Vereinen und sozialen Einrichtungen. Mit der Allianz gegen Einsamkeit schaffen wir neue Partnerschaften und Impulse, um Menschen in der Mitte des Lebens wieder stärker in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.“
Wie einsam sich Menschen in der zweiten Lebenshälfte fühlen, lässt sich mit Daten des Deutschen Alterssurveys auf einer Skala von 1 bis 4 abbilden – von „gar nicht einsam“ bis „sehr einsam“. Der Mittelwert basiert auf Antworten zu sechs Fragen, die das Gefühl von sozialer Nähe und Isolation erfassen.
Substanzielle Unterschiede zeigen sich beim Einkommen. Personen, die als armutsgefährdet gelten, fühlen sich einsamer als Personen mit mittleren und höheren Einkommen. Ebenso deutlich sind die Unterschiede beim Erwerbsstatus: Erwerbstätige fühlen sich weniger einsam als Nicht-Erwerbstätige, allerdings nur im Erwerbsalter (43 bis 65 Jahre). Ab 66 Jahren, also dem üblichen Ruhestandsalter, gibt es keine signifikanten Unterschiede im Einsamkeitsempfinden zwischen Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen und denen, die es nicht tun.
Wer nicht erwerbstätig ist, verliert oft nicht nur Einkommen, sondern auch soziale Kontakte, Alltagsstruktur und das Gefühl, gebraucht zu werden. Hinzu kommt: Arbeitslosigkeit ist häufig stigmatisiert – das kann zu Rückzug, Schamgefühlen und in der Folge auch zu Einsamkeit führen. Bei Personen ab 66 Jahren besteht ein solches Stigma nicht mehr. Das persönliche Netzwerk, etwa aus gleichaltrigen Freundinnen und Freunden, kann den Wegfall des Kontakts zu Kollegen und Kolleginnen kompensieren.
Die detaillierten Ergebnisse sind nachzulesen in: Franz, M.-F., Stuth, S., & Huxhold, O. (2025). Einsamkeit in der zweiten Lebenshälfte – Vorkommen, Verteilung und die Rolle des Erwerbsstatus [DZA Aktuell 03/2025]. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. https://doi.org/10.60922/e2ef-ct55
Forschung am Deutschen Zentrum Altersforschung
Aktuell widmet sich das DZA dem Thema nicht nur im Deutschen Alterssurvey. So werden im „CoESI“-Projekt die langfristigen Folgen der Pandemie auf soziale Integration und Einsamkeit untersucht. Im „ReWiSil“ Projekt evaluiert das DZA die Silbernetz-Hotline gegen Isolation und Einsamkeit von Menschen über 60. Schließlich arbeitet das DZA im „Kompetenznetz Einsamkeit“ mit, das vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird.
Der Deutsche Alterssurvey
Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine repräsentative Quer- und Längsschnittbefragung von Personen in der zweiten Lebenshälfte ab 40 Jahren. Im Rahmen der Studie werden seit beinahe drei Jahrzehnten Menschen auf ihrem Weg ins höhere und hohe Alter regelmäßig befragt. Der Deutsche Alterssurvey wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Strategie gegen Einsamkeit im Koalitionsvertrag
Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung vereinbart, die Strategie gegen Einsamkeit fortzuschreiben und die Arbeit bestehender Netzwerke zu unterstützen. Im Bereich der Prävention soll das Thema Einsamkeit, ihre Auswirkung und der Umgang damit in den Fokus gerückt werden. Insbesondere die Forschung zum Thema Einsamkeit im Bereich der Kinder und Jugendlichen soll gestärkt werden, um zielgenaue Maßnahmen zur Bekämpfung der zunehmenden Einsamkeit vom Kindesalter bis zu den älteren Menschen zu entwickeln.
Weitere Informationen: www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/strategie-gegen-einsamkeit
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 10.07.2025
Deutscher Bundestag: Kinderkommission des Bundestages nimmt ihre Arbeit auf
Mit der Konstituierung am 10. Juli 2025 als Unterausschuss des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend nimmt die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission) ihre Arbeit auf, um damit auch in der 21. Wahlperiode die Bedeutung einer fraktionsübergreifenden Kinder- und Jugendpolitik des Parlaments zum Ausdruck zu bringen. Kinder und Jugendliche seien ein wichtiger Teil der Gesellschaft und bedürften des besonderen Schutzes und der Unterstützung. Es sei daher Aufgabe der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, dafür zu sorgen, dass deren Interessen und Anliegen in der parlamentarischen Arbeit ausreichend berücksichtigt würden. Als deren „Anwalt“ sei die Kinderkommission auch Ansprechpartner für Verbände und andere Organisationen, für Eltern und Kinder.
Die Mitglieder der neuen Kinderkommission sind die Abgeordneten
Michael Hose (CDU/CSU, entsprechend der Fraktionsstärke im Vorsitzturnus als erster Vorsitzender), Angela Rudzka (AfD), Truels Reichardt (SPD), Nyke Slawik (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Mareike Hermeier (DIE LINKE.).
Für die Kinderkommission erklärt der Vorsitzende Michael Hose zur Konstituierung:
„Ich freue mich, dass heute die Kinderkommission ihre Arbeit aufnehmen kann. Die Kinderkommission ist seit 1988 Ausdruck der besonderen Verantwortung, die der Bundestag für Kinder und Jugendliche hat. Als Vater und ehemaliger Schulleiter ist die Leitung der Kinderkommission eine Herzensangelegenheit für mich. Meine Schwerpunkte der Arbeit sind unter anderem die Stärkung der Medienkompetenz der Kinder und deren Schutz in den Sozialen Netzwerken. Wir werden fraktionsübergreifend auch weiterhin die Rechte, Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ins Zentrum unserer Arbeit stellen.“
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 10.07.2025
Bundesrat billigt Verlängerung der Mietpreisbremse
Die Mietpreisbremse läuft weiter bis zum 31. Dezember 2029. Der Bundesrat hat ein Gesetz des Bundestages mit der verlängerten Frist am 11. Juli 2025 gebilligt.
Instrument für angespannte Wohnungsmärkte
Im Kern regelt die Mietpreisbremse, dass die Miete bei der Neu- und Wiedervermietung die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens zehn Prozent übersteigen darf. Dies gilt nur für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten. Dazu zählen Regionen, in denen die Mieten deutlich stärker steigen als im Bundesdurchschnitt oder in denen die Bevölkerung besonders stark wächst, ohne dass der Wohnungsneubau damit Schritt hält. Welche Gebiete dazu gehören, legen die jeweiligen Landesregierungen fest.
Bisherige Regelung vor dem Auslaufen
Die Mietpreisbremse existiert seit 2015. Ohne die Verlängerung würde sie zum 31. Dezember 2025 auslaufen. Zudem konnte bisher ein Gebiet nur für die Dauer von fünf Jahren zum angespannten Wohnungsmarkt erklärt werden – diese zeitliche Einschränkung entfällt nun.
Weiterhin angespannter Wohnungsmarkt
Die Verlängerung der Mietpreisbremse begründet der Bundestag mit dem weiter angespannten Mietwohnungsmarkt in Ballungszentren. Liefe die Mietpreisbremse zum Ende des Jahres aus, könnte dies zusammen mit den steigenden Energiekosten und den anderweitig hohen Preisen dazu führen, dass Menschen mit niedrigem, aber auch durchschnittlichem Einkommen – insbesondere Familien mit Kindern – aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden.
Inkrafttreten
Da der Vermittlungsausschuss nicht angerufen wurde, kann das Gesetz nun ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates am 11.07.2025
Bundesrat billigt Aussetzung des Familiennachzugs
Der Bundesrat hat am 11. Juli 2025 das vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten gebilligt. Ein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses fand keine Mehrheit.
Begrenzung der Migration
Das Gesetz ändert zunächst die Ziele des Aufenthaltsgesetzes. Künftig soll der Zuzug von Ausländern durch das Gesetz nicht nur gesteuert, sondern auch begrenzt werden. Damit werde auch ein deutliches Signal ins In- und Ausland gesetzt, dass unerlaubte Einreisen und Aufenthalte in Deutschland nicht hingenommen würden, so die Gesetzesbegründung.
Aussetzung des Familiennachzugs
Das Gesetz sieht unter anderem vor, den Familiennachzug zu subsidiär Schutzbedürftigen für zwei Jahre auszusetzen. Dies betrifft Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, die zwar nicht wie Asylberechtigte oder Flüchtlinge aus bestimmten Gründen verfolgt werden, denen aber dennoch in ihrer Heimat schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Engste Familienangehörige – also Ehegatten, minderjährige Kinder und Eltern – konnten bisher aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Bundesweit durften zuletzt monatlich 1.000 entsprechende Visa erteilt werden.
Hohe Belastung der Kommunen
Das Ausschöpfen dieses Kontingents beim Familienzuzug hätte die Kommunen in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlich zu der hohen Zahl an weiteren Schutzsuchenden und Familiennachzugsfällen vor große Herausforderungen gestellt, heißt es in der Gesetzesbegründung. Häufig reisten Schutzsuchende allein ein, und die Familienangehörigen stellten später den Antrag auf Familienzusammenführung. Die Kommunen müssten dann Wohnraum für größere Familien organisieren. Länder und Kommunen hätten vor diesem Hintergrund verstärkt vor drohender Obdachlosigkeit von Schutzsuchenden gewarnt.
Inkrafttreten
Das Gesetz kann nun ausgefertigt und verkündet werden und tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates am 11.07.2025
Bundestag: Bundesregierung: Keine Wehrpflicht für Frauen
Die Bundesregierung hat aktuell keine Pläne für die Einführung der Wehrpflicht für Frauen. Dies stellt sie in ihrer Antwort (21/906) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (21/720) zur konkreten Ausgestaltung des von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angekündigten neuen Wehrdienstgesetzes klar. Die notwendige Änderung von Artikel 12a, der eine Verpflichtung von Frauen „zum Dienst mit der Waffe“ ausdrücklich untersagt, sei „derzeit nicht geplant“. Die Bundesregierung verweist in ihrer Antwort darauf, dass sich die weit überwiegende Anzahl der Fragen der Linksfraktion auf Beratungen über einen Gesetzentwurf innerhalb der Bundesregierung beziehe, der noch nicht abgeschlossen sei. Die Kontrollkompetenz des Parlaments erstrecke sich aber „grundsätzlich nur auf bereits abgeschlossene Vorgänge“ und umfasse „nicht die Befugnis, in laufende Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen einzugreifen“.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 315 vom 22.07.2025
DIW: „Boomer-Soli“ kann deutsches Rentensystem stabilisieren
Ohne direkte Mehrbelastung jüngerer Generationen: Sonderabgabe auf alle Alterseinkünfte würde einkommensschwache Rentner*innenhaushalte entlasten und Altersarmut reduzieren – Umverteilung nur in der gesetzlichen Rentenversicherung wäre hingegen wenig zielgenau
Ein „Boomer-Soli“ – eine Solidaritäts-Sonderabgabe auf sämtliche Alterseinkünfte – kann ein wichtiger Baustein zur Stabilisierung des Rentensystems in Deutschland sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Die Abgabe würde gezielt Personen mit hohen Alterseinkünften moderat zur Kasse bitten, um einkommensschwache Rentner*innen zu unterstützen und damit das Risiko für Altersarmut zu reduzieren. Das Besondere an dem Konzept: Umverteilt würde ausschließlich innerhalb der älteren Generation, Jüngere blieben also weitgehend verschont – im Gegensatz zu steigenden Rentenbeiträgen und Steuerzuschüssen, die nach den Plänen der neuen Koalition künftig die zunehmend klammen Kassen der gesetzlichen Rente stabilisieren sollen.
„Die Rentenpolitik hat es in den vergangenen Jahren versäumt, ausreichend finanzielle Rücklagen aufzubauen. Wenn alle Babyboomer im Ruhestand sind, wird das Rentensystem noch deutlich stärker unter Druck kommen als bisher“, sagt Peter Haan, Leiter der Abteilung Staat im DIW Berlin. DIW-Steuerexperte Stefan Bach ergänzt: „Es wäre nicht fair, die anstehenden Lasten des demografischen Wandels vor allem den jüngeren Generationen aufzubürden. Ein Boomer-Soli kann helfen, für Ausgleich zu sorgen. Er träfe in erster Linie gut versorgte Ruheständler, denen es nicht allzu weh tut, einen zusätzlichen Beitrag zu leisten.“
Armutsrisikoquote im Alter würde von gut 18 auf knapp 14 Prozent sinken
Eine Sonderabgabe von zehn Prozent (nach Abzug eines Freibetrags von monatlich rund 1.000 Euro) auf alle Alterseinkünfte würde die 20 Prozent der Rentner*innenhaushalte mit den höchsten Einkommen moderat belasten. Abhängig davon, ob auch Kapitaleinkünfte für den Boomer-Soli herangezogen werden oder nicht, hätten Personen in diesen Haushalten ein um drei bis vier Prozent geringeres Nettoäquivalenzeinkommen. Das unterste Fünftel der Einkommensverteilung würde über höhere gesetzliche Renten deutlich profitieren. Die Einkommen stiegen dort um zehn bis elf Prozent. Das würde sich auch in der Armutsrisikoquote niederschlagen, die von gut 18 auf knapp 14 Prozent sänke.
Ein Vorteil des Boomer-Solis liegt in seiner breiten Bemessungsgrundlage: Herangezogen würden nicht nur gesetzliche Renten, sondern auch private und betriebliche Renten sowie sonstige Versorgungsbezüge, außerdem Pensionen von Beamt*innen und gegebenenfalls Vermögenseinkommen. Der Boomer-Soli würde also auch der Tatsache Rechnung tragen, dass die gesetzliche Rente für viele wohlhabende Haushalte oft nur eine geringere Rolle spielt und sonstige Alterseinkünfte wie Betriebsrenten oder auch Vermögenseinkommen einen deutlich größeren Anteil am Einkommen haben.
Das erklärt auch, weshalb eine reine Umverteilung von Anwartschaften innerhalb der gesetzlichen Rente, wie sie etwa der Sachverständigenrat für Wirtschaft angeregt hat, einkommensstärkere Rentner*innenhaushalte deutlich weniger belasten würde. „Die Rentenpunkte in der gesetzlichen Rente sind kein guter Indikator für ein hohes oder niedriges Haushaltseinkommen – von daher wäre es wenig zielgenau, nur innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung umzuverteilen“, erklärt DIW-Rentenexperte Maximilian Blesch.
Boomer-Soli möglicherweise mit Nebenwirkungen
Die Studienautor*innen betonen aber, dass es letztlich von der politischen Zielsetzung abhänge, wie die Lasten zwischen älteren und jüngeren Generationen verteilt werden sollen. In allen Varianten sei die Sonderabgabe auf sämtliche Alterseinkünfte aber einer Umverteilung nur in der gesetzlichen Rente vorzuziehen. Nebenwirkungen gäbe es dennoch: Auch wenn Erwerbseinkommen durch die Abgabe nicht direkt belastet werden, könnten langfristig sogenannte intertemporale Effekte entstehen: Wer heute arbeitet und vorsorgt, muss damit rechnen, im Alter zusätzliche belastet zu werden – das könnte die Motivation zur Erwerbsarbeit oder zum Sparen für das Alter verringern.
LINKs
- Studie im DIW Wochenbericht 29/2025
- Infografik in hoher Auflösung (JPG, 0.87 MB)
- Video: „Nachgeforscht“ bei Maximilian Blesch und Stefan Bach
- Interview mit Maximilian Blesch
- Audio-Interview mit Maximilien Blesch (MP3, 10.82 MB)
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) vom 16.07.2025
Statistisches Bundesamt: Der Durchschnittsmensch in Deutschland: Wie er lebt, wohnt und arbeitet
- Ende 2024 war der Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt, die Durchschnittsfrau war gut zweieinhalb Jahre älter als der Durchschnittsmann
- Der Durchschnittsmensch lebt mit einer weiteren Person zusammen in einem Haushalt, die Durchschnittswohnung hat 94,4 Quadratmeter
- Statistisches Bundesamt veröffentlicht neue Sonderseite zum Durchschnittsmenschen in Deutschland
Ob von jung bis alt, von klein bis groß oder von arm bis reich: Mal angenommen, ein Mensch in Deutschland stünde für alle 83,6 Millionen, die hier leben. Dann wäre dieser Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt zum Jahresende 2024. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Start einer Sonderseite mit, die den Durchschnittsmenschen in Deutschland in vielen verschiedenen Lebensbereichen beschreibt. Die Durchschnittsfrau war mit 46,2 Jahren gut zweieinhalb Jahre älter als der Durchschnittsmann (43,5 Jahren).
Das höhere Durchschnittsalter von Frauen hängt mit ihrer höheren Lebenserwartung zusammen. Bei Geburt im Jahr 2024 betrug die Lebenserwartung der Durchschnittsfrau 83,5 Jahre. Mit 78,9 Jahren hatte der Durchschnittsmann eine um etwa viereinhalb Jahre geringere Lebenserwartung.
Lebt der Durchschnittsmensch in einer Familie, dann hat diese 3,4 Mitglieder im Haushalt
Laut Mikrozensus 2024 hat die Familie des Durchschnittsmenschen 3,4 Mitglieder. Familien sind hier im engeren Sinne definiert als alle Eltern-Kind-Konstellationen, die zusammen in einem Haushalt leben. Betrachtet man sämtliche Haushaltsformen vom Einpersonenhaushalt bis zur Großfamilie, dann lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren Person zusammen in einem Haushalt (2,0 Mitglieder je Haushalt).
Wie der Durchschnittsmensch wohnt, zeigen die Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022. Die Durchschnittswohnung hat demnach eine Wohnfläche von 94,4 Quadratmetern und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter.
Vollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt 4 634 Euro brutto im April 2024 – Medianverdienst bei 3 978 Euro
Betrachtet man alle abhängig Beschäftigten in Vollzeit, dann verdiente der vollzeitbeschäftigte Durchschnittsmensch im April 2024 ohne Sonderzahlungen 4 634 Euro brutto. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten im Schnitt 4 214 Euro brutto im Monat und damit deutlich weniger als vollzeitbeschäftigte Männer mit 4 830 Euro.
Insbesondere bei Verdienstdaten wird deutlich, dass Durchschnittswerte mit Blick auf Aussagekraft und Interpretation limitiert sein können. Der Durchschnittswert, auch arithmetisches Mittel genannt, ist anfällig für extreme Werte und kann ein verzerrtes Bild liefern. Da wenige Personen mit sehr hohen Verdiensten den Durchschnitt stark beeinflussen können, wird hier häufig auch der Median als aussagekräftiger Mittelwert herangezogen. Er teilt eine Verteilung in zwei gleich große Hälften: 50 % der Werte liegen unterhalb des Medians und 50 % liegen darüber.
Betrachtet man die Medianverdienste, verdiente ein Vollzeitbeschäftigter im Mittel 3 978 Euro brutto im April 2024 (ohne Sonderzahlungen). Mit einem mittleren Bruttomonatsverdienst von 3 777 Euro brutto verdiente die vollzeitbeschäftigte Frau exakt 300 Euro weniger als der vollzeitbeschäftigte Mann mit 4 077 Euro.
Statistisches Bundesamt mit neuer Sonderseite zum Durchschnittsmenschen
Diese und weitere Daten rund um den Durchschnittsmenschen in Deutschland bündelt das Statistische Bundesamt auf einer neuen Sonderseite unter www.destatis.de/durchschnittsmensch. Das Datenangebot umfasst viele verschiedene Lebensbereiche und zeigt auch geschlechterspezifische Unterschiede zwischen der Durchschnittsfrau und dem Durchschnittsmann. Neben Aspekten des Zusammenlebens und Arbeitslebens wirft die Sonderseite auch einen Blick auf prägende Lebensphasen des Durchschnittsmenschen – wie die Studienzeit, den Auszug aus dem Elternhaus, die Familiengründung oder den Renteneintritt.
Methodische Hinweise:
Die Angaben zur Bevölkerungszahl und zum Durchschnittsalter basieren auf den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung zum Stichtag 31.12.2024.
Bei den hier angegebenen Ergebnissen für 2024 aus dem Mikrozensus handelt es sich um Erstergebnisse. Diese basieren auf dem Hochrechnungsrahmen aus dem Zensus 2022. Informationen zu Erst- und Endergebnissen sowie zur Anpassung an den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite.
Weitere Informationen:
Detaillierte Informationen zum Thema Lebenserwartung finden Sie in der dazugehörigen Pressemitteilung.
Daten zur Fortschreibung des Bevölkerungsstandes finden Sie in unserer Datenbank GENESIS-Online in der Tabelle 12411-0005.
Weitere Ergebnisse zur Situation von Familien und zu Lebensformen in Deutschland auf Basis des Mikrozensus bietet der Statistische Bericht Haushalte und Familien.
Die Daten zu den durchschnittlichen und mittleren Bruttomonatsverdiensten von Vollzeitbeschäftigten stammen aus der Verdiensterhebung für den Stichmonat April 2024 und sind in GENESIS-Online in der Tabelle 62361-0031 verfügbar.
Wichtiger technischer Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:
Seit dem 15. Juli 2025 gibt es Neuerungen bei der Webservice-Schnittstelle unserer Datenbank GENESIS-Online. Anstelle der GET-Methoden sowie der SOAP/XML-Schnittstelle sind die POST-Methoden der RESTful/JSON-Schnittstelle nutzbar. Um POST-Anfragen zu verwenden und die RESTful/JSON-Schnittstelle anzusprechen, überprüfen Sie bitte Ihre Prozesse. Detaillierte sprachliche und technische Dokumentationen sowie weitere Hinweise zur Umstellung bietet die Infoseite zur Webservice-Schnittstelle.
Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 22.07.2025
Statistisches Bundesamt: Schulanfang: Schul- oder Lehrbücher im Juni 2025 um 3,8 % teurer als im Vorjahresmonat
Ob Stifte, Hefte oder Bücher – der Schulanfang nach den Sommerferien ist in der Regel mit einigen Anschaffungen verbunden. Für den Kauf von unterschiedlichen Schulmaterialien mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im Juni 2025 mehr ausgeben als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich etwa die Preise für Schul- oder Lehrbücher im Juni 2025 um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt. Diese stiegen im selben Zeitraum um 2,0 %.
Andere Schulmaterialien mit unterdurchschnittlichen Preissteigerungen
Bei anderen Schulmaterialien fiel die Preissteigerung geringer aus. So sind die Preise für Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke unterdurchschnittlich gestiegen: Sie lagen mit +0,3 % nur geringfügig über dem Niveau des Vorjahresmonats. Für anderes Schreib- und Zeichenmaterial mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im Juni 2025 für 1,7 % mehr zahlen als im Juni 2024. Darunter fallen beispielsweise Füller, Stifte oder Farbkästen.
Methodische Hinweise:
Die genannten Produkte sind im Verbraucherpreisindex für Deutschland enthalten. Die Preisentwicklungen für die Positionen „Schulbuch oder Lehrbuch“ (0,38 Promille), „Papierprodukte“ (0,53 Promille) sowie „Anderes Schreib- und Zeichenmaterial“ (1,87 Promille) fließen mit den in Klammern genannten Gewichten in die Berechnung des Gesamtindex (1000 Promille) ein.
Weitere Informationen:
Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0004 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die folgenden Positionen:
CC13-09512 Schulbuch oder Lehrbuch
CC13-09541 Papierprodukte
CC13-09549 Anderes Schreib- und Zeichenmaterial
Wichtiger technischer Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:
Seit dem 15. Juli 2025 gibt es Neuerungen bei der Webservice-Schnittstelle unserer Datenbank GENESIS-Online. Anstelle der GET-Methoden sowie der SOAP/XML-Schnittstelle sind die POST-Methoden der RESTful/JSON-Schnittstelle nutzbar. Um POST-Anfragen zu verwenden und die RESTful/JSON-Schnittstelle anzusprechen, überprüfen Sie bitte Ihre Prozesse. Detaillierte sprachliche und technische Dokumentation sowie weitere Hinweise zur Umstellung bietet die Infoseite zur Webservice-Schnittstelle.
Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 22.07.2025
Statistisches Bundesamt: Rückgang der Geburtenziffer schwächte sich 2024 deutlich ab
- Geburtenziffer 2024 mit 1,35 Kindern je Frau um 2 % niedriger als im Vorjahr
- Höchste Geburtenziffer 2024 in Niedersachsen mit 1,42 Kindern je Frau, niedrigste in Berlin mit 1,21 Kindern je Frau
- Geburtenziffer der Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit so niedrig wie zuletzt vor 30 Jahren
Die zusammengefasste Geburtenziffer, oft als Geburtenrate bezeichnet, ist 2024 auf 1,35 Kinder je Frau gesunken. Sie war damit um 2 % niedriger als im Jahr 2023, in dem die Geburtenziffer unter Berücksichtigung der korrigierten Bevölkerungszahl des Zensus 2022 1,38 Kinder je Frau betrug. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, verlangsamte sich damit der Rückgang im Jahr 2024 deutlich. In den Jahren 2022 und 2023 war die Geburtenziffer gegenüber dem Vorjahr um 8 % beziehungsweise um 7 % gesunken.
Im Jahr 2024 kamen in Deutschland 677 117 Kinder zur Welt. Damit nahm die Zahl der Geburten um 15 872 oder ebenfalls 2 % im Vergleich zum Vorjahr ab (2023: 692 989 Neugeborene).
Höchste Geburtenziffer in Niedersachsen mit 1,42 Kindern je Frau
In den Bundesländern lag die zusammengefasste Geburtenziffer 2024 zwischen 1,21 in Berlin und 1,42 in Niedersachsen. Die Geburtenhäufigkeit in den östlichen Flächenländern war mit 1,27 Kindern je Frau deutlich geringer als in den westlichen Bundesländern mit 1,38 Kindern je Frau. Am höchsten in den östlichen Bundesländern war die Geburtenziffer in Brandenburg mit 1,34 Kindern je Frau.
Im Vergleich zum Vorjahr sank die Geburtenziffer im Jahr 2024 in allen Bundesländern. Den stärksten Rückgang verzeichnete Thüringen. Hier ging die Geburtenziffer um 7 % von 1,33 Kindern je Frau im Jahr 2023 auf 1,24 im Jahr 2024 zurück. Am geringsten sank sie in Baden-Württemberg: um 1 % von 1,41 Kindern je Frau im Jahr 2023 auf 1,39 im Jahr 2024.
Geburtenziffer der deutschen Frauen sank auf das Niveau des Jahres 1996
Die zusammengefasste Geburtenziffer der Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit sank 2024 auf 1,23 Kinder je Frau. Eine ähnlich niedrige Geburtenhäufigkeit wurde bei den deutschen Frauen zuletzt vor knapp 30 Jahren im Jahr 1996 gemessen (1,22 Kinder je Frau). Besonders spürbar war der Rückgang der Geburtenziffer gegenüber dem Vorjahr mit -8 % im Jahr 2022 und mit -7 % im Jahr 2023. Im Jahr 2024 sank sie dagegen nur noch um 3 %.
Die zusammengefasste Geburtenziffer der Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit betrug 1,84 Kinder je Frau im Jahr 2024 und war damit 2 % niedriger als im Vorjahr. Die Geburtenhäufigkeit der ausländischen Frauen geht seit 2017 fast kontinuierlich zurück.
Frauenjahrgang 1975 brachte durchschnittlich 1,58 Kinder zur Welt
Die sogenannte endgültige Kinderzahl lässt sich aktuell für Frauen bis zum Geburtsjahrgang 1975 ermitteln. So brachten die im Jahr 1975 geborenen Frauen, die 2024 mit 49 Jahren das Ende des gebärfähigen Alters nach statistischer Definition erreicht haben, durchschnittlich 1,58 Kinder zur Welt. Die endgültige Kinderzahl war zuvor bei den Frauen der 1960er Jahrgänge kontinuierlich gesunken und hatte beim Jahrgang 1968 mit 1,49 Kindern je Frau ihr historisches Minimum erreicht. Die in den 1970er Jahren geborenen Frauen bringen durchschnittlich mehr Kinder zur Welt. Vor allem im Alter über 30 Jahren bekamen beziehungsweise bekommen die zwischen 1970 und 1980 geborenen Frauen deutlich häufiger Kinder als die Frauen älterer Jahrgänge.
Durchschnittsalter der Eltern bei Geburt stagniert seit 2021
Mütter waren im Jahr 2024 bei einer Geburt – unabhängig davon, ob es die Geburt des ersten Kindes oder eines weiteren Kindes war – im Durchschnitt 31,8 Jahre und Väter 34,7 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Mütter schwankt seit 2021 leicht um diesen Wert, das Alter der Väter blieb konstant. Zuvor war das Durchschnittsalter bei Geburt mit Ausnahme einer Stagnation in den Jahren von 2014 bis 2016 kontinuierlich gestiegen. Zwischen 1991 und 2024 nahm es bei Müttern um 3,9 Jahre (1991: 27,9 Jahre) und bei Vätern um 3,8 Jahre zu (1991: 31,0 Jahre).
Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes betrug 2024 30,4 Jahre. Die Väter waren beim ersten Kind der Mutter im Schnitt 33,3 Jahre alt. Damit waren Väter beim ersten Kind durchschnittlich 2,9 Jahre älter als Mütter. In den vergangenen zehn Jahren sind Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes tendenziell älter geworden. Im Jahr 2015 waren Mütter im Durchschnitt erst 29,7 Jahre und Väter 32,8 Jahre alt.
In vielen anderen europäischen Staaten sinken die Geburtenziffern ebenfalls weiter
Vergleichbare internationale Angaben zur Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer im Jahr 2024 liegen derzeit noch nicht vor. Die Angaben der Europäischen Statistikbehörde Eurostat bis zum Jahr 2023 zeigen jedoch, dass die Geburtenziffern in den meisten Staaten der Europäischen Union (EU) im Vergleich zum Jahr 2022 weiter gesunken sind. Dadurch ergibt sich 2023 für alle 27 EU-Staaten mit durchschnittlich 1,38 Kindern je Frau ein deutlich niedrigerer Wert als zehn Jahre zuvor mit 1,51 Kindern je Frau im Jahr 2013. Deutschland lag 2023 im Europäischen Durchschnitt. Am höchsten war die Geburtenziffer in Bulgarien mit 1,81 Kindern je Frau. Die niedrigsten Geburtenziffern wurden für Malta mit 1,06 und für Spanien mit 1,12 Kindern je Frau nachgewiesen.
Methodische Hinweise:
Alle Angaben beziehen sich auf den Bevölkerungsstand ausgehend vom Zensus 2022. Weitere Informationen zur neuen Bevölkerungsbasis finden sich im Beitrag „Umstellung der Bevölkerungszahlen auf die Ergebnisse des Zensus 2022„. Die zusammengefasste Geburtenziffer 2023 wurde unter Berücksichtigung dieses neuen Bevölkerungsstands von ursprünglich 1,35 auf 1,38 Kinder je Frau korrigiert. Weitere Ergebnisse der zusammengefassten Geburtenziffer auf Basis der neuen Bevölkerungszahl bietet der Beitrag „Umstellung auf Zensus 2022 führt zu einer höheren Geburtenrate, ergibt jedoch kein völlig neues Bild der Fertilität„.
Die zusammengefasste Geburtenziffer wird zur Beschreibung des aktuellen Geburtenverhaltens herangezogen. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekäme, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im betrachteten Jahr. Die zusammengefasste Geburtenziffer ist die Summe (und damit Zusammenfassung) der für jedes Alter von 15 bis 49 Jahren berechneten altersspezifischen Geburtenziffern eines Jahres. Dabei stellt eine altersspezifische Geburtenziffer die Relation zwischen den Lebendgeborenen der Mütter eines bestimmten Alters und der Zahl der Frauen in diesem Alter dar. Angaben zur endgültigen Kinderzahl der Frauen eines Jahrgangs (Kohorte) liegen ab dem Jahrgang 1930 vor. Diese kohortenbezogene Geburtenziffer wird als Summe der altersspezifischen Geburtenziffern berechnet, die in den Jahren nachgewiesen wurden, in denen der entsprechende Jahrgang seine fertile Phase von 15 bis 49 Jahren durchlief.
Weitere Informationen:
Ausführliche Ergebnisse zur Geburtenentwicklung stehen in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12612) sowie auf der Themenseite „Geburten“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zur Verfügung. Die Rubrik „Aktuell“ bietet unter anderem Informationen zum aktuellen Geburtenrückgang und zu monatlichen Geburtenzahlen.
Wichtiger technischer Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:
Seit dem 15. Juli 2025 gibt es Neuerungen bei der Webservice-Schnittstelle unserer Datenbank GENESIS-Online. Anstelle der GET-Methoden sowie der SOAP/XML-Schnittstelle sind die POST-Methoden der RESTful/JSON-Schnittstelle nutzbar. Um POST-Anfragen zu verwenden und die RESTful/JSON-Schnittstelle anzusprechen, überprüfen Sie bitte Ihre Prozesse. Detaillierte sprachliche und technische Dokumentationen sowie weitere Hinweise zur Umstellung bietet die Infoseite zur Webservice-Schnittstelle.
Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 17.07.2025
Statistisches Bundesamt: 17 Millionen Menschen in Deutschland leben allein
- Zahl in den letzten 20 Jahren um 21,8 % gestiegen
- Armutsgefährdungsquote von Alleinlebenden nahezu doppelt so hoch wie in der Bevölkerung insgesamt
- Anteil Alleinlebender hierzulande mit 20,6 % deutlich über EU-Schnitt von 16,2 %
Gut 17,0 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. Das ist gut jede fünfte Person (20,6 %), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 mitteilt. Die Zahl der Alleinlebenden ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen – gegenüber 2004 um 21,8 %. Damals lebten noch 14,0 Millionen Menschen hierzulande allein. Ihr Anteil an der Bevölkerung betrug 17,1 %.
Ältere Menschen leben besonders häufig allein: In der Altersgruppe 65plus wohnte gut jede dritte Person allein (34,0 %), bei den mindestens 85-Jährigen war es mehr als jede zweite (56,0 %). Aber auch unter den jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren war der Anteil mit 28,0 % überdurchschnittlich hoch. Insgesamt leben Frauen etwas häufiger allein (21,2 %) als Männer (20,0 %).
Alleinlebende sind überdurchschnittlich häufig von Armut bedroht
Alleinlebende sind besonders häufig von Armut bedroht. Nach den Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen 2024 waren 29,0 % der Alleinlebenden armutsgefährdet. Die Armutsgefährdungsquote von Alleinlebenden war damit fast doppelt so hoch wie die der Gesamtbevölkerung (15,5 %). Ähnlich wie letztere ist auch die Armutsgefährdungsquote von Alleinlebenden gestiegen: 2023 hatte sie bei 26,4 % gelegen (Bevölkerung insgesamt: 14,4 %). Eine Person gilt als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 % des mittleren Äquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2024 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland netto (nach Steuern und Sozialabgaben) bei 1 381 Euro im Monat.
Armut ist vielschichtig und geht über die reine Armutsgefährdung hinaus. Gut ein Drittel (35,1 %) aller Alleinlebenden war im letzten Jahr von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das Risiko für Armut oder soziale Ausgrenzung ist bei einer Person gemäß Definition dann gegeben, wenn mindestens eine der folgenden drei Bedingungen zutrifft: Ihr Nettoäquivalenzeinkommen liegt unter der Armutsgefährdungsgrenze, sie ist von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen oder sie lebt in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung.
Alleinlebende sind überdurchschnittlich häufig einsam
Gut jede vierte alleinlebende Person (25,8 %) fühlt sich oft einsam. Im Durchschnitt der Bevölkerung ab 10 Jahren waren es 16,3 %, wie aus Ergebnissen der Zeitverwendungserhebung 2022 hervorgeht. Ganz besonders oft waren jüngere Alleinlebende unter 30 Jahren von Einsamkeit betroffen (35,9 %). Im Gegensatz dazu fühlten sich mit 17,6 % die Alleinlebenden ab 65 Jahren am seltensten einsam.
Anteil Alleinlebender nur in fünf EU-Staaten höher als in Deutschland
In Deutschland leben anteilig deutlich mehr Menschen allein als in den meisten anderen Staaten der Europäischen Union (EU). Im Jahr 2024 betrug der Anteil Alleinlebender an der EU-Bevölkerung 16,2 %. Laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat lebten nur in den fünf nord- beziehungsweise nordosteuropäischen Staaten Litauen (27,0 %), Finnland (25,8 %), Dänemark (24,1 %) sowie Estland (22,3 %) und Schweden (22,2 %) im EU-Vergleich anteilig noch mehr Menschen allein als in Deutschland. In der Slowakei (3,5 %), Irland (8,1 %) und Polen (8,8 %) war der Anteil am niedrigsten.
Gut zwei Fünftel aller Haushalte hierzulande sind Einpersonenhaushalte
Zwar machen Alleinlebende lediglich gut ein Fünftel der Bevölkerung hierzulande aus, Einpersonenhaushalte sind jedoch mit einem Anteil von gut zwei Fünfteln (41,6 %) der häufigste Haushaltstyp in Deutschland. Der Anteil der Einpersonenhaushalte ist in den vergangenen 20 Jahren gestiegen: 2004 hatte er noch bei 36,5 % gelegen. In Zukunft werden Einpersonenhaushalte noch häufiger vertreten sein: Der Vorausberechnung der Privathaushalte zufolge wird ihr Anteil im Jahr 2040 bereits über 45 % betragen.
Methodische Hinweise:
Alleinlebende sind Personen, die in einem Einpersonenhaushalt leben. Unbedeutsam ist hierbei der Familienstand der alleinlebenden Person.
Im Mikrozensus sowie in der Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen (MZ-SILC) werden Menschen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten berücksichtigt. Menschen in Gemeinschaftsunterkünften oder in Einrichtungen wie beispielsweise Alten- oder Pflegeheimen sind nicht erfasst. Bei den hier angegebenen Ergebnissen für 2024 aus dem Mikrozensus handelt es sich um Erstergebnisse. Diese basieren auf dem Hochrechnungsrahmen aus dem Zensus 2022. Bei den Ergebnissen aus der Mikrozensus-Unterstichprobe MZ-SILC handelt es sich um Endergebnisse. Diese basieren auf dem Mikrozensus-Hochrechnungsrahmen aus dem Zensus 2011. Informationen zu Erst- und Endergebnissen sowie zur Anpassung an den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite.
In der Erhebung MZ-SILC ist die Grundlage für die Einkommensmessung in einem Erhebungsjahr das gesamte verfügbare Haushaltseinkommen (Einkommen nach Steuern und Sozialabgaben) des Vorjahres. Die Fragen zum Einkommen beziehen sich also auf das Vorjahr der Erhebung.
Die Ergebnisse der Zeitverwendungserhebung 2022 wurden am 6. Juni 2025 in revidierter Form auf der Themenseite Zeitverwendung im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht.
Die Vorausberechnung der Privathaushalte beruht auf den Ergebnissen der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Variante 2) und des Mikrozensus.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse zu Einkommen und Armutsgefährdung finden Sie auf unserer Themenseite Einkommen und Lebensbedingungen, Armutsgefährdung.
Weitere Ergebnisse zur Betroffenheit von Einsamkeit in Deutschland finden Sie in unserem ausführlichen ZVE-Webartikel mit vielen Grafiken und Erläuterungen.
Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 16.07.2025
Statistisches Bundesamt: Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro betrifft bis zu 6,6 Millionen Jobs
- Geschätzte Verdienstsumme der betroffenen Beschäftigungsverhältnisse steigt zum 1. Januar 2026 um bis zu 400 Millionen Euro
- Frauen sowie Beschäftigte in Ostdeutschland profitieren besonders häufig
Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) auf Basis der Verdiensterhebung vom April 2024 werden von der geplanten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2026 deutschlandweit bis zu 6,6 Millionen Jobs betroffen sein. Demnach lag etwa jedes sechste Beschäftigungsverhältnis (rund 17 %) rechnerisch unterhalb des geplanten Mindestlohns von 13,90 Euro pro Stunde. Werden diese Jobs künftig mit dem neuen Mindestlohn vergütet, ergibt sich für die betroffenen Beschäftigten eine geschätzte Steigerung der Verdienstsumme um bis zu 6 % (rund 400 Millionen Euro). Bei der Schätzung wurde angenommen, dass alle Beschäftigten, die weniger als den neuen Mindestlohn von 13,90 Euro verdienten, mindestens den zuletzt gültigen Mindestlohn von 12,82 Euro erhalten. Weitere Lohnsteigerungen nach April 2024 wurden nicht berücksichtigt. Bei gleichbleibender Beschäftigtenzahl und -struktur sind die Ergebnisse daher überschätzt und somit als Obergrenzen zu verstehen.
Frauen und Ostdeutsche profitieren besonders von der Erhöhung auf 13,90 Euro
Frauen profitieren nach der Schätzung überdurchschnittlich häufig von der kommenden Mindestlohnerhöhung: In rund 20 % der von Frauen ausgeübten Jobs erhöht sich demnach der Stundenverdienst, bei Männern sind es nur rund 14 %. Auch regional zeigen sich Unterschiede: In Ostdeutschland liegt der Anteil der betroffenen Beschäftigungsverhältnisse mit rund 20 % deutlich höher als in Westdeutschland mit rund 16 %. Über alle Bundesländer hinweg weist Mecklenburg-Vorpommern mit 22 % den höchsten Anteil an betroffenen Jobs auf, während in Hamburg mit 14 % der geringste Anteil verzeichnet wird. Auch bei den Branchen gibt es deutliche Unterschiede: Besonders stark betroffen sind das Gastgewerbe mit 56 % sowie die Branche „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ mit 43 % aller Jobs.
Maximal 8,3 Millionen Jobs von der zweiten Erhöhungsstufe auf 14,60 Euro betroffen
Zum 1. Januar 2027 soll der Mindestlohn erneut steigen – auf 14,60 Euro pro Stunde. Auf Basis der Verdiensterhebung vom April 2024 werden geschätzt maximal 8,3 Millionen Jobs von der vorgesehenen Erhöhung betroffen sein. Dies entspricht rund 21 % der Beschäftigungsverhältnisse. Werden diese Jobs ab 1. Januar 2027 mit 14,60 Euro entlohnt, ergibt sich eine weitere Steigerung der geschätzten Verdienstsumme um rund 4 % (rund 430 Millionen Euro) im Vergleich zum Zeitpunkt der ersten Erhöhungsstufe ab 1. Januar 2026. Hierbei wurde angenommen, dass alle Beschäftigten, die im April 2024 weniger als den neuen Mindestlohn von 14,60 Euro verdienten, mindestens den ab 1. Januar 2026 gültigen Mindestlohn von 13,90 Euro erhalten. Auch bei dieser Schätzung wurden weitere Lohnsteigerungen nach April 2024 nicht berücksichtigt. Somit sind auch diese Ergebnisse überschätzt und als Obergrenzen zu verstehen.
Methodische Hinweise:
Aufgrund der Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn wurden Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Minderjährige bei den Auswertungen nicht berücksichtigt.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen zum Mindestlohn bietet die Themenseite „Mindestlohn“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.
Über die langfristige Entwicklung des Niedriglohnsektors in Deutschland von April 2014 bis April 2024 informiert die Pressemitteilung Nr. 047 vom 6. Februar 2025.
Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 14.07.2025
INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN
AWO: Neuer Mehrjähriger Finanzrahmen: AWO appelliert an EU, in soziale Infrastruktur zu investieren
Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne für den EU-Haushalt ab 2028 vor und legt so die Prioritäten der EU für die nächsten Jahre fest. Angesichts der großen Veränderungen insbesondere in der europäischen Kohäsionspolitik fordert die AWO gemeinsam mit den anderen Verbänden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), den Menschen in den Mittelpunkt europäischer Investitionen zu stellen.
BAGFW-Präsident Achim Meyer auf der Heyde fordert eine Kohäsionspolitik, die „grundlegende Werte der EU – Menschenrechte und das Rechtsstaatsprinzip – achtet. Bei Verstößen müssen Sanktionen erfolgen. Ohne Frage, die aktuelle Kohäsionspolitik ist reformbedürftig und der Verwaltungsaufwand muss radikal zurückgefahren werden. Soziale Projekte, wie die Unterstützung benachteiligter Familien und Kinder oder die Arbeitsmarktintegration langzeiterwerbsloser Menschen, dürfen aber keinem Spardiktat oder neuen Prioritäten zum Opfer fallen.“
AWO-Präsident Michael Groß weist auf die Bedeutung der Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) hin: „Mit dem Programm ESF Plus werden bundesweit wichtige Impulse für die Armutsbekämpfung gegeben. Durch Beratung und Bildung wird soziale Integration ermöglicht. Jetzt muss es darum gehen, die Neuauflage des ESF spürbar zu vereinfachen, praxisnah zu gestalten und entsprechend auskömmlich auszustatten. Die Wohlfahrtsverbände stehen bereit, um auch in Zukunft im Rahmen des Partnerschaftsprinzips zum Gelingen der EU-Fonds beizutragen – mit ihrer Projektarbeit vor Ort und durch Mitarbeit bei der Ausgestaltung der Förderprogramme.“
Die BAGFW fordert zudem eine umfassende Mittelausstattung der EU-Fonds, insbesondere des Europäischen Sozialfonds, um die sozialen Herausforderungen in allen Regionen Europas zu bewältigen. Dazu gehört, dass die Ko-Finanzierung der EU für soziale Projekte deutlich angehoben wird.
Positionspapier der BAGFW zur Zukunft des Europäischen Sozialfonds: https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmen/positionen/detail/positionspapier-der-bagfw-zur-eu-foerderperiode-ab-2028-mit-dem-europaeischen-sozialfonds-die-transformation-der-gesellschaft-und-der-arbeitswelt-in-zukunft-wirksam-gestalten
Positionspapier zu Zukunft des Regionalentwicklungsfonds: https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmen/positionen/detail/vorschlag-einer-positionierung-zur-efre-foerderung-2028-2034
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 16.07.2025
DGB: Breite Mehrheit der Beschäftigten für Achtstundentag und klare Grenzen für Arbeitszeiten
Die Beschäftigten in Deutschland lehnen eine Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit ab. Eine deutliche Mehrheit wünscht sich Arbeitszeiten innerhalb der Grenzen des Achtstundentags. Besonders deutlich ausgeprägt ist der Wunsch nach klaren Grenzen bei Arbeitnehmer*innen mit Kindern. Dies sind zentrale Befunde einer aktuellen Beschäftigtenbefragung zur Arbeitszeit im Rahmen des DGB-Index Gute Arbeit.
72 Prozent der Befragten wünschen sich Arbeitstage mit maximal acht Stunden. Nahezu alle (98 Prozent) wollen weniger als zehn Stunden pro Tag arbeiten. Auch eine Verschiebung des Arbeitstages in die Abendstunden hinein ist für eine überwältigende Mehrheit keine Option: 95 Prozent der Befragten wollen spätestens um 18 Uhr Feierabend machen.
Die Möglichkeit, den Arbeitstag aufzuteilen und am Abend nachzuarbeiten, ist für die große Mehrheit der Beschäftigten sowohl weltfremd als auch unattraktiv. Nur 17 Prozent der Beschäftigten mit Kindern nutzen solche Möglichkeiten, doch fast alle von ihnen (97 Prozent) würden ihren Arbeitstag lieber spätestens um 19 Uhr beenden.
Somit liefert die Befragung deutliche Signale an Politik und Arbeitgeber, den bestehenden Schutz durch das Arbeitszeitgesetz nicht aufzuweichen, sondern die Lebensrealitäten der Beschäftigten ernstzunehmen.
Dazu die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi:
„Eine Abschaffung des regulären Achtstundentages geht an der Realität der Beschäftigten völlig vorbei. Schon heute leisten die Menschen in Deutschland zahlreiche Überstunden – viele davon unbezahlt – und schon heute vereinbaren die Sozialpartner in tausenden Tarifverträgen flexible Arbeitszeiten. Das Arbeitszeitgesetz in seiner derzeitigen Form bietet dafür ausreichend Spielraum.
Was die Bundesregierung jetzt anstrebt, ist die einseitige Verlagerung der Gestaltung von Arbeitszeiten zugunsten der Arbeitgeber – einschließlich ihrer Verlängerung. Für Beschäftigte ohne einen Schutz durch einen Tarifvertrag hieße das den willkürlich angeordneten Arbeitszeitlängen schutzlos ausgesetzt zu sein.
Mit Symbolpolitik soll von den strukturellen Ursachen der Wirtschaftsflaute abgelenkt und die Schuld den Arbeitnehmer*innen in die Schuhe geschoben werden. Das ist unanständig. Eine Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit löst keines der Probleme der deutschen Wirtschaft. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen eine Abschaffung des regulären Achtstundentages kategorisch ab.
Wer Beschäftigung sichern und dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen will, muss Überstunden abbauen, Belastungen reduzieren und ausreichend Zeit für Familienarbeit, gesellschaftliches Engagement, Erholung und Privates ermöglichen. Größere Arbeitszeitsouveränität bietet insbesondere Frauen die Möglichkeit zu einer höheren Erwerbstätigkeit und mehr finanzieller Unabhängigkeit. Dies würde auch dazu beitragen, die hohe Teilzeitquote zu senken.“
Hintergrund:
Am morgigen Donnerstag, den 24. Juli, startet der Sozialpartnerdialog zum Arbeitszeitgesetz. Die Gewerkschaften lehnen die von der Bundesregierung geplante Änderung von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit ab und werden den Dialog mit einer bundesweiten Kampagne begleiten.
Für den DGB-Index Gute Arbeit wurden im Befragungszeitraum von Januar bis Mai 2025 4.018 Arbeitnehmer*innen befragt.
DGB-Index Gute Arbeit „Grenzen des Arbeitstages“ zum Download |
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 23.07.2025
Diakonie-Bundesvorständin Elke Ronneberger zur Studie „Arbeit lohnt sich immer?!“
Angst und Unsicherheit hemmen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt
Zu der heute veröffentlichten Studie „Arbeit lohnt sich immer?!“ des evangelischen Fachverbandes für Arbeit und soziale Integration (EFAS) sagt Bundesvorständin Sozialpolitik Diakonie Deutschland, Elke Ronneberger:
„Die Erfahrungen der langzeitarbeitslosen Menschen in der Studie zeigen: Angst und Unsicherheit hemmen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Integration gelingt, indem man die Menschen individuell begleitet, sie stärkt und Unsicherheiten abbaut. Statt Langzeitarbeitslose als arbeitsscheu zu stigmatisieren und auf Druck zu setzen, sollten Förderangebote, wie Coaching, Teilhabe am Arbeitsmarkt und Arbeitsgelegenheiten deutlich ausgebaut werden.“
Weitere Informationen
Die Studie steht ab sofort kostenfrei zum Download bereit: Arbeit lohnt sich immer?!
Blog-Beitrag von Elena Weber, Diakonie-Expertin für Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung: „Arbeit lohnt sich immer?!“ – Neue Studie zeigt: Angst bremst die Integration in Arbeit – Diakonie Deutschland
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Diakonie Deutschland vom 18.07.2025
djb: Gleichstellung gehört in den Nachhaltigkeitsbericht
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) betont in seiner aktuellen Stellungnahme zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD): Wer ernsthaft nachhaltig wirtschaften will, muss soziale Gerechtigkeit mitdenken – und dazu gehört die Gleichstellung der Geschlechter.
„Gleichstellung gehört in jede Nachhaltigkeitsstrategie und darf kein optionales Thema bleiben“, sagt Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb.
Die CSRD verpflichtet Unternehmen in der Europäischen Union (EU), offen zu legen, wie sie mit ökologischen und sozialen Fragen umgehen – etwa beim Klimaschutz, bei Arbeitsbedingungen oder in der Unternehmensführung. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat nun einen neuen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie vorgelegt. Der djb begrüßt, dass damit Bewegung in das Verfahren kommt – schließlich hätte die Richtlinie bereits bis Juli 2024 in nationales Recht umgesetzt werden müssen.
Inhaltlich macht sich der djb dafür stark, dass Geschlechtergerechtigkeit ausdrücklich in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und damit im Gesetz berücksichtigt wird. So muss nicht nur in den Diversitätskonzepten von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat im Rahmen der Erklärung zur Unternehmensführung Geschlecht zum zwingenden Bestandteil gemacht werden, sondern auch in den zukünftig daneben notwendigen, die gesamte Belegschaft der Unternehmen umfassenden sog. Nachhaltigkeitsberichten (vormals: nichtfinanzielle Berichte). Zwar verweisen die neuen Vorschriften auf europäische Standards, die bereits differenzierte Inhalte enthalten, diese dürfen aber nicht in der Anwendung verwässert werden. Der djb fordert deshalb, die Berichtspflichten geschlechtergerecht zu interpretieren und die Spielräume bei der Umsetzung klar einzugrenzen.
„Nachhaltigkeitsberichte können ein wirksames Instrument sein, um Unternehmen zu mehr Gleichstellungsverantwortung zu bewegen – wenn sie Fragen der Geschlechtergerechtigkeit nicht ausklammern“, so Prof. Dr. Isabell Hensel, Vorsitzende der djb-Kommission für Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht.
Der djb appelliert deshalb an die Bundesregierung, Gleichstellung als verbindlichen Bestandteil der Unternehmensberichterstattung gesetzlich festzuschreiben.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 21.07.2025
djb: Verbände kritisieren Wahldebakel der neuen Verfassungsrichter*innen
Die am Vorabend der Wahl lancierte und erst heute Vormittag bekannt gewordene Kampagne gegen Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf beschädigt demokratische Abläufe schwer. Die unterzeichnenden Verbände warnen davor, auf Grundlage von nichtbewiesenen Vorwürfen von der bisherigen Einigung abzuweichen.
Die Unterzeichnenden weisen darauf hin, dass die Wahl von Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts einem Verfahren folgt, das jedenfalls im Ergebnis bisher ein hohes Maß an Vertrauen in die gewählten Personen und das Gericht insgesamt sichergestellt hat: Die von den vorschlagenden Fraktionen ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten werden bereits im Vorfeld gründlich auf ihre juristische Qualifikation und persönliche Eignung geprüft; sie stellen sich sodann in allen demokratischen Fraktionen persönlich vor. Gerade diese kollegialen Verfahren im Parlament sind Ausdruck eines demokratischen Miteinanders und verdienen Respekt und Verlässlichkeit. Wenn politische Akteure Kandidatinnen nach Abschluss von Einigungsprozessen und ohne stichhaltige Belege in letzter Minute aus dem Verfahren drängen, untergräbt das das Vertrauen in die Stabilität und Neutralität unserer Verfassungsorgane.
Der Schaden für Demokratie und Rechtsstaat ist immens – die Wahl aller drei vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sollte ordnungsgemäß stattfinden.
Die unterzeichnenden Organisationen:
Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb)
Neue Richter*innenvereinigung e.V. (NRV)
Deutscher Frauenrat e.V. (DF)
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 11.07.2025
Familienbeirat: Familien wünschen sich mehr Zeit, mehr Bildung, mehr Miteinander
Beim diesjährigen Sommerfest der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Moabit kamen Eltern und Schüler*innen im Familienzentrum „Elly“ mit dem Berliner Beirat für Familienfragen ins Gespräch. Offen und direkt berichteten sie von ihren Erfahrungen, Sorgen und Wünschen rund ums Familienleben und den Schulalltag.
Kommunikation, Gemeinschaft, Bildung – was Familien stärkt
Im Fokus vieler Gespräche stand der Wunsch nach mehr Kommunikation und Zeit füreinander – sowohl im Familienleben als auch im schulischen Miteinander. Deutlich wurde, wie wichtig Orte des Austauschs sind: Besonders die vielfältigen Angebote des Familienzentrums „Elly“ fanden große Anerkennung. Es sollte gesichert und dauerhaft gefördert werden – eine Schließung wäre ein herber Rückschritt für die soziale Infrastruktur im Kiez. Gleichzeitig äußerten die Familien den Wunsch nach mehr wohnortnahen Angeboten außerhalb der Schule, um Begegnungen und Vernetzung leichter zu ermöglichen. Ein weiteres zentrales Thema war der Zustand der Schulen. Eltern und Schüler*innen forderten mehr Investitionen in die Bildungsinfrastruktur: Sanierungen, ein besserer Personalschlüssel, mehr Inklusionsangebote sowie eine stärkere Einbindung der Eltern wurden angesprochen. Der einhellige Wunsch war: gute, saubere und inklusive Schulen – für alle Kinder.
Alltagsbelastungen und Lebensumfeld – wo Familien Unterstützung brauchen
Auch Herausforderungen im Alltag kamen zur Sprache: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben belastet viele Eltern. Kinder berichteten von Stress im Schulalltag. Probleme im direkten Wohnumfeld wie Müll und rasende Autos – selbst in als sicher geltenden Spielstraßen – bereiten den Familien Sorgen und verstärken den alltäglichen Druck.
Kazım Erdoğan, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen: „Was Familien uns sagen, ist eindeutig: Sie wollen Verantwortung übernehmen, aber sie dürfen damit nicht allein gelassen werden. Es braucht Investitionen in Bildung und verlässliche Orte wie das Familienzentrum ‚Elly‘. Wer heute Familien stärkt, sichert morgen den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“
Weitere Informationen zu unseren Familienforen finden Sie auf unserer Webseite.
Quelle: Pressemitteilung Berliner Beirat für Familienfragen vom 22.07.2025
Familienbeirat: Alleinerziehende nicht allein lassen: Mental Load und ständige Überforderung belasten die Gesundheit
In Kooperation mit dem Projekt “Familiäre Gesundheitsförderung insbesondere bei Alleinerziehenden (FamGeF)” und der Koordinierungsstelle für Alleinerziehende bei Life e.V. hat der Berliner Beirat für Familienfragen ein Familienforum mit Ein-Eltern-Familien durchgeführt. Das Fazit: Alleinerziehende in Berlin stehen unter erheblichem Druck.
Neben mentaler Überforderung, Schuldgefühlen und gesellschaftlicher Stigmatisierung haben Ein-Eltern-Familien noch existenzielle Sorgen – wie finanzielle Unsicherheit oder ungeklärte Sorgerechtsfragen. Gravierend wird es besonders, wenn die Gesundheitsvorsorge nicht wahrgenommen wird, weil Zeit und organisatorische Kapazitäten fehlen. Diese strukturellen Hürden wirken sich langfristig negativ auf die körperliche und seelische Gesundheit von Eltern und Kindern aus. Es braucht also politische Maßnahmen, die gezielt auf die Lebensrealität Alleinerziehender eingehen:
- Leicht zugängliche Gesundheitsversorgung in den Kiezen
- Stabile Unterstützungsnetzwerke, Bildungsangebote, soziale Treffpunkte und alltagsnahe Hilfen wie Leihgroßeltern, Stadtteilmütter oder Patenschaften
- Flexible und verlässliche Kinderbetreuung
Alleinerziehende tragen allein die Verantwortung für ihre Familien – sie müssen stärker in den Mittelpunkt familienpolitischer Entscheidungen gerückt werden. Sie brauchen niedrigschwellige Unterstützung und strukturelle Entlastungen.
Kazım Erdoğan, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen: „Gesundheit darf kein Luxus im hektischen Familienalltag sein. Ein-Eltern-Familien leisten enorm viel – gerade sie brauchen wohnortnahe Gesundheitsversorgung, flexible Betreuung und soziale Rückendeckung.“
Die detaillierten Ergebnisse des Familienforums finden Sie auf unserer Webseite.
Quelle: Pressemitteilung Berliner Beirat für Familienfragen vom 10.07.2025
LSVD+: Queere Sichtbarkeit ist kein Zirkus
LSVD⁺ warnt vor Rückschritten für queere Sichtbarkeit
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich dagegen ausgesprochen, die Regenbogenflagge auf dem Bundestag zu hissen – dieser sei “kein Zirkuszelt”. Auch am Bundeskanzleramt wird es in diesem Jahr keine Regenbogenflagge geben, auch nicht zum Berliner Christopher Street Day (CSD). Seit 2022 wurde die Regenbogenflagge anlässlich des CSD in Berlin auf dem Bundestag und am Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit (IDAHOBIT* am 17. Mai) am Bundeskanzleramt gehisst. Dazu erklärt Andre Lehmann aus dem Bundesvorstand des LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt, der an allen vergangenen Flaggenhissungen im Bundeskanzleramt teilgenommen hat:
Dass in diesem Jahr die Regenbogenflagge auch am Kanzleramt nicht gehisst werden soll, ist ein fatales politisches Signal an die LSBTIQ* Community – gerade in einer Zeit, in der queerfeindliche Gewalt und Hasskriminalität in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnung neue Höchststände erreichen. Seit Monaten sehen wir massive rechtsextreme Bedrohungen gegen CSDs in ganz Deutschland, nahezu wöchentlich. Im letzten Jahr war etwa jeder dritte CSD betroffen. Damit sind LSBTIQ* in Deutschland eine extrem gefährdete Gruppe. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie weiterhin sichtbar an der Seite von LSBTIQ* steht und Queerfeindlichkeit ernst nimmt. Auch wenn es sich bei der Regenbogenflagge um ein Symbol handelt: Auch bei Symbolen für die Solidarität mit LSBTIQ* darf es keine gesellschaftlichen Rückschritte geben!
Dem Bundeskanzleramt kommt eigentlich eine entscheidende Rolle zu, auf das demokratiegefährdende Problem der massiv zunehmenden queerfeindlichen Hasskriminalität aufmerksam zu machen. Statt dem nachzukommen, reiht sich das Bundeskanzleramt in eine Reihe von Rückschritten für queere Sichtbarkeit ein. Verschiedene Ministerien haben die Regenbogenflagge bereits gehisst oder planen dies sowie eine Teilnahme am CSD. Ein wichtiges Signal der Unterstützung und Solidarität kommt zudem aus dem Vizepräsidium des Bundestags: Sozialdemokratin Josephine Ortleb und der Grüne Omid Nouripour werden die Eröffnungsrede auf dem Berliner CSD halten.
Die Regenbogenflagge ist keine parteipolitische Stellungnahme. Sie ist ein universeller Ausdruck demokratischer Grundwerte wie Respekt, Gleichstellung und einer freien Gesellschaft. Die schwarz-rot-goldene Flagge hat nicht dieselbe Bedeutung wie die Regenbogenflagge als expliziter Ausdruck von Solidarität mit LSBTIQ*, obwohl die Bundesflagge selbstverständlich auch queere Menschen einschließt. LSBTIQ* waren allerdings auch unter der schwarz-rot-goldenen Flagge von staatlicher Ausgrenzung und aktiver Verfolgung betroffen, beispielsweise durch Paragraph 175 StGB. Sicher zu stellen, dass sich das nicht wiederholt, ist auch Aufgabe der amtierenden Bundesregierung.
Weiterlesen:
* Berliner Verwaltungsgericht: Progress-Pride-Flag auf einem Hort einer Grundschule widerspricht nicht dem staatlichen Neutralitätsgebot <https://ea.newscpt9.de/_lnk/?&nid=5110353&sid=545615024&lid=23121487&enc=687474703a2f2f7777772e6c746f2e6465&tg=recht/nachrichten/n/vg3k66824-vg-berlin-progress-pride-flagge-grundschule>
* Wollen CDU/CSU und SPD auch Verantwortung für LSBTIQ* übernehmen? <https://ea.newscpt9.de/_lnk/?&nid=5110353&sid=545615024&lid=23121489&enc=68747470733a2f2f7777772e6c7376642e6465&tg=de/ct/14206-kommentar-koalitionsvertrag>
* Forderungen des LSVD⁺ für die Koalitionsverhandlungen <https://ea.newscpt9.de/_lnk/?&nid=5110353&sid=545615024&lid=23121491&enc=68747470733a2f2f7777772e6c7376642e6465&tg=de/ct/13356-Forderungen-des-LSVD-fuer-die-Koalitionsverhandlungen-2025>
Quelle: Pressemitteilung LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 03.07.2025
LSVD+: Keine Einstufung sicherer Herkunftsstaaten per Verordnung!
LSVD⁺ kritisiert Gesetzesentwurf scharf
Nach dem Beschluss des Bundeskabinetts am 4. Juni wurde der Gesetzesentwurf zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten und sicherer Drittstaaten in erster Lesung verabschiedet. Er sieht vor, unter anderem die geplante Einstufung Marokkos, Algeriens, Tunesiens und Indiens als sogenannte “sichere Herkunftsstaaten” zu erleichtern. Damit soll einerseits die bisher notwendige Zustimmung des Bundesrats wie auch andererseits die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umgangen werden können. Alva Träbert kommentiert hierzu für den Bundesvorstand des LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt:
Wir stellen uns klar gegen diese erneute Verschärfung der Asylpolitik und lehnen das Gesetzesvorhaben zur Einstufung von Herkunftsstaaten per Rechtsverordnung in aller Deutlichkeit ab. In den drei Maghrebstaaten sind LSBTIQ* der Gefahr von mehrjährigen Haftstrafen, Folter durch Zwangsanaluntersuchungen und massiver Gewalt durch die Gesellschaft ausgesetzt. Länder per Rechtsverordnung als “sichere Herkunftsstaaten” zu erklären blendet nicht nur die Lebensrealität und Verfolgungserfahrungen zahlloser (queerer) Geflüchteter aus, es ist auch zutiefst undemokratisch. Die Beteiligung der Zivilgesellschaft in einem regulären Gesetzgebungsverfahren wäre dringend notwendig.
Nicht ohne Grund hat sich der Bundesrat bislang gegen die Aufnahme von Marokko, Algerien und Tunesien in die Liste sicherer Herkunftsstaaten gestellt. Die geplante beschleunigte Bestimmung per Verordnung ist inakzeptabel! Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts dürfen nur solche Staaten als “sicher” eingestuft werden, in denen alle Personen- und Bevölkerungsgruppen vor Gewalt sicher sind. Diese grundrechtlichen Mindestanforderungen gilt es einzuhalten und zu verteidigen..
Eine Einstufung als vermeintlich sicherer Herkunftsstaat bedeutet massive Einschränkungen für Asylsuchende aus diesen Ländern: Es wird unter anderem das Asylverfahren beschleunigt, die Klagefrist gegen einen negativen Asylbescheid auf eine Woche verkürzt und Schutzsuchende sogar aus einem noch laufenden Asylverfahren heraus abgeschoben. Dies trifft gerade auch LSBTIQ* Geflüchtete, da sie sich oft bei der Anhörung aus begründeter Angst und Scham nicht outen und ihren triftigen Asylgrund, nämlich die queerfeindliche Verfolgung, gar nicht vortragen.
Wenn trotz der erheblichen Bedenken dieser Entwurf beschlossen wird, müssen LSBTIQ* Antragsteller*innen aus den als “sicher” eingestuften Ländern aufgrund ihrer besonderen Vulnerabilität von den geplanten Schnellverfahren ausgenommen werden, und ihre Schutzgesuche dürfen grundsätzlich niemals als “offensichtlich unbegründet” abgelehnt werden. Dazu ist eine systematische, flächendeckende Identifizierung besonderer Schutzbedarfe unter Beteiligung der Zivilgesellschaft notwendig. Sonst droht LSBTIQ* Abschiebung, Gewalt und Lebensgefahr, bevor Deutschland über ihren Schutzanspruch überhaupt entschieden hat.
Weiterlesen:
- Keine sicheren Herkunftsstaaten: Algerien, Marokko und Tunesien
- Breites Bündnis: Appell an neue Bundesregierung für verantwortungsvolle Migrationspolitik
- Flüchtlinge schützen – Integration fördern
- Gesetzesentwurf
Quelle: Pressemitteilung LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 10.07.2025
VdK: Familienpolitik auf Sparflamme
- Bentele: „Etat des Bundesfamilienministeriums ist bescheiden“
- VdK fordert bessere Unterstützung pflegender Angehöriger
Statement von VdK-Präsidentin Verena Bentele zum Etat des Bundesfamilienministeriums:
„Für das Bundesfamilienministerium sind im Haushalt des laufenden Jahres 14,12 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist mit Blick auf andere Ressorts ein bescheidener Betrag. Damit rangiert die Familienpolitik am unteren Ende der Prioritätenliste der neuen Bundesregierung, auf Sparflamme in meinen Augen. Aber Familien verdienen mehr.
Um insbesondere Kinder in ihren Familien zu stärken, fordert der VdK den raschen Abbau bürokratischer Hürden und die Zusammenführung unübersichtlicher Einzelleistungen zur Förderung von Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe in allen Lebensbereichen.
Außerdem sollten junge Väter in den ersten zwei Wochen nach der Geburt aktiv unterstützt werden, etwa durch finanzielle Ausgleichsleistungen, damit sie in der prägenden Anfangszeit des Kindes anwesend sind und sich einbringen können.
Auch im Bereich der Pflege sieht der VdK noch großen Handlungsbedarf: In Deutschland werden rund 86 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt, größtenteils durch Angehörige. Für diese braucht es dringend eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Fast die Hälfte der pflegenden Angehörigen reduziert aufgrund der Pflege ihre Arbeitszeit oder gibt ihre Erwerbstätigkeit ganz auf. Dadurch verlieren sie Rentenpunkte und Einkommen. Wir appellieren an die Bundesregierung, pflegende Angehörige finanziell besser abzusichern und deren Armutsrisiko zu verringern. Im Koalitionsvertrag ist eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige als Vorhaben genannt, das wäre ein erster Schritt. Der VdK plädiert für einen einkommensunabhängigen Pflegelohn.“
Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 10.07.2025
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
Der Paritätische: Inforeihe Kinder, Jugend und Familie: Gesprächsrunde zur Situation geflüchteter junger Menschen in Deutschland
Termin: 30. September 2025
Veranstalter: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V.
Im Rahmen der Inforeihe Kinder, Jugend und Familie möchten wir ausgehend von der Online Umfrage des Bundesfachverbandes Minderjährigkeit und Flucht (BuMF) (https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2025/06/bumf-online-umfrage-2024-einseitig.pdf) über die Situation junger Geflüchteter ins Gespräch kommen.
Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage verdeutlichen eine zunehmende Verschärfung der Situation junger Geflüchteter. Gewalt- und Rassismuserfahrungen nehmen zu, ebenso der Ausschluss vom regulären Schulunterricht. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein deutlicher Rückschritt bei Schutz, Bildung und Teilhabe. Asyl- und Versorgungssysteme gestalten sich immer restriktiver. Es entsteht eine Spirale des Drucks, die sich zunehmend auf die Resilienz und psychische Stabilität der jungen Menschen und ihrer Begleiter*innen auswirkt.
Politische Maßnahmen, wie etwa die GEAS-Reform, Zurückweisungen an Binnengrenzen oder die Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten, verdeutlichen eine Politik der Abschottung und Abschreckung. Diese Entwicklungen wirken tief in die Praxis der Jugendhilfe hinein. Verfahren werden restriktiver, Hilfen gekürzt oder verweigert, das Kindeswohl – etwa beim Familiennachzug – vielfach nicht mehr als handlungsleitend wahrgenommen.
Zugleich zeigt die Umfrage, dass Fachkräfte sich an der Seite der jungen Menschen mit viel Kraft und Engagement Entrechtungen entgegenstellen. Außerdem formulieren sie Erfahrungen aus ihrer Praxis dazu, was aus ihrer Sicht Teilhabe ermöglicht und die jungen Menschen stärkt.
Mit
Helen Sundermeyer und Johanna Karpenstein, Referentinnen beim Bundesverband Minderjährigkeit und Flucht (BuMF)
Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Für die Teilnahme an der Fachveranstaltung werden keine Beiträge erhoben.
Hier geht es zur Anmeldung: https://eveeno.com/107268154
Verantwortlich für inhaltliche Fragen
Borris Diederichs, Referent Kinder- und Jugendhilfe, jugendhilfe@paritaet.org, Tel 030 / 246 36 328
Verantwortlich für organisatorische Fragen
Sabine Haseloff, jugendhilfe@paritaet.org, Tel 030 / 246 36 327
Save the Date | Berliner Demografie-Tage 2025: Demografie und Demokratie
Termin: 27. und 28. Oktober 2025
Veranstalter: Population Europe in Zusammenarbeit mit Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)
Ort: Berlin und online
Die Wahlerfolge antidemokratischer Bewegungen lassen sich nicht allein mit den demografischen oder sozioökonomischen Merkmalen einzelner Gruppen erklären. Entscheidender sind lokale Problemwahrnehmungen und Verlustnarrative im Kontext des demografischen Wandels. Diese manifestieren sich in einer empfundenen politischen Überforderung, Schuldzuweisungen und dem vermeintlichen Versagen der „etablierten“ Politik.
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, politischen Stiftungen und der Politik analysieren wir diese demografischen Trends und diskutieren praktische Lösungen auf regionaler und lokaler Ebene.
Abendveranstaltung:
Montag, 27. Oktober 2025, 18:00–21:00 Uhr (MEZ) persönlich oder online (Zoom)
WissenschaftsForum Berlin, Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin
Internationaler Tag:
Dienstag, 28. Oktober 2025, 13:15–17:00 Uhr (MEZ) online (Zoom)
(Während der gesamten Veranstaltung wird eine Simultanübersetzung Deutsch-Englisch angeboten.)
Am 27. Oktober diskutieren:
Karin Prien
(Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
C. Katharina Spieß
(Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB))
Glenn Micallef (tbc)
(EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport)
Shalini Randeria
(Präsidentin der Central European University in Wien)
Jasmin Arbabian-Vogel
(ehemalige Präsidentin des Verbands der Unternehmerinnen in Deutschland (VdU))
Moderation:
Shelly Kupferberg
WEITERE INFORMATIONEN
Deutscher Kinder- und Jugendhilfepreis 2026 ausgeschrieben - jetzt bewerben!
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ hat den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis 2026 in den Kategorien Praxispreis, Medienpreis sowie Theorie- und Wissenschaftspreis ausgeschrieben. Bewerbungen sind jetzt möglich. Der Praxispreis hat das Thema „Demokratiebildung und -förderung in der Kinder- und Jugendhilfe“. Angesprochen sind damit alle Akteur*innen in der Kinder- und Jugendhilfe. Es werden Arbeiten gesucht, die einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Themas Demokratiebildung und -förderung leisten, neue Impulse geben und Innovationspotenzial haben. Die beiden anderen Preiskategorien – Theorie- und Wissenschaftspreis und Medienpreis – sind nicht themengebunden. Pro Kategorie kann ein Preisgeld von 4.000 Euro sowie ein Anerkennungsbetrag von 1.000 Euro vergeben werden.
Der Bewerbungsschluss ist der 10. Oktober 2025. Die elektronischen Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: www.agj.de/djhp/bewerbungsformular.html.