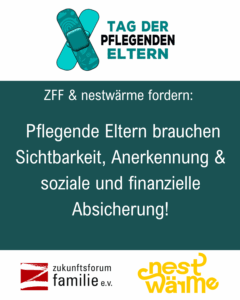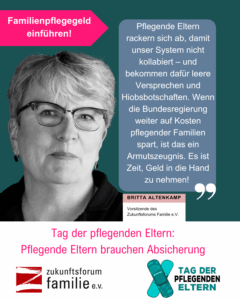AUS DEM ZFF
Die Linke im Bundestag: Kita-Gipfel / Workshop mit Sophie Schwab
Die Geschäftsführerin des ZFF, Sophie Schwab, wird am Kitagipfel der Linken im Bundestag aktiv beteiligt sein. Gemeinsam mit Dominique Schneider (BEVKi) gestaltet Sophie Schwab den Workshop „Standortbestimmung: Kita ein verlässlicher Partner im Familienalltag?“. Wir freuen uns auf den Tag und viele spannende und gewinnbringende Diskussionen.
Termin: 20. November 2025
Veranstalter: Fraktion Die Linke im Bundestag
Ort: Berlin
Seit Jahren ignorieren die jeweiligen Bundesregierungen die Dauerkrise, in der sich das Kita-System befindet – seit Jahren fordern wir die Bundesregierungen auf, endlich die relevanten Akteure zusammen zu bringen, um Lösungen zu erarbeiten. Die Bundesregierung duckt sich mit großer Verlässlichkeit weg, während ein Autogipfel dem nächsten folgt. Nachdem das Problem von Regierungsseite nicht in die Hand genommen wird, kümmern eben wir uns – wie in unserem Hundert-Tage-Programm angekündigt – darum. Zusammen mit euch wollen wir die aktuelle Situation in ihren vielfältigen Dimensionen betrachten und Antworten auf die Kita-Krise erarbeiten und diskutieren.
Die Nachfrage ist groß und die Plätze sind begrenzt. Daher wir eine zeitnahe Anmeldung empfohlen unter: https://veranstaltungen.dielinkebt.de/kitagipfel/
Anmeldeschluss ist der 14.11.2025.
Programm:
09.00 Uhr Einlass
09.30 Uhr Kaffee
10.00 Uhr Eröffnung
Mit: U.a. MdB Heidi Reichinnek und Prof. Dr. Nikolaus Meyer (Hochschule Fulda)
11.00 Uhr Workshops I
- Kita mal vom Kind aus gesehen – Kinderinteressen in den Mittelpunkt stellen. Mit: Sarah Matzke (Deutsches Kinderhilfswerk) Susann Rüthrich (Kinderbeauftragte Sachsen) und MdB Clara Bünger
- Wo bitte geht´s zum Traumjob? Arbeitsbedingungen in den Blick nehmen. Mit: Franziska Bruder (ver.di), Erzieher*innen, Melanie Krause (Kita-Fachkräfteverband Niedersachsen-Bremen) und MdB Anne Zerr
- Herausforderungen sinkender Kinderzahlen: Bessere Qualität statt Schließungen. Mit: Sophie Koch (Volkssolidarität), Norbert Müller (GFB – Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung Brandenburger Kinder und Jugendlicher mbH), Dr. Silvia Ristow (Oberbürgermeisterin Bernburg/Saale) und MdL Eva von Angern (Sachsen-Anhalt)
- Ganztagsbetreuung als Chance: Lern- und Lebensorte kindgerecht gestalten! Mit: Alessandro Novellino (GEW), Regina Thinius (angefragt, Fachdienst „Finanzhilfen für Familien“, Landkreis Potsdam-Mittelmark), Ines Tesch (Schulleiterin Sigmund-Jähn-Grundschule, Fürstenwalde) und MdB Nicole Gohlke
- Herausforderungen in der Erzieher*innenausbildung. Mit: Elke Alsago (ver.di), Ute Eggers (Bundesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien, nicht konfessionell gebundenen Ausbildungsstätten e.V. BöfAE) und MdB Maren Kaminski
12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Workshops II
- Gerät die Qualität in der Krise unter die Räder? Gute Kitas für Alle! Mit: Birte Radmacher (GEW) und Judith Adamczyk (AWO) vom Bündnis Kita-Qualität und Daniela Heimann (Landeselternbeirat NRW)
- Kitafinanzierung, Föderalismus und Beitragsfreiheit – Linke Vorschläge wider die vorherrschende Ohnmacht. Mit: U.a. MdL Ulrike Grosse-Röthig (Thüringen), Anna Weber (LAG Kinderarmut Berlin) und MdBB Miriam Strunge (Bremen)
- Frühkindliche Bildung in Zeiten von Sprachdiagnostik und Deutschkursen. Mit Benedikt Wirth (Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM), Timm Albers (Universität Paderborn)
- Standortbestimmung: Kita ein verlässlicher Partner im Familienalltag? Mit: U.a. Dominique Schneider (Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege BEVKi), Sophie Schwab (Zukunftsforum Familie ZFF) und MdB Mandy Eißing
- Früher Ausgrenzung entgegentreten: Wie verhindern wir soziale Selektion in Kitas? Mit: Niels Espenhorst (Der Paritätische) Kjersti Nichols & Alaa Yakoub Agha (Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt LAMSA e.V.) und MdB Cansin Köktürk
15.00 Uhr Kaffeepause
15.30 Uhr Wie Weiter?!
Zwischenergebnisse und Podiumsdiskussion. Mit: U.a. MdB Heidi Reichinnek
17.00 Uhr Ende & Verabschiedung
Heinrich-Böll-Stiftung: Reproductive Futures Feministische Visionen für gerechte Sorge / Abschlusspanel mit Sophie Schwab
Wir freuen uns, dass unsere Geschäftsführerin, Sophie Schwab, am Abschlusspanel des Festivals „Reproductive Futures- Feministische Visionen für gerechte Sorge“ am 22.11.2025 teilnehmen wird.
Das Abschlusspanel der Veranstaltung bringt Perspektiven aus Wissenschaft, Aktivismus und Praxis zusammen, um über feministische, queere und intersektionale Ansätze zu reproduktiver Gerechtigkeit, Care und Gemeinschaft zu diskutieren.
Termin: 20. – 22. November 2025
Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung
Ort: Berlin
Kuration des Festivals: Sophie Bauer, zusammen mit dem Gunda Werner Institut, der Global Unit für Feminismus und Geschlechterdemokratie und Alisa Tretau mit disruptif e.V. (Nicht nur Mütter waren schwanger)
Das zweitägige Festival „Reproductive Futures. Feministische Visionen für gerechte Sorge“ bringt Akteur*innen aus Wissenschaft, Kunst, Aktivismus und Praxis zusammen, um zentrale Fragen zur Zukunft von Reproduktion, Familie und Sorgearbeit interdisziplinär und intersektional zu beleuchten.
In den drei Programmschwerpunkten Körper, Raum und Zeit schauen wir etwa auf Leihmutterschaft, Schwangerschaftsabbruch und antifeministische Angriffe auf reproduktive Rechte, aber auch auf sorgezentrierte Infrastrukturen und die Zukunft von Sorge.
Freitag, 21. November, 19:00-22:00 Uhr:
Das Reproductive Futures Festival wird mit dem Dokumentarfilm„9-Month Contract” vonKetevan Vashagashvili eröffnet – einer sehr persönlichen Darstellung von Leihmutterschaft, Mutterschaft und Würde in einer unregulierten Reproduktionsindustrie in Tiflis, Georgien.
Im Anschluss an die Vorführung hält Amrita Pande eine Keynote, in der sie ihren neuen Bericht „Mapping Global Surrogacy” vorstellt. Der Abend endet mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Leihmutterschaft und Reproduktionsökonomie mit Amrita Pande, Irina Herb und Ketevan Vashagashvili, moderiert von Derya Binisik von der Global Unit for Feminism and Gender Democracy der Heinrich-Böll-Stiftung.
Diese Veranstaltung am Freitagabend findet komplett auf Englisch statt und kann im Livestream mitverfolgt werden. Teilnehmende via Livestream müssen sich nicht vorab anmelden.
Samstag, 22. November, 11.00 – 20.30 Uhr:
Am 22.11. setzen wir den Tag mit verschiedenen Panels und Installationen rund um das Thema Sorge und Reproduktion fort. Das englischsprachige Panel „Reproductive bodies – Bodies of reproduction“, u.a. mit Amrita Pande, Elizabeth Ngari von Women in Exile und Jonte Lindemann vom genethischen Netzwerk stellen sich die Frage, welche Körper sich gesellschaftlich eigentlich reproduzieren dürfen – und welche strukturell daran gehindert werden. In der Werkstatt zum Thema Schwangerschaftsabbruch beschäftigen wir uns mit der Sorge um Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland: Wie geht’s weiter mit Paragraph 218, was ist ein sicherer Schwangerschaftsabbruch und welche Bilder zum Schwangerschaftsabbruch werden eigentlich medial produziert?
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier.
Dokumentation der Fachtagung „Care, Arbeit, Zukunft. Wer kümmert sich morgen und wie wird´s gerecht?“
Mehr Arbeit, weniger Zeit: Während politische Debatten auf Wettbewerbsfähigkeit und Vollzeit setzen, drohen Care-Arbeit, Familie und Selbstsorge aus dem Blick zu geraten. Schon heute stehen viele Menschen vor der Herausforderung, Beruf, Familie und Pflege zu vereinbaren – oft an der Grenze ihrer Belastbarkeit.
Unsere Dokumentation zeigt, warum Care-Arbeit die Grundlage unserer Gesellschaft ist – und wie sie endlich mehr gesellschaftliche Anerkennung finden und ihre geschlechtergerechte Aufteilung verbessert werden kann.
Die Dokumentation können Sie hier herunterladen.
Zum Tag der pflegenden Eltern am 24. Oktober 2025: Unsere Arbeit ist mehr wert – Finanzielle Absicherung für pflegende Familien unverzichtbar

Am 24. Oktober 2025 findet erstmals der Tag der pflegenden Eltern statt. Ziel ist es, die enorme, meist unbezahlte Pflegearbeit von Eltern sichtbar zu machen, die ihre Kinder mit Behinderung oder chronischer Erkrankung jahrelang betreuen und pflegen. Neben Anerkennung und Solidarität steht in diesem Jahr vor allem eine politische Forderung im Mittelpunkt: die soziale und finanzielle Absicherung der pflegenden Eltern.
Denn pflegende Eltern leisten rund um die Uhr Pflege- und Betreuungsarbeit, meist unbezahlt. Viele müssen ihre Erwerbstätigkeit aufgrund fehlender zuverlässiger Unterstützungs- und Entlastungsangebote reduzieren oder ganz aufgeben. Einkommensverluste, Altersarmut und soziale Isolation sind die Folge. Besonders betroffen sind Allein- und Getrennterziehende, die häufig auf Bürgergeld angewiesen sind.
„Als pflegende alleinerziehende Mutter bin ich 365 Tage im Dienst. Ich habe keinen Urlaub, keine freien Wochenenden, keinen Feierabend. Zum Dank für meine ungesehene Arbeit bekomme ich dauerhaft Bürgergeld. Pflegende Angehörige leisten mehr als jeder 40-Stunden-Arbeitnehmer, werden aber mit Sanktionsdrohungen, Residenzpflicht und vielen weiteren Regeln des SGB II schikaniert. Das ist erniedrigend und zermürbend. Pflegende Angehörige gehören nicht ins Bürgergeld“, erklärt Melanie, die ihren autistischen Sohn mit Pflegegrad 3 pflegt.
Britta Altenkamp, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF) ergänzt: „Pflegende Eltern rackern sich ab, damit unser System nicht kollabiert – und bekommen dafür leere Versprechen und Hiobsbotschaften. Ein Familienpflegegeld wird laut Koalitionsvertrag nur geprüft, während gleichzeitig vehement über Einsparungen in der Pflegeversicherung diskutiert wird. Wenn die Bundesregierung weiter auf Kosten pflegender Familien spart, ist das ein Armutszeugnis. Es ist Zeit, Geld in die Hand zu nehmen! Pflegende Familien brauchen soziale und finanzielle Absicherung im Gegenzug dafür, dass sie den Laden jeden Tag am Laufen halten.“
Bundesweite Aktionen und Symbol der Solidarität
Am 24. Oktober sind bundesweit verschiedene Aktionen geplant: Unterstützer*innen zeigen ihre Solidarität, indem sie zwei gekreuzte Kinderpflaster als Symbol für die Herausforderungen pflegender Eltern tragen. Unter dem Motto „Stell dir vor, du arbeitest rund um die Uhr – und keiner nennt es Arbeit“ posten Eltern ihre täglichen Pflege- und Betreuungsstunden in den sozialen Medien, um die unbezahlte Care-Arbeit sichtbar zu machen.
Der Tag der pflegenden Eltern soll zukünftig jährlich am 24. Oktober stattfinden und ein starkes Signal für Anerkennung, Solidarität und politische Veränderung setzen. 2025 steht dabei klar die Botschaft im Vordergrund: Pflegearbeit ist Arbeit und verdient finanzielle Absicherung, beispielsweise durch ein Pflegegehalt.
Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 22.10.2025
NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT
BMBFSFJ: „Allianz für Aus- und Weiterbildung“: Gemeinsam Fachkräfte sichern
Die Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland sind groß: Zu viele junge Menschen bekommen keinen Berufsabschluss, gleichzeitig bleiben viele betriebliche Ausbildungsstellen unbesetzt – insbesondere, weil Ausbildungsbetriebe keine oder keine passenden Bewerberinnen und Bewerber finden. In Zeiten eines abnehmenden Fachkräftepotenzials aufgrund der hohen altersbedingten Abgänge vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten Jahren ist entschlossenes Handeln erforderlich. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung arbeitet daher engagiert und intensiv daran, jungen Menschen die Perspektiven und Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung aufzuzeigen. So soll das duale Ausbildungssystem gestärkt werden.
Am 10. November treffen sich die Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Allianz für Aus- und Weiterbildung in Berlin. Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie sowie Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales nehmen neben Vertreterinnen und Vertretern der Bundesagentur für Arbeit, aus Wirtschaft, Gewerkschaften sowie der Länder an dem Spitzentreffen teil.
Im Rahmen des Spitzentreffens werden die Ergebnisse der noch laufenden Allianzperiode (2023 – 2025) präsentiert. Verschiedene Initiativen wurden angestoßen, um möglichst vielen jungen Menschen den Weg in eine duale Ausbildung zu ebnen und so das vorhandene Fachkräftepotenzial bestmöglich zu nutzen. Dazu gehören:
- Ein Netzwerk von Ausbildungsbotschafter-Initiativen: Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter sind junge Auszubildende oder gerade fertig Ausgebildete, die in Schulen gehen und bei Schülerinnen und Schülern über die duale Ausbildung berichten. Das Netzwerk umfasst bereits 110 Initiativen und bringt diese zum Austausch zusammen.
- Ausbildungsgarantie: Die Allianz hat deren Start begleitet, ihre Fördermöglichkeiten bekannter gemacht und steht weiterhin für ihre Botschaft, dass allen jungen Menschen die Chance auf Ausbildung eröffnet werden soll.
- Grundlegende Positionspapiere: Die Allianz hat sich darauf verständigt, die Grundkompetenzen bei Ausbildungsanfängerinnen und -anfängern zu stärken, die Berufswahlkompetenzen junger Menschen zu fördern sowie Jugendberufsagenturen bundesweit zu stärken.
- Sommer der Berufsausbildung: Im Rahmen der von Bundeskanzler Friedrich Merz mit einem Grußwort gewürdigten Initiative haben die Allianzpartner sowohl bei jungen Menschen als auch bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit vielfältigen Veranstaltungen für die duale Ausbildung geworben.
In der neuen Allianzperiode ab 2026 wollen die Allianzpartnerinnen und -partner weiter Herausforderungen am Ausbildungsmarkt angehen, möglichst allen Menschen die Chance für einen Berufsabschluss geben und unter anderem die Durchlässigkeit der beruflichen Bildung verbessern. Dazu sollen die berufliche Orientierung gestärkt sowie Unterstützungsangebote und -bedarfe zusammen gebracht werden.
Im Detail zur „Allianz für Aus- und Weiterbildung“
Die „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ ist seit über zehn Jahren die zentrale politische Plattform und ein Aktionsbündnis für die duale Ausbildung. In der Allianz arbeiten Ministerien und Behörden aus Bund und Ländern sowie Wirtschaft und Gewerkschaften gemeinsam daran, die Aus- und Weiterbildung zu stärken und somit zur Fachkräftesicherung beizutragen.
Weitere Informationen befinden sich auf der Webseite der Aus- und Weiterbildungsallianz: https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 10.11.2025
BMBFSFJ: Abschlussbericht der Kommission "Bürokratiearme Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie"
Kommission übergibt Vorschläge zur bürokratiearmen Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie an Bundesministerin Karin Prien
Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit – dieses Ziel verfolgt die Entgelttransparenzrichtlinie der Europäischen Union. Sie soll den Entgeltgleichheitsgrundsatz zwischen Frauen und Männern fördern und muss bis Juni 2026 in nationales deutsches Recht umgesetzt werden. Bundesministerin Karin Prien hat dazu eine Kommission berufen, die heute ihre Vorschläge für eine bürokratiearme und effektive Umsetzung der Richtlinie vorgelegt hat.
Bundesfrauenministerin Karin Prien: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – damit Leistung sich wirklich lohnt. Das ist gerecht, für Männer und für Frauen. Die Expertenkommission hat bei den Empfehlungen zwei Ziele in den Blick genommen: Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie muss wirksam sein für die Beschäftigten und aufwandsarm für die Arbeitgeber. Wichtig ist mir: Die Unternehmen müssen Handlungssicherheit haben, damit die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland nicht dadurch gefährdet wird. Und klar ist auch: Eine faire Bezahlung hilft, Potenziale zu heben.“
Der Abschlussbericht enthält Vorschläge zur Ausgestaltung der Transparenzinstrumente „Berichtspflicht“ und „Auskunftsanspruch“, zu der Frage der Privilegierung von tarifgebundenen Arbeitgebern sowie zur Frage der begleitenden Unterstützung von Unternehmen durch die Bundesregierung. Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) wird die Vorschläge prüfen und einen Referentenentwurf erarbeiten. Ziel ist es, das Gesetzgebungsverfahren Anfang 2026 einzuleiten.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 07.11.2025
Bündnis 90/Die Grünen: Bundesregierung muss mentale Gesundheit junger Menschen endlich zur Priorität machen
Zur Vorstellung des Zehn-Punkte-Plans der Bundesschülerkonferenz zur Verbesserung der mentalen Gesundheit junger Menschen erklärt Dr. Anja Reinalter, Parlamentarische Geschäftsführerin:
Die mentale Gesundheit junger Menschen ist kein Nice-to-have – sie ist Grundvoraussetzung für Bildung, Entwicklung und Zukunft. Wer psychisch überfordert ist, verliert Lernkraft, Motivation und Vertrauen in sich selbst – und damit auch seine Ausbildungs- und Studierfähigkeit. Damit verlieren wir als Gesellschaft genau die jungen Menschen, die wir morgen als Fachkräfte so dringend brauchen.
Fehlende mentale Gesundheit hat nicht nur persönliche Folgen, sondern auch gesellschaftliche und wirtschaftliche: Allein im Gesundheitswesen entstehen dadurch jährlich Kosten von über 63 Milliarden Euro.
Jetzt muss die Bundesregierung liefern – mit einer nationalen Strategie für mentale Gesundheit, mehr Stellen für Schulsozialarbeit, mit Beratungsangeboten für Eltern und Fortbildung von Lehrkräften. Es ist unverständlich, dass die Bundesregierung das erfolgreiche Programm der Mental-Health-Coaches an Schulen auslaufen lässt. Zumal sie bisher keinerlei eigene Initiativen in diesem Bereich gestartet hat.
Zugleich braucht es eine stärkere Förderung digitaler und Medienkompetenz, damit Kinder und Jugendliche sich sicher im Netz bewegen. Vor allem müssen junge Menschen an politischen Prozessen, die sie betreffen, wirklich beteiligt werden.
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 30.10.2025
Bündnis 90/Die Grünen: Keine diskriminierenden Sonderregelungen für trans*, inter* und nicht-binäre Menschen
Zum vorläufigen Scheitern des Verordnungsentwurfs zur Umsetzung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag im Meldewesen erklärt Misbah Khan, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende:
Der Widerstand gegen die geplanten Verschärfungen im Meldewesen für trans*, inter* und nicht-binäre Menschen war erfolgreich. Ohne Mehrheit im Bundesrat musste die Bundesregierung die umstrittene Verordnung kurzfristig von der Tagesordnung nehmen.
Die Verordnung hätte diskriminierende Sonderregelungen geschaffen und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung massiv eingeschränkt. Dabei ist sie fachlich schlicht überflüssig: Das Selbstbestimmungsgesetz stellt bereits heute sicher, dass die Identität einer Person nachvollziehbar bleibt, auch für Sicherheitsbehörden.
Die Bundesregierung muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, mit ihrem Vorgehen nicht nur unnötiges Misstrauen gegenüber queeren Menschen geschürt, und sich dabei erneut mit rechtsextremen und menschenfeindlichen Kräften gemeingemacht zu haben, sondern auch erneut versucht zu haben, ein verfassungsrechtlich höchst problematisches Vorhaben ohne gesicherte politische Mehrheit durchzusetzen.
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 17.10.2025
Bundestag: Grüne: Weiterbildungen sollen leichter zugänglich sein
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert eine grundlegende Reform des Aufstiegs-BAföG. In einem entsprechenden Antrag (21/2562) bezeichnet sie Weiterbildung als zentralen Schlüssel, um die großen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen die deutsche Volkswirtschaft und der Arbeitsmarkt stehen und verweist auf die Fachkräftelücke. Die Anforderungen an das Wissen und die Kompetenzen von Arbeitnehmern würden steigen, zum Beispiel durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. „Weiterbildung ist gleichzeitig ein wirksamer Schutz vor Arbeitslosigkeit und eine Chance, neue Karrierewege zu gehen und persönliche Talente und Potenziale zu entfalten“, schreiben die Abgeordneten. Wegen Zeitmangel, familiärer Verpflichtungen oder aus Kostengründen würden viele Interessierte jedoch keine Weiterbildung beginnen, hier müsse endlich gegengesteuert werden, heißt es in dem Antrag.
Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Reform des Aufstiegs-BAföG (AFBG) vorzulegen. Dieser soll unter anderem den Unterhaltsbeitrag nach Paragraf 10 AFBG für Aufstiegsfortbildungen, die in Teilzeit absolviert werden, öffnen. Außerdem soll der Unterhaltsbeitrag an den Bedarfssatz in Paragraf 13 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes gekoppelt werden. Auch Fortbildungen, die zu einer Qualifikation auf derselben Fortbildungsstufe beziehungsweise Kompetenzniveau gemäß DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen) führen, sollen für eine Förderung mit dem AFBG geöffnet werden. Ferner verlangt die Fraktion, den Kinderbetreuungszuschlag nach Paragraf 10 AFBG auf 250 Euro pro Monat anzuheben. Die Meisterausbildung sowie gleichgestellte Weiterbildungen an Fachschulen und -akademien sollen kostenfrei werden, indem der Darlehensanteil vollständig entfällt und das AFBG als Vollzuschuss zu sämtlichen Fortbildungs-, Material-, und Prüfungskosten gezahlt wird, heißt es in dem Antrag weiter.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 591 vom 07.11.2025
Bundestag: Linke will „queeres Leben stärken“
„Queeres Leben stärken – Christopher-Street-Days schützen“ lautet der Titel eines Antrags der Fraktion Die Linke (21/2575), der am kommenden Mittwoch erstmals auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht. Darin fordert die Fraktion die Bundesregierung auf, auf der Innenministerkonferenz (IMK) die Sicherheitslage queerer Menschen auf die Tagesordnung zu setzen. „Gegenstand der Beratung sollten Maßnahmen sein, um queerfeindliche Tatmotive besser zu erkennen und im Rahmen polizeilicher Meldedienste zu erfassen sowie Opfer queerfeindlicher Hasskriminalität besser zu unterstützen“, heißt es in der Vorlage weiter.
Auch soll die Bundesregierung nach dem Willen der Fraktion „gemeinsam mit der IMK und im Dialog mit Versammlungsbehörden und der queeren Community rechtzeitig eine Gesamtstrategie erarbeiten, um 2026 die sichere Teilnahme an CSD/Pride-Veranstaltungen und die umfassende Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten“. Des Weiteren dringt die Fraktion darauf, das Programm „Queer leben“ auszubauen und weiterzuentwickeln. Dabei sollen dem Antrag zufolge „die Prävention gegen queerfeindliche Diskriminierung und Hassgewalt sowie die Strukturen der queeren Communities in den Kommunen“ gestärkt werden.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 591 vom 07.11.2025
BiB.Monitor Wohlbefinden 2025: Wie zufrieden sind Ein- und Ausgewanderte?
In Deutschland hat jede vierte Person eine Einwanderungsgeschichte. Von diesen 21,2 Millionen Menschen sind rund drei Viertel selbst nach Deutschland zugewandert, ein weiteres Viertel wurde hierzulande geboren. Doch wie geht es dieser vielfältigen Bevölkerungsgruppe – wie zufrieden ist sie? Antworten darauf gibt der aktuelle BiB.Monitor Wohlbefinden 2025 des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB). Auf Basis des familiendemografischen Panels FReDA und weiterer Datensätze untersucht der diesjährige Monitor, wie sich die Lebenszufriedenheit von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nach ihrer Ein- und Auswanderungsgeschichte unterscheidet. Dies umfasst sowohl Zugewanderte und deren Nachkommen als auch Menschen, die aus Deutschland weggezogen sind. Das Besondere am BiB.Monitor Wohlbefinden: Er beleuchtet nicht nur die durchschnittliche Zufriedenheit, sondern identifiziert auch die Anteile der wenig und der sehr Zufriedenen, also die Verteilung an den Rändern.
Das subjektive Wohlbefinden ist ein zentraler Indikator für den individuellen und den gesamtwirtschaftlichen Wohlstand. Im Kontext der Zuwanderung ist es darüber hinaus ein wichtiger Indikator dafür, wie gut Integration und Teilhabe gelingen. „Die Lebenszufriedenheit von Menschen mit Einwanderungsgeschichte variiert durchaus nach Herkunftsland“, erläutert BiB-Direktorin und Mitautorin Prof. Dr. C. Katharina Spieß. Eine herkunftsbezogene Differenzierung bei der Erfassung des Wohlbefindens ermöglicht es, migrationsspezifische Herausforderungen sichtbar zu machen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Einwanderungsgeschichte weiterzuentwickeln. „Dies kann uns wichtige Hinweise für eine gelingende Integration geben“, so Spieß.
Befragte, die selbst zuwanderten, sind zufriedener als die Kinder von Zugewanderten
Die durchschnittliche Lebenszufriedenheit ist bei der Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte und bei Eingewanderten gleich hoch – sie liegt auf einer Skala von 1 bis 10 bei jeweils 7,1 Punkten. Vor allem eingewanderte Frauen berichten mit 7,3 Punkten eine relativ hohe Zufriedenheit, die über dem Wert der Männer liegt (7,0 Punkte). Interessant: Nachkommen von Eingewanderten liegen nur bei 6,8 Punkten; diese Gruppe weist zudem den höchsten Anteil wenig Zufriedener auf. Berücksichtigt man jedoch sozioökonomische und demografische Merkmale wie Einkommen, Bildung oder Haushaltsstruktur, verschwinden die Unterschiede. „Merkmale wie das Einkommen, die Erwerbstätigkeit, die formale Bildung oder die Haushaltszusammensetzung hängen sowohl mit der Einwanderungsgeschichte als auch mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Deshalb ist es wichtig, sie bei dem Vergleich von Bevölkerungsgruppen und deren Wohlbefinden zu berücksichtigen“, erklärt Mitautor Dr. Sebastian Will, wissenschaftlicher Mitarbeiter am BiB.
Mit längerem Aufenthalt ist die Lebenszufriedenheit höher
Die Lebenszufriedenheit von Zugewanderten ist mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland deutlich höher. Besonders hoch ist sie bei Menschen, die bereits vor mehr als 45 Jahren eingewandert sind: Sie erreichen im Durchschnitt 7,8 Punkte und weisen mit 33 Prozent den größten Anteil sehr Zufriedener auf. Zugleich ist in dieser Gruppe der Anteil der wenig Zufriedenen am geringsten, während er in den anderen Gruppen mit kürzerer Aufenthaltsdauer höher ausfällt. „In der Tendenz gilt: Je länger Zugewanderte in Deutschland leben, desto zufriedener sind sie mit ihrem Leben“, resümiert Will.
Hohe Zufriedenheit bei Zugewanderten aus Osteuropa
Die durchschnittliche Lebenszufriedenheit liegt bei Zugewanderten aus dem westlichen Ausland mit 7,1 Punkten auf dem gleichen Niveau wie bei Menschen, die in Deutschland geboren wurden. Bevölkerungsgruppen aus Osteuropa weisen mit 7,2 Punkten noch etwas höhere Werte auf, während in Asien und Afrika Geborene mit 6,9 Punkten im Mittel geringere Zufriedenheitswerte zeigen. Nach Berücksichtigung von Merkmalen wie Einkommen, Alter oder Erwerbstätigkeit verringern sich die Unterschiede, sodass nur Eingewanderte aus Osteuropa weiterhin eine signifikant höhere Lebenszufriedenheit aufweisen.
Schutzsuchende aus der Ukraine mit geringeren, aber steigenden Zufriedenheitswerten
Ukrainerinnen und Ukrainer stellen derzeit die größte Gruppe der in Deutschland lebenden Schutzsuchenden dar und weisen mit durchschnittlich 6,3 Punkten eine vergleichsweise niedrige Lebenszufriedenheit auf. Dies mag auch darin begründet liegen, dass in der Ukraine weiterhin Krieg herrscht. „Die allgemeine Zufriedenheit dieser Gruppe hat sich aber seit ihrer Ankunft in Deutschland von 5,9 Punkten im Jahr 2022 auf 6,3 Punkte im Sommer 2023 erhöht“, berichtet C. Katharina Spieß. „Dieser Anstieg hängt unter anderem mit dem Erlernen der deutschen Sprache, einer besseren Wohnsituation und einer Erwerbstätigkeit zusammen.“ Mehr als die Hälfte (51?Prozent) der ukrainischen Schutzsuchenden zählt zu den wenig Zufriedenen, wobei ältere Schutzsuchende über 50 Jahre besonders betroffen sind (60?Prozent).
Frauen aus der Ukraine sind im Durchschnitt unzufriedener als Männer, insbesondere Frauen über 50 Jahre, während Männer unter 50 Jahren am zufriedensten sind. Konkrete Faktoren, die die Lebenszufriedenheit erhöhen, sind gute Deutschkenntnisse, das Leben außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, das Vorhandensein minderjähriger Kinder und einen Partner oder eine Partnerin im Haushalt und damit in Deutschland.
Ausgewanderte in Südeuropa am zufriedensten
Während viele Menschen nach Deutschland zuwandern, erwägen andere eine Auswanderung oder sind bereits ausgewandert. Im Jahr 2024 haben 0,4 Prozent der Deutschen ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt. Von der im BiB.Monitor Wohlbefinden untersuchten Gruppe von Ausgewanderten leben die meisten seit durchschnittlich vier Jahren im Ausland und zu 71 Prozent in europäischen Ländern. Diese Ausgewanderten mit deutschem Pass berichten im Durchschnitt über eine höhere Lebenszufriedenheit als die Wohnbevölkerung in Deutschland, mit Spitzenwerten in Südeuropa (7,7 Punkte) und in nichteuropäischen Niedrigeinkommensländern wie der Türkei, China oder Mexiko (7,6 Punkte). Auch nach Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren bleiben vor allem die nach Südeuropa Ausgewanderten leicht zufriedener im Vergleich zu in andere Länder Ausgewanderten.
Deutlich weniger zufrieden zeigt sich hingegen die Bevölkerungsgruppe im jungen und mittleren Erwachsenenalter, die in Deutschland lebt, aber beabsichtigt, auszuwandern: Der durchschnittliche Zufriedenheitswert der Bevölkerungsgruppe, die eine eigene Auswanderung als wahrscheinlich einschätzt, liegt bei lediglich 6,4 Punkten.
Insgesamt ist die Lebenszufriedenheit in Deutschland leicht angestiegen
Insgesamt hat sich in Deutschland die durchschnittliche Lebenszufriedenheit im jungen und mittleren Erwachsenenalter (bis 52 Jahre) über alle Bevölkerungsgruppen hinweg stabilisiert und gegenüber den Vorjahren leicht verbessert. Im Vergleich zum Herbst 2022 stieg der Wert um gut 0,2 Punkte und lag Ende 2023 bei rund 7,1. „Der Anteil sehr Zufriedener nahm zu, während der Anteil wenig Zufriedener zurückging – ein deutlich positiverer Befund als etwa im Pandemiejahr 2021“, fasst BiB-Direktorin Spieß zusammen. Als mögliche Gründe für diese Entwicklung nennen die Forschenden das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen, einen gewissen Gewöhnungseffekt an die Ukraine-Krise sowie den Rückgang der Inflation ab Mitte 2023. Insgesamt nähert sich die Lebenszufriedenheit damit langsam wieder dem Vor-Pandemie-Niveau von etwa 7,4 Punkten an.
Studiendesign und zugrunde liegende Datensätze
Der BiB.Monitor Wohlbefinden untersucht einmal jährlich die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung in Deutschland. Dabei nimmt er wechselnde Aspekte in den Fokus. Die diesjährige Studie zum Wohlbefinden der Bevölkerung mit Wanderungsgeschichte stützt sich auf mehrere repräsentative Datensätze (FReDA, SHARE, BiB/FReDA-Ukraine-Stichprobe, IAB-BAMF-SOEP, GERPS), die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben wurden. Die meisten Ergebnisse lassen sich auf das Jahr 2023 beziehen. Insgesamt ermöglichen die Datensätze einen breiten Blick auf das Wohlbefinden verschiedener Bevölkerungsgruppen mit realisierten oder geplanten Zu- und Auswanderungsabsichten.
Link zum Download der Studie:
www.bib.bund.de/wohlbefinden-2025
Quelle: Pressemitteilung Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 29.10.2025
BiB: Tradwives – mehr Hype als Realität? Junge Frauen in Deutschland vertreten mehrheitlich ein egalitäres Rollenbild
Bei jungen Frauen in Deutschland dominiert ein egalitäres Rollenbild: Knapp zwei Drittel von ihnen haben entsprechende Einstellungen zur weiblichen Rolle. Sie erwarten beispielsweise keine negativen Folgen aus der Erwerbstätigkeit von Müttern auf ihre Kinder und sehen eine traditionelle Arbeitsteilung tendenziell nicht als die beste Lösung für Familien an. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor. Die Analysen basieren auf den Einstellungen zur weiblichen Rolle von 2.709 Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren, die über das familiendemografische Panel FReDA (2021 und 2023) befragt wurden.
Wie aus der Untersuchung hervorgeht, bilden unter den befragten Personen die als konsistent egalitär eingruppierten Frauen mit 62,2 % die größte Gruppe. „Sie stehen für eine partnerschaftliche Arbeitsteilung bei Familie und Beruf und befürworten gleichstellungsbezogene Grundsätze“, erklärt Dr. Sabine Diabaté vom BiB und Mitautorin der Studie. Knapp ein Fünftel (19,3 %) und damit deutlich weniger vertritt ein vereinbarkeitsorientiertes Modell: Diese Frauen unterstützen Gleichstellung zwar grundsätzlich, halten – anders als die Frauen mit einer egalitären Einstellung – eine Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern und Eltern insgesamt jedoch als schlecht vereinbar mit den Bedürfnissen der Kinder. Der reichweitenstarke Social-Media-Trend der sogenannten „Tradwives“ – Influencerinnen, die ein traditionelles Rollenbild von Weiblichkeit, Mutterschaft und Fürsorgearbeit idealisieren – spiegelt sich ebenfalls bei knapp einem Fünftel der jungen Frauen (18,5 %). Diese Gruppe vertritt Einstellungen, die jenen der „Tradwives“ ähneln, weil sie die Mutterschaft als existenzielle Lebensaufgabe einer Frau ansehen, die Ehe stark idealisieren und eine traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau befürworten. Dazu zählen etwa die Überzeugungen, dass ein Kleinkind unter der Erwerbstätigkeit seiner Mutter leidet, eine Frau ohne ein Kind kein erfülltes Leben führen könne oder dass sich Frauen stärker auf die Familie als auf eine Karriere konzentrieren sollten.
Religion, Familie und Bildung als entscheidende Faktoren bei „Tradwife“-Überzeugungen
Eine vertiefte Analyse der jungen Frauen, deren Einstellungen zur weiblichen Rolle dem „Tradwife“-Muster stark ähneln, zeigt deutliche Zusammenhänge mit persönlichen Lebensumständen und sozialen Hintergründen: Vor allem Frauen, die sich selbst als religiös bezeichnen, vertreten mit höherer Wahrscheinlichkeit ein traditionelles Rollenbild. Auch Frauen, die selbst Mutter und verheiratet sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, solche Überzeugungen zu teilen. Zudem vertreten formal niedrig und mittel gebildete Frauen eher Einstellungen, die dem „Tradwife“-Ideal entsprechen, als hochgebildete. „Höher gebildete Frauen machen im Durchschnitt eher beruflich Karriere und sind häufiger finanziell unabhängig. Womöglich sind sie dadurch egalitärer eingestellt und hinterfragen traditionelle Rollenbilder – oder sie wählen gerade wegen ihrer egalitären Überzeugungen emanzipatorische Lebensentwürfe“, beschreibt Mitautorin Dr. Leonie Kleinschrot vom BiB das Phänomen.
Die Ergebnisse machen deutlich: Traditionelle Bilder der weiblichen Rolle sind zwar auf Social Media sichtbar und somit auch reichweitenstark, prägen jedoch im realen Leben nur eine Minderheit. Die Mehrheit der jungen Frauen in Deutschland orientiert sich an egalitären Vorstellungen.
Quelle: Pressemitteilung Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 22.10.2025
DIW: Wohneigentum hängt in Deutschland immer noch stark von den Eltern ab
inder von Eltern mit Wohneigentum haben höhere Chancen, eigene Immobilien zu besitzen, als Kinder von Mieter*innen – Zusammenhang schwächt sich aber in jüngeren Generationen ab: Immer mehr wohnen zur Miete – Abbau von Eigenkapitalhürden könnte sinnvoll sein
Junge Menschen in Deutschland besitzen deutlich seltener Wohnimmobilien als ihre Eltern und wohnen zunehmend zur Miete. Wer jedoch aus einer Eigentümerfamilie stammt, hat weiterhin deutlich bessere Chancen, selbst in den eigenen vier Wänden zu leben. Dieser Zusammenhang hat sich zwar abgeschwächt, ist im europäischen Vergleich aber hoch. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), die DIW-Forscher Philipp Lersch mit zwei Kollegen von der Universität Oxford auf Basis von EU-SILC-Daten erstellt hat.
„Chancenungleichheit beim Wohneigentum aufgrund des familiären Hintergrunds besteht in Deutschland weiterhin, aber sie hat deutlich abgenommen“, fasst Lersch zusammen. Für die zwischen 1951 und 1954 geborenen Kinder lag die Wahrscheinlichkeit um 24 Prozentpunkte höher, Wohnimmobilien zu besitzen, wenn ihre Eltern ebenfalls Immobilien besaßen. Für die zwischen 1985 und 1989 geborenen Kinder sank sie auf 15 Prozentpunkte.
Der Trend geht zur Mietimmobilie
Die Menschen in Deutschland wohnen zunehmend zur Miete, auch wenn ihre Eltern Wohneigentum besaßen. Gleichzeitig besitzen weniger junge Menschen aus Mieterfamilien Immobilien als frühere Jahrgänge. Folglich schwächt sich der relative Zusammenhang zwischen elterlichem Wohneigentum und dem der Kinder über die Zeit deutlich ab. Zwar mag dies bei einigen auch Ausdruck sich wandelnder Wünsche an ihre Wohnsituation sein. Umfragen belegen aber den verbreiteten Wunsch nach Wohneigentum, das als zentrale Form der Vermögensbildung und Altersvorsorge gilt. „Selbst wenn junge Menschen gerne in die eigenen vier Wände ziehen würden, gelingt es ihnen immer seltener“, konstatiert Lersch, der im DIW Berlin die Forschungsgruppe Lebensverlauf und Ungleichheit leitet.
„Ob man sich Wohneigentum leisten kann, darf keine Frage der Herkunft sein.“ Philipp M. Lersch
Ein Hauptgrund sind wohl die rasant gestiegenen Immobilienpreise: Seit 2011 legten sie in Deutschland um 77 Prozent zu – weitaus stärker als die Realeinkommen. Gleichzeitig sind die Mieten in Deutschland im europäischen Vergleich günstig und die Rechte der Mietenden hoch. Dies trägt dazu bei, dass im EU-Vergleich Wohneigentum in Deutschland wenig verbreitet ist. Dennoch hängt hierzulande der Wohneigentumsstatus der Kinder stärker von dem ihrer Eltern ab als in den meisten anderen europäischen Ländern.
„Politisches Ziel sollte nicht sein, allen Menschen zu Wohneigentum zu verhelfen“, meint Lersch. „Wichtiger ist es, Wohnraum zugänglich zu machen, der – unabhängig davon, ob im Eigentum oder zur Miete – den Bedürfnissen der Menschen entspricht.“ Dazu müsse eine umfassende Strategie entwickelt werden, die Menschen Auswahl und Entscheidungsfreiheit auf dem Wohnungsmarkt ermöglicht, die also für genügend Wohnraum zu erschwinglichen Preisen sorgt. „Ob man sich Wohneigentum leisten kann, darf keine Frage der Herkunft sein. Eigenkapitalhürden sollten daher gesenkt werden – etwa durch Modelle wie den Mietkauf.“
LINKS:
- Studie im DIW Wochenbericht 44/2025
- Infografik in hoher Auflösung (JPG, 0.72 MB)
- Interview mit Studienautor Philipp M. Lersch
- Audio-Interview mit Philipp M. Lersch (MP3, 15.91 MB)
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) vom 29.10.2025
Hans-Böckler-Stiftung: IMK: Stabilisierung des Rentenniveaus ist generationengerecht und finanzierbar
Die Stabilisierung des Rentenniveaus ist sozialpolitisch notwendig, generationengerecht und finanziell tragbar. Gerade mit Blick auf Generationengerechtigkeit sollte eine Stabilisierung auf Dauer angelegt sein und nicht nur bis 2031, wie es der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung vorsieht. Zusätzlich brauche es eine bessere Verzahnung aus Renten- und Arbeitsmarktpolitik, um ungenutzte Potenziale für eine stärkere Erwerbsbeteiligung zu erschließen. Das betont Dr. Ulrike Stein, Rentenexpertin des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung in einer Stellungnahme für die heutige Expert*innenanhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags.*
„Ein stabiles Rentenniveau ist entscheidend für die Sicherung des Lebensstandards und stärkt das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung – über Generationen hinweg“, so Stein. „Unsere Analysen zeigen: Von der Stabilisierung profitieren Jung und Alt gleichermaßen, jüngere Generationen werden nicht benachteiligt.“ Eine aktuelle IMK-Studie** zeigt detailliert, dass eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus, wie sie im gescheiterten Rentenpaket II der Ampelkoalition vorgesehen war, für Menschen aller Geburtsjahrgänge zwischen den 1940ern und 2010 die interne Rendite der gesetzlichen Rente erhöht. Das heißt: Alle heute Erwerbstätigen sowie junge Menschen, die aktuell kurz vor Eintritt ins Berufsleben stehen und ein wesentlicher Teil der heutigen Rentner*innen erhalten durch eine Stabilisierung im Verhältnis zu ihren Beiträgen überproportional mehr Rente (Link zur Studie unten).
Seit den späten 1970er Jahren ist das Rentenniveau von knapp 60 Prozent auf rund 48 Prozent gesunken, wo es nach dem Gesetzentwurf bis 2031 stabilisiert werden soll, zeigt Steins Analyse. Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung hat sich dagegen seit 1970 lediglich von 17 auf 18,6 Prozent erhöht. Stein betont, dass ein weiter sinkendes Rentenniveau nicht nur die individuelle Lebensstandardsicherung vieler Menschen gefährde, sondern einen wesentlichen Teil der Kosten für die Allgemeinheit lediglich in die Grundsicherung verlagern würde. „Eine solide Haltelinie wirkt der Zunahme von Armutsrisiken entgegen und sorgt dafür, dass die gesetzliche Rente weiterhin eine tragende Säule des Sozialstaats bleibt“, so Stein.
Die Stabilisierung sei zudem grundsätzlich finanzierbar. Dass sich der Bund im Rahmen des Rentenpakets 2025 stärker über Steuermittel an der Finanzierung beteiligen möchte, ist ebenfalls ein akzeptabler Weg, analysiert die IMK-Expertin. Seit 2003 ist der Anteil der Gesamtausgaben des Bundes an der Finanzierung der Rentenversicherung, gemessen an der Wirtschaftsleistung, von 3,5 auf 2,7 Prozent des BIP gesunken – obwohl die Zahl der Altersrenten um 16 Prozent gestiegen ist. Die Bundeszuschüsse und -mittel dienen dazu, Leistungen im gesamtgesellschaftlichen Interesse zu finanzieren, die nicht über Beiträge gedeckt sind. Dazu zählen etwa Folgekosten der deutschen Wiedervereinigung. Allerdings decken die Bundeszuschüsse laut Deutscher Rentenversicherung die nicht beitragsgedeckten Leistungen längst nicht vollständig ab; allein 2023 betrug die Finanzierungslücke rund 40 Milliarden Euro. „Die gesetzliche Rente bleibt finanzierbar – wenn die Politik bereit ist, ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen“, so Stein.
Das Rentenpaket 2025 enthält zudem die Einführung der Mütterrente III, die eine vollständige Gleichstellung der Kindererziehungszeiten vorsieht. Aus Gerechtigkeitsperspektive ist diese Maßnahme laut IMK nachvollziehbar. Allerdings ist nach Einschätzung von Stein der bürokratische Aufwand hoch, die individuelle Entlastung gering, und die volkswirtschaftlichen Kosten beträchtlich. Die Maßnahme koste rund fünf Milliarden Euro, bringe den Betroffenen aber netto oft nur rund 15 Euro monatlich pro Kind. Das Geld sei in anderen Bereichen sinnvoller eingesetzt.
Generell bewertet das IMK das Rentenpaket 2025 vor allem wegen der Stabilisierung des Rentenniveaus als Schritt in die richtige Richtung. An anderer Stelle scheue die Bundesregierung in ihrer Rentenpolitik aber vor einer notwendigen Veränderung der Schwerpunktsetzung zurück: „Anstatt zu diskutieren, wie Rentner*innen mit befristeten Arbeitsverträgen weiterbeschäftigt, die Regelaltersgrenze erhöht oder teure Anreize zum Weiterarbeiten (Aktivrente) geschaffen werden können, sollte der Fokus darauf liegen, ungenutzte Erwerbspotenziale unter Personen im erwerbsfähigen Alter besser zu aktivieren“, schreibt die Forscherin in ihrer Stellungnahme. Besonders bei Frauen und jungen Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss gebe es erhebliche Reserven. Stein verweist auf Defizite im Bildungssystem und Fehlanreize im Steuer- und Abgabensystem, die eine Ausweitung des individuellen Arbeitsvolumens behinderten. Wichtig sei zudem ein besserer Ausbau der Betreuungsinfrastruktur für Kinder und Pflegebedürftige. Nur so könnten mehr Menschen – insbesondere Frauen – ihre Erwerbstätigkeit ausweiten und die soziale Sicherung langfristig stabilisieren.
Quelle: Pressemitteilung Hans-Böckler-Stiftung vom 10.11.2025
Hans-Böckler-Stiftung: 51 Prozent aller Beschäftigten bekommen Weihnachtsgeld, mit Tarifvertrag 77 Prozent – Tarifliche Ansprüche reichen von 250 Euro bis zu mehr als 4.200 Euro
Alle Jahre wieder: Nicht nur das Weihnachtsfest naht in großen Schritten, sondern auch das Weihnachtsgeld. So ist es zumindest für gut die Hälfte der Beschäftigten (51 Prozent), bei denen der Arbeitgeber die Sonderzahlung zusätzlich zum regulären Gehalt überweist, und zwar meist schon im November. Einige Arbeitgeber tun dies freiwillig oder als eingeübte Praxis. Einen rechtlich verbindlichen Anspruch auf Weihnachtsgeld sichert eine entsprechende Vereinbarung im Tarifvertrag. Deshalb macht es einen großen Unterschied, ob der Arbeitgeber nach Tarifvertrag zahlt oder nicht: Mehr als drei Viertel der Beschäftigten (77 Prozent) in Betrieben mit Tarifvertrag erhalten Weihnachtsgeld, ohne Tarifvertrag sind es mit 41 Prozent deutlich weniger. Das ergibt eine Umfrage unter gut 58.000 Beschäftigten durch das Internetportal Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird.
Die Umfrage zeigt außerdem, dass Männer (54 Prozent) etwas häufiger als Frauen (48 Prozent) Weihnachtsgeld ausgezahlt bekommen und Beschäftigte in Westdeutschland (53 Prozent) bessere Aussichten auf einen Bonus zum Fest haben als jene in Ostdeutschland (41 Prozent) (siehe Abbildung 1 in der pdf-Version dieser PM; Link unten). Auch zwischen Beschäftigten mit einem unbefristeten Vertrag (52 Prozent) und einem befristeten Vertrag (48 Prozent) gibt es geringfügige Unterschiede, ebenso zwischen Beschäftigten in Vollzeit (53 Prozent) und in Teilzeit (46 Prozent). Der Analyse zufolge bleibt der entscheidende Faktor aber die Tarifbindung des Arbeitgebers.
„Auch die Grundgehälter sind mit Tarifvertrag in aller Regel höher – das Weihnachtsgeld ist ein echtes Extra, das nicht an anderer Stelle wieder abgezwackt wird“, sagt Dr. Malte Lübker, Gehaltsexperte am WSI. „Tarifverträge lohnen sich für die Beschäftigten nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über.“ Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) arbeiteten im Jahr 2024 nur noch 49 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, verglichen mit 68 Prozent im Jahr 2000. Grund dafür ist neben dem Ausscheren etablierter Unternehmen – wie zuletzt beim Sportartikelhersteller Adidas –, dass neu gegründete Betriebe oft erstmal versuchen, einen Tarifvertrag zu verhindern. „Einen Tarifvertrag durchzusetzen, erfordert meist einen langen Atem – und setzt voraus, dass Belegschaft und Gewerkschaft gemeinsam dafür kämpfen“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Umso wichtiger ist, dass die Politik Tarifbindung unterstützt und nicht unterminiert, wie das lange Zeit durch eine Vergabe öffentlicher Aufträge einfach nach dem billigsten Angebot ging. Das Bundestariftreuegesetz ist dafür ein wichtiger Baustein.“
Große Unterschiede bei der Höhe des tarifvertraglichen Weihnachtsgeldes
Die Höhe des tariflichen Weihnachtsgelds variiert zwischen den einzelnen Branchen teilweise erheblich: Bei den mittleren Entgeltgruppen reicht sie in der Endstufe von 250 Euro in der Landwirtschaft Bayern bis zu 4.235 Euro in der Chemischen Industrie Nordrhein. Vergleichsweise hohe Beträge werden auch in der Energieversorgung Nordrhein-Westfalen (4.113 Euro), der Süßwarenindustrie Baden-Württemberg (3.900 Euro) und der Textilindustrie Westfalen und Osnabrück (3.751 Euro) gezahlt. Auch im Privaten Bankgewerbe (3.719 Euro) und bei der Deutschen Bahn (3.399 Euro) können sich Beschäftigte in den kommenden Wochen über ein dickes Extra freuen. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des WSI-Tarifarchivs von 23 ausgewählten größeren Branchen (siehe die Tabelle in der pdf-Version).
Nur wenige Branchen haben beim Weihnachtsgeld einen Pauschalbetrag festgelegt. In den meisten Fällen wird das Weihnachtsgeld als fester Prozentsatz vom Monatsentgelt berechnet. In Branchen, in denen für 2025 höhere Tarifentgelte vereinbart wurden, hat sich auch das Weihnachtsgeld entsprechend erhöht. Einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr gab es beispielsweise für die Tarifbeschäftigten im Gastgewerbe Bayern (+9,6 Prozent), bei der Deutschen Bahn AG (+9,0 Prozent) und in der Süßwarenindustrie Baden-Württemberg (+7,6 Prozent).
Ein klassisches 13. Monatsentgelt im Sinne einer Sonderzahlung von 100 Prozent eines Monatsentgeltes erhalten die Beschäftigten in der Chemischen Industrie, Teilen der Energiewirtschaft, in der Süßwarenindustrie, bei der Deutschen Bahn AG, im Privaten Bankgewerbe sowie in einzelnen westdeutschen Tarifregionen der Textilindustrie und dem privaten Transport- und Verkehrsgewerbe. In der Eisen- und Stahlindustrie werden sogar 110 Prozent eines Monatsentgeltes gezahlt, wobei hier Weihnachts- und Urlaubsgeld zu einer Jahressonderzahlung zusammengelegt wurden. Auch im Öffentlichen Dienst gibt es eine einheitliche Jahressonderzahlung, die an die Stelle des früher üblichen Weihnachts- und Urlaubsgeldes getreten ist. Sie beträgt bei den kommunalen Arbeitgebern, die für die Auswertung berücksichtigt wurden, je nach Vergütungsgruppe zwischen 52 und 85 Prozent des Monatsentgeltes.
Da Tarifverträge oft regional ausgehandelt werden, gib es teilweise zwischen den einzelnen Bundesländern und damit auch zwischen Ost- und Westdeutschland Unterschiede in der Höhe der Sonderzahlung. In einigen Branchen können die Unterschiede mehrere hundert Euro, in Einzelfällen wie im Bauhauptgewerbe auch noch über tausend Euro zugunsten der Beschäftigten im Westen ausmachen. Ein Ausnahmefall ist die Landwirtschaft, wo das Weihnachtsgeld in Mecklenburg-Vorpommern mit 275 Euro geringfügig höher ist als in Bayern (250 Euro). Keine Ost-West-Unterschiede gibt es beispielsweise in den bundesweit gültigen Tarifverträgen im Privaten Bankgewerbe, im Versicherungsgewerbe, im öffentlichen Dienst und der Deutschen Bahn AG.
Unter den großen Wirtschaftszweigen sind Tarifbranchen ohne Weihnachtsgeld oder eine vergleichbare Sonderzahlung die Ausnahme. Kein Weihnachtsgeld gibt es im Gebäudereinigungshandwerk und der Floristik. Dasselbe trifft auf das ostdeutsche Bewachungsgewerbe zu, während in einigen Regionen Westdeutschlands das Weihnachtsgeld erst nach einer bestimmten Anzahl von Berufsjahren gewährt wird.
Informationen zur WSI-Lohnspiegel-Datenbank
Die Berechnungen zur Häufigkeit von Weihnachtsgeld beruhen auf den Angaben von 58.119 Beschäftigten mit mehr als einem Jahr Berufserfahrung, die zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025 an einer Online-Erhebung des WSI-Portals Lohnspiegel.de teilgenommen haben. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, erlaubt aber aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitswelt. Lohnspiegel.de ist ein nicht-kommerzielles Angebot der Hans-Böckler-Stiftung.
Eine Auswertung des Statistische Bundesamt war im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis gekommen, dass sogar gut 85 Prozent der Tarifbeschäftigten Weihnachtsgeld erhalten. Die Differenz zur WSI-Auswertung ergibt sich aus jeweils unterschiedlichen Erhebungsmethoden und Fragestellungen. In der Online-Umfrage von Lohnspiegel.de werden die Beschäftigten explizit danach gefragt, ob sie Weihnachtsgeld erhalten. Das Statistische Bundesamt wertet hingegen Tarifverträge aus und rechnet auf dieser Grundlage die Verbreitung von Weihnachtsgeld hoch. Dabei werden alle Sonderzahlungen berücksichtigt, die im November oder Dezember ausgezahlt werden.
Die Pressemitteilung mit Abbildung und Tabelle (pdf)
Quelle: Pressemitteilung Hans-Böckler-Stiftung vom 05.11.2025
Hans-Böckler-Stiftung: Arbeiten im Ruhestand verbreitet – 55 Prozent der mitbestimmten Betriebe beschäftigen Rentner*innen oder Pensionär*innen
Die Beschäftigung von Rentner*innen und Pensionär*innen ist in vielen Betrieben und öffentlichen Dienststellen verbreitet. Das zeigt eine neue Auswertung der Betriebs- und Personalrätebefragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.* Mehr als die Hälfte der befragten knapp 3.700 Betriebs- und Personalräte berichtet, dass in ihren Einrichtungen Menschen über das Renten- oder Pensionsalter hinaus tätig sind. Diese Beschäftigung folgt oft einem stabilen Muster: 82,5 Prozent der Betriebs- und Personalräte, in deren Betriebe Ruheständler*innen arbeiten, berichten, dass die Betroffenen bereits vor Renten- oder Pensionsbeginn in derselben Einrichtung tätig waren. Und wenn sie weiterbeschäftigt werden, führen sie auch in der Regel ihre bisherige Tätigkeit fort. Rentner*innen und Pensionär*innen gehen ihrer Arbeit jedoch meist mit reduzierter Stundenzahl und ganz überwiegend in Minijobs nach. „Offensichtlich ist also unter den bestehenden Rahmenbedingungen bereits viel möglich und die Beschäftigung dieser Personengruppe folgt auch den Wünschen und Fähigkeiten der Betreffenden und den Einsatzmöglichkeiten in Branchen und Betrieben“, schreiben die Studienautoren Dr. Florian Blank und Dr. Wolfram Brehmer. Die Befunde sind auch vor dem Hintergrund aktueller politischer Diskussionen interessant. Die Bundesregierung will über Steuererleichterungen („Aktivrente“) sowie vereinfachte Befristungsmöglichkeiten die Beschäftigung im Rentenalter fördern. Die Wissenschaftler warnen vor Nebenwirkungen der Pläne: Im ungünstigsten Fall könnten Arbeitgeber die geplante Förderung missbrauchen, um Ältere auszunutzen und Löhne zu drücken.
Die WSI-Befragung ist repräsentativ für Betriebe und Dienststellen mit mehr als 20 Beschäftigten und Betriebs- oder Personalrat. Die Daten von 2023 zeigen, dass rund 55 Prozent der mitbestimmen Betriebe Menschen beschäftigen, die eine Altersrente oder Pension beziehen. Dabei unterscheiden sich Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst kaum voneinander. In den genannten Betrieben machen Beschäftigte im Rentenalter 1,4 Prozent der Belegschaft aus. Überdurchschnittlich häufig arbeiten sie in kleineren Betrieben und in Dienstleistungsbranchen.
In der Befragung sollten Betriebs- und Personalräte auch angeben, aus welchen Gründen Ältere weiterbeschäftigt werden. 86 Prozent sagten, Wissen und Fähigkeiten der Älteren würden im Betrieb weiter gebraucht. Knapp 57 Prozent gaben zu Protokoll, dass keine anderen Arbeitskräfte verfügbar gewesen seien und fast ebenso viele, dass sich Rentner*innen und Pensionär*innen flexibel einsetzen ließen. Andere Gründe – Jüngere einarbeiten, Kostenersparnisse – spielten eine geringere Rolle. 89 Prozent gaben zudem an, dass mit der Weiterbeschäftigung den Interessen der Rentner*innen entsprochen werde. Ruheständler*innen werden am häufigsten in Form von Minijobs weiterbeschäftigt. Dies gilt vor allem für die private Wirtschaft.
In aller Regel arbeiten Ruheständler*innen, die im alten Betrieb weiterbeschäftigt sind, auch in ihrem alten Tätigkeitsbereich. Dabei genießen sie üblicherweise keine Vergünstigungen in Form von weniger anstrengenden Aufgaben oder weniger Verantwortung. Sie werden „eingesetzt und behandelt wie jüngere Beschäftigte“, so die Forscher. Im Vergleich zu Jüngeren haben sie aber meist eine geringere Wochenarbeitszeit, können ihre Arbeitszeiten relativ stark selbst bestimmen und müssen keine Nacht- und Schichtarbeit leisten.
Es sei schwer zu sagen, ob die „Aktivrente“ und erleichterte sachgrundlose Befristungen zu noch mehr Beschäftigung im Rentenalter beitragen könnten, schreiben Blank und Brehmer. Zumal viele Beschäftigte lieber früher als später in den Ruhestand wechseln möchten und auch viele Unternehmen Möglichkeiten für einen früheren Ausstieg aus dem Arbeitsleben anbieten.
Die Wissenschaftler sehen aber eine gewisse Gefahr darin, dass die geplanten Gesetzesänderungen einen neuen „zweitklassigen Arbeitnehmer*innenstatus“ schaffen könnten, mit älteren Beschäftigten, die arbeitsrechtlich weniger geschützt sind als ihre jüngeren Kolleg*innen. „Im schlimmsten Fall würde die Verbindung aus der Rente beziehungsweise Pension und der Steuererleichterung im Sinne eines Kombilohns wirken“, erklären Blank und Brehmer. Dann liefe es auf eine Subventionierung von Unternehmen hinaus, die Ältere – die dank Rente weniger auf den Verdienst angewiesen sind – mit geringeren Löhnen abspeisen könnten. Das könnte wiederum Druck auf die Einkommen der regulär Beschäftigten ausüben.
„Anstelle der geplanten Änderungen, deren Wirkungen völlig unklar sind und die für den Staatshaushalt eine deutliche Belastung darstellen können, sollte der Fokus auf gute Arbeit, auf die Gesundheit der Beschäftigten und auf Anerkennung ihrer Leistungen gelegt werden“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Davon würden alle Beschäftigten, jüngere wie ältere, profitieren und sicher würden auch die Fähigkeit und die Bereitschaft steigen, länger zu arbeiten.“
Quelle: Pressemitteilung Hans-Böckler-Stiftung vom 30.10.2025
Hans-Böckler-Stiftung: Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen bringt kaum Entlastung – Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen gehen weitgehend leer aus
Nach den Plänen der schwarz-roten Koalition sollen Überstundenzuschläge künftig unter bestimmten Bedingungen steuerfrei bleiben. Doch wie viele Menschen von der neuen Regelung profitieren würden und wie hoch die Steuerersparnis ausfällt, war bisher unklar. Eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt jetzt: Nur eine verschwindend kleine Minderheit von 1,4 Prozent aller Beschäftigten könnte sich künftig auf einen Steuerbonus freuen, der Rest geht leer aus.* Im Durchschnitt aller Beschäftigten in Deutschland blieben deshalb nur 0,87 Euro pro Monat steuerfrei, die mittlere Steuerersparnis fällt mit monatlich 0,31 Euro noch einmal dürftiger aus. Gleichzeitig entfällt die Entlastung ganz überwiegend auf Beschäftigte aus der oberen Hälfte der Entgeltverteilung. Die Berechnungen des WSI beruhen auf der Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes vom April 2024, die detaillierte Gehaltsdaten von rund 9,6 Millionen Beschäftigten enthält.
„In den Betrieben haben sich Arbeitszeitkonten durchgesetzt und Mehrarbeit kann später durch Freizeit ausgeglichen werden“, so Studienautor Dr. Malte Lübker. Nach den Ergebnissen der IAB-Arbeitszeitrechnung verfällt zudem die Mehrheit der Überstunden im engeren Sinne. „Bezahlte Überstunden sind inzwischen eher ein Randphänomen“, so Lübker. Laut Verdiensterhebung bekamen im April 2024 nur 5,1 Prozent der Beschäftigten Überstunden ausbezahlt, darunter waren 1,8 Prozent mit einem Überstundenzuschlag (siehe auch Tabelle 1 in der pdf-Version dieser PM; Link unten). Nach den Koalitionsplänen sollen Überstunden jedoch nur berücksichtigt werden, wenn diese über die normale Vollzeit hinausgehen, sodass sich mit 1,4 Prozent ein noch kleinerer Kreis von Begünstigten abzeichnet. Beschäftigte in Teilzeit erreichen die Vollzeitschwelle auch inklusive Überstunden nur in Ausnahmefällen, sodass von ihnen nur 0,2 Prozent einen Steuervorteil erwarten können. Geringfügig Beschäftigte gehen leer aus. Deutlich häufiger profitieren hingegen Vollzeitbeschäftigte (2,4 %). Für Beschäftigte mit Tarifvertrag (1,7 %) sind die Aussichten auf einen Steuerbonus etwas besser, als wenn der Tarifvertrag fehlt (1,1 %).
Da Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer, würden unter ihnen nur 0,5 Prozent von der Steuerbefreiung profitieren. Bei Männern ergibt sich ein höherer Anteil von 2,2 Prozent. Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich auch bei der Höhe der freigestellten Beträge: Während Männer künftig pro Monat durchschnittlich 1,46 Euro steuerfrei mit nach Hause nehmen würden, sind es bei Frauen nur 0,23 Euro pro Monat. Dies liegt nur zum Teil daran, dass Frauen aufgrund der ungleichen Verteilung der Sorgearbeit weniger Überstunden machen als Männer. Entscheidend ist vielmehr, dass bei Frauen aufgrund des Vollzeit-Erfordernisses nur rund die Hälfte (54 %) der Überstunden mit Zuschlag unter das neue Steuerprivileg fallen würde. Bei Männern sind es neun von zehn Überstunden mit Zuschlag (88 %). Entgeltexperte Lübker sieht darin einen Beleg für die mittelbare Diskriminierung von Frauen.
Auch wenn die individuelle Entlastung insgesamt sehr klein ist: Das Koalitionsvorhaben hat zudem problematische Auswirkungen auf die Einkommensverteilung. Rund 95 Prozent des Entlastungsvolumens käme Beschäftigten aus der oberen Hälfte der Entgeltverteilung zugute, während auf die untere Hälfte nur 5 Prozent der Gesamtsumme entfallen. Für Arbeitnehmer*innen mit einem Bruttomonatsverdienst von bis zu 3.041 Euro beträgt die durchschnittliche Steuerersparnis gerade einmal 3 Cent pro Monat, für das Zehntel mit den höchsten Gehältern hingegen 1,18 Euro (siehe auch Tabelle 2 in der pdf-Version). „Die neue Studie zeigt, wie sozial unausgewogen das Vorhaben ist“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Statt eine breite Entlastung zu bewirken, würde von dem Steuerprivileg in erster Linie eine kleine Gruppe von Beschäftigten profitieren, die auch so ein auskömmliches Gehalt haben. Das trägt weiter zur Ungleichheit in der Gesellschaft bei und setzt ein falsches Signal.“
Das Vorhaben, das auf das Wahlprogramm der CDU/CSU zurückgeht, war zuletzt auch vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen scharf kritisiert worden. Die Ökonom*innen hatten argumentiert, dass die neue Regelung das Steuerrecht noch komplexer macht und erhebliche Bürokratiekosten bei Arbeitgebern und in der Finanzverwaltung verursachen würde. Außerdem bezweifelten sie, dass die Steuerersparnis aufgrund ihrer geringen Höhe einen wirksamen Anreiz für Mehrarbeit setzt. Der Beirat war dabei unter großzügigen Annahmen von einer Steuerersparnis von 3,50 Euro pro Überstunde ausgegangen. Die neue WSI-Analyse zeigt, dass der Steuerbonus in der Realität mit 1,35 Euro pro Überstunde deutlich geringer ausfallen dürfte. Für Beschäftigte mit einem Bruttoverdienst von bis zu 3.041 Euro beläuft sich das durchschnittliche Plus beim Netto-Gehalt sogar nur auf 0,39 Euro pro steuerbegünstigter Überstunde mit Zuschlag. Grund dafür ist unter anderem, dass für Beschäftigte mit geringerem Einkommen auch der Steuersatz geringer ist und Überstundenzuschläge geringer ausfallen als bei Beschäftigten mit höherem Einkommen.
Handlungsbedarf besteht laut der neuen WSI-Studie in anderen Bereichen. So verfällt derzeit nach der IAB-Arbeitszeitrechnung mehr als die Hälfte aller geleisteten Überstunden ohne Bezahlung und ohne Freizeitausgleich. Um dies zu verhindern, sollten laut Studie verbleibende Lücken in der Arbeitszeiterfassung geschlossen werden. Zudem gibt es bei einigen Arbeitgebern – beispielsweise im Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen – die fragwürdige Praxis, auch bereits erfasste Überstunden unter bestimmten Bedingungen wieder aus den Arbeitszeitkonten zu löschen.
Trotzdem hat sich auf den Arbeitszeitkonten in Deutschland inzwischen ein Berg von fast 500 Millionen bereits geleisteter Stunden im Wert von rund 9,5 Milliarden Euro angesammelt. „Wenn Beschäftigte in Bereichen mit besonders hoher Arbeitsbelastung keine realistische Perspektive auf Freizeitausgleich haben, kann es sinnvoll sein, die Zeitguthaben auszuzahlen“, so Lübker. „Ob ein etwaiger Überstundenzuschlag dabei steuerfrei bleibt oder nicht, ist für die Beschäftigten eher zweitrangig.“
Die Pressemitteilung mit Tabellen.
Quelle: Pressemitteilung Hans-Böckler-Stiftung vom 17.10.2025
IAB: Kaum Fortschritte: Frauen besetzen immer noch weniger als jede dritte Spitzenposition
Frauen stellen fast die Hälfte aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft, doch nur 29 Prozent der obersten Führungskräfte sind weiblich. Der Anteil hat sich seit über 20 Jahren um nur 4 Prozentpunkte erhöht. In Betrieben mit familienfreundlichen Maßnahmen ist der Anteil von Frauen in Spitzenpositionen stärker gestiegen als in Betrieben ohne solche Angebote – dennoch zeigt sich: Der Gender Leadership Gap bleibt bestehen. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die auf dem IAB-Betriebspanel beruht.
Trotz hoher Qualifikation und hohem Bildungsniveau sind Frauen in Spitzenpositionen der Privatwirtschaft nach wie vor unterrepräsentiert. Im Jahr 2024 waren 29 Prozent der Positionen auf der obersten Führungsebene weiblich besetzt – deutlich weniger als ihr Anteil an allen Beschäftigten von 45 Prozent. Auf der zweiten Führungsebene liegt der Anteil mit 42 Prozent fast auf Beschäftigtenniveau. „Familienfreundliche Maßnahmen in Betrieben können helfen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, ersetzen jedoch nicht öffentliche Angebote wie ausreichend Kinderbetreuungsplätze“, erklärt IAB-Forscher Michael Oberfichtner.
Deutlich besser schneiden ostdeutsche Betriebe ab: Hier liegt das Repräsentanzmaß für Frauen auf der obersten Führungsebene bei 0,72, in Westdeutschland nur bei 0,64. Das Repräsentanzmaß misst, wie stark Frauen entsprechend ihrem Anteil an allen Beschäftigten in Führungspositionen vertreten sind. Ein Wert von 1,0 bedeutet Gleichstellung, Werte unter 1 zeigen eine Unterrepräsentanz. Besonders stark vertreten sind Frauen in Führungspositionen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bildungsbereich.
Der Anteil der Betriebe, die Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbieten, ist seit 2016 von 32 auf 59 Prozent gestiegen. Am häufigsten werden flexible Arbeitszeiten angeboten, inzwischen in 56 Prozent der Betriebe. In diesen arbeiten 77 Prozent aller Beschäftigten. Unterstützung bei Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen bleibt dagegen selten. „Sorgearbeit wird noch immer überwiegend von Frauen übernommen. Betriebliche Unterstützung in diesen Bereichen ist daher ein wichtiger Baustein für mehr Gleichstellung in Führungspositionen“, so IAB-Forscherin Susanne Kohaut.
In Branchen, in denen familienfreundliche Maßnahmen bereits 2016 verbreitet waren, ist der Anteil weiblicher Führungskräfte seither stärker gestiegen. Dies gilt insbesondere für den Bereich Gesundheit und Soziales sowie für Interessenvertretungen und Verbände. „Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind längst kein reines Gleichstellungsthema mehr, sondern Wettbewerbsfaktor – gerade im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte“, so IAB-Forscherin Iris Möller.
Dennoch bleiben Netzwerke familienfreundlicher Unternehmen die Ausnahme: Nur zwei Prozent der Betriebe sind Mitglied in einem solchen Zusammenschluss.
Die Studie ist abrufbar unter: https://doku.iab.de/kurzber/2025/kb2025-24.pdf.
Quelle: Pressemitteilung Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) vom 04.11.2025
Statistisches Bundesamt: Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung 2025 um 5,6 % gesunken
- Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in Folge, Betreuungsquote steigt dennoch auf 37,8 %
- Erstmals sinkt auch die Gesamtzahl der betreuten Kinder, demgegenüber weiterhin Zuwachs bei Kitas und Beschäftigten
- Zahl der Tagesmütter und -väter geht im fünften Jahr in Folge zurück
Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum Stichtag 1. März 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 47 100 oder 5,6 % auf insgesamt 801 300 Kinder gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung damit im zweiten Jahr in Folge ab (2024: -8 200 Kinder bzw. -1,0 % zum Vorjahr). Dennoch stieg die Betreuungsquote unter Dreijähriger leicht auf 37,8 % (2024: 37,4 %). Der Anstieg der Betreuungsquote trotz rückläufiger Betreuungszahlen ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren stärker zurückging als die Zahl der betreuten Kinder dieser Altersgruppe. Die Ursache dafür sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen drei Jahre. Auch die Zahl der insgesamt betreuten Kinder ist gesunken, während die Zahl der Kitas und die Zahl der Beschäftigten in Kindertagesstätten weiter anstiegen.
Insgesamt 0,8 % weniger Kinder in Kindertagesbetreuung
Insgesamt waren am 1. März 2025 bundesweit 4 059 400 Kinder in Kindertagesbetreuung. Das waren 33 800 oder 0,8 % weniger als im Vorjahr. Damit war die Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 rückläufig, nachdem sie zuvor kontinuierlich um durchschnittlich 60 500 Kinder pro Jahr (+1,7 %) gestiegen war. Bereits im Jahr 2024 war der Anstieg nur gering (+0,1 %).
Von den insgesamt betreuten Kindern wurden 3 913 400 (96,4 %) in einer Kindertageseinrichtung betreut. 146 000 Kinder (3,6 %) wurden in einer öffentlich geförderten Kindertagespflege, etwa durch Tagesmütter oder -väter, betreut.
Betreuungsquoten unter Dreijähriger im Osten nach wie vor höher als im Westen
Bei den Betreuungsquoten unter dreijähriger Kinder gibt es nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern. So waren in den östlichen Bundesländern (einschließlich Berlin) zum Stichtag 1. März 2025 durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung (54,9 %). In den westlichen Bundesländern war die Betreuungsquote mit 34,5 % nach wie vor deutlich geringer.
0,6 % mehr Kitas, jedoch 5,9 % weniger Tagesmütter und -väter als im Vorjahr
Am 1. März 2025 gab es bundesweit rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das waren etwa 400 oder 0,6 % mehr als im Vorjahr. Die Zahl der dort als pädagogisches Personal oder als Leitungs- und Verwaltungspersonal beschäftigten Personen stieg um 17 500 oder 2,2 % auf 795 700. Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen weiter, obwohl die Zahl der betreuten Kinder zurückging.
Auch wenn der Anteil der Männer, die in der Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ gering ist, steigt dieser stetig an. Am 1. März 2025 waren 67 400 Männer im pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungsbereich in einer Kita beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 2 600 oder 4,0 % mehr. Der Männeranteil – bezogen auf alle tätigen Personen in diesen Bereichen – lag damit bei 8,5 %.
Im Gegensatz zum Kita-Personal sank die Zahl der Tagesmütter und -väter im fünften Jahr in Folge, und zwar um 2 300 auf 37 400 (-5,9 %). Da die Zahl der Tagesväter nahezu unverändert blieb (-0,2 %), ist der Rückgang fast ausschließlich auf die Tagesmütter zurückzuführen. Der Männeranteil bei den Tagespflegepersonen lag bei 4,5 %.
Methodische Hinweise:
Für die Statistiken der Kinder und tätigen Personen in Kindertageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege sowie in Großtagespflegestellen wurden alle Kinder angegeben, die am Stichtag ein Betreuungsverhältnis hatten, unabhängig davon, ob diese am Stichtag betreut wurden oder nicht. Beim Personal wurden alle Personen berücksichtigt, die am Stichtag in einem gültigen Arbeitsverhältnis tätig waren.
Bei der Betreuungsquote handelt es sich um den Anteil der in Kindertageseinrichtungen (zum Beispiel Kindertagesstätte, Kinderkrippe, Hort) oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege (zum Beispiel öffentlich geförderter Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater) betreuten unter Dreijährigen an allen Kindern dieser Altersgruppe.
Die Betreuungsquote beruht ab dem Berichtsjahr 2025 erstmals auf den Daten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022. Dies führt zu einer neuen Datenbasis im Vergleich zu den Vorjahren, die auf dem Zensus 2011 beruhten. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse und Tabellen auch mit Bundesländer-Ergebnissen bietet die Themenseite „Kindertagesbetreuung“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Basisdaten zur Kindertagesbetreuung in Deutschland sind zudem über die Tabellen Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen (22541), Kinder und tätige Personen in Kindertagespflege (22543) und Personen in Großtagespflegestellen und betreute Kinder (22545) in der Datenbank GENESIS-Online verfügbar.
Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 31.10.2025
INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN
AWO Bundesverband, Klima-Allianz Deutschland, ver.di und WWF Deutschland zu den Haushaltsberatungen: Haushalt 2026: Sondervermögen muss Zukunft sichern, nicht Vergangenheit finanzieren
Anlässlich der Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss am 13. November fordern Klima-Allianz Deutschland, die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der AWO Bundesverband und der WWF Deutschland die Regierungsfraktionen auf, das Sondervermögen gezielt für Zukunftsinvestitionen zu nutzen. Das Bündnis kritisiert, dass der aktuelle Haushaltsentwurf an den Herausforderungen der Zeit vorbeigeht: Milliarden sollen weiter in fossile Projekte fließen, während für Klimaschutz, Busse und Bahnen oder die Sanierung sozialer Einrichtungen das Geld fehlt. Dabei würden Investitionen in diese Bereiche die Wirtschaft, soziale Daseinsvorsorge und Klimaschutz zugleich stärken und das Leben vieler Menschen einfacher und sicherer machen.
Michael Groß, Präsident AWO Bundesverband: „Die soziale Infrastruktur leidet unter einem enormen Sanierungsstau. Tausende Pflegeheime, Kitas und weitere gemeinnützige Einrichtungen verfügen nicht über die notwendigen Mittel, um ihre Gebäude klimaneutral zu sanieren. Eine aktuelle Erhebung der AWO zeigt: Mehr als die Hälfte der Kitas muss energetisch und mit Blick auf den Klimaschutz erneuert werden. Fast 80 Prozent der Kitas heizen mit fossilen Energien; Wärmepumpen und Photovoltaik sind nur vereinzelt im Einsatz. Wenn wir soziale Einrichtungen jetzt modernisieren, schützen wir nicht nur das Klima, sondern auch die Menschen, die dort leben, lernen und arbeiten. Die Bundesregierung muss dringend Mittel aus dem Sondervermögen mobilisieren, um die soziale Infrastruktur zukunftsfest zu machen!“
Stefanie Langkamp, Geschäftsführung Politik, Klima-Allianz Deutschland: „Jetzt entscheidet sich, ob das Sondervermögen wirklich unser Leben und unsere Zukunft verbessert. Die Mittel müssen dorthin fließen, wo sie den größten Nutzen haben: in eine funktionierende, klimafreundliche Infrastruktur, in saubere heimische Energie, verlässliche Busse und Bahnen und in den Schutz der Menschen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Die Menschen in diesem Land erwarten, dass Union und SPD das Sondervermögen dafür nutzen, den Abschied von fossilen Strukturen einzuleiten und die Grundlage für den Wohlstand von morgen zu legen.”
Christine Behle, Stellvertretende Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): „Der ÖPNV geht auf dem Zahnfleisch: Verspätungen, Ausfälle, verschobene Investitionen, Fachkräftemangel. Der Bund darf sich hier nicht wegducken. Genauso wichtig wie auskömmliche Regionalisierungsmittel für den Regionalverkehr ist zusätzliches Geld für die Kommunen, die den Kostenaufwuchs im Nahverkehr nicht mehr allein tragen können, so ist auch eine Erhöhung der Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel (GVFG) auf mind. drei Mrd. € dringend geboten. Die Koalition darf die Kommunen nicht allein lassen, sonst riskiert sie die Funktionsfähigkeit des ÖPNV Damit wird sie ihrem eigenen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nicht gerecht. Jeder Euro, der in Busse, Regionalzüge und Straßenbahnen investiert wird, stärkt die Wirtschaft, schafft gute Arbeitsplätze und bringt die Menschen zuverlässig ans Ziel.“
Viviane Raddatz, Leiterin der Abteilung Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF: „Über das Sondervermögen und den Klima- und Transformationsfonds sollen weiterhin fossile Projekte wie LNG-Terminals, Raffinerien oder Gasinfrastruktur finanziert werden. Das ist klimapolitisch falsch und nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten auch rechtlich fragwürdig. Diese Ausgaben widersprechen dem Ziel der Klimaneutralität, das im Sondervermögen selbst festgeschrieben ist. Statt fossile Strukturen zu stützen, sollte die Bundesregierung gezielt in klimaneutrale Technologien investieren, die Arbeitsplätze sichern und unserer Wirtschaft neue Perspektiven eröffnen. Die Green-Tech-Branche trägt bereits neun Prozent zur inländischen Bruttowertschöpfung bei und verschafft deutschen Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil auf den Weltmärkten.”
Hintergrund:
Kurzgutachten im Auftrag von ver.di und der Klima-Allianz Deutschland zur nachhaltigen Finanzierung des ÖPNV
Aktuelle Daten der AWO zu KITAS
Rechtsgutachten des WWF zum Finanzpaket: Einordnung der Grundgesetzänderungen aus Klimaperspektive
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V., Klima-Allianz Deutschland, ver.di und WWF Deutschland vom 11.11.2025
BDKJ, BVT*, DF, EFiD, LSVD+: Gemeinsames Statement: Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz
Fortschritt mit Einschränkungen
Am 1. November 2024 trat das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft – ein Meilenstein für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen (TIN*) in Deutschland. Es beendete nach Jahrzehnten das diskriminierende “Transsexuellengesetz” (TSG). Zum ersten Mal können Menschen ihren Geschlechtseintrag und Namen selbstbestimmt ändern – ohne pathologisierende Verfahren und entwürdigende Zwangsbegutachtungen. Ein Jahr nach Inkrafttreten zeigt sich jedoch: Das Selbstbestimmungsgesetz ist zwar ein wichtiger Fortschritt, jedoch nicht das Ende der Arbeit für echte Selbstbestimmung.
So ist der Zugang zum Gesetz eingeschränkt: Nur Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit oder unbefristetem bzw. verlängerbarem Aufenthaltstitel können die Regelung nutzen. Hinzu kommen Anmelde- und Sperrfristen, die trans*, intergeschlechtliche und nicht-binären Menschen implizit unterstellen, sich ihrer Entscheidung nicht sicher zu sein. Auch Sonderregelungen im Spannungs- oder Verteidigungsfall zeigen, dass geschlechtliche Selbstbestimmung noch immer nicht bedingungslos anerkannt wird. Echte Gleichberechtigung bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte auf Anerkennung und Würde haben – unabhängig von Herkunft, Pass oder Lebenssituation. Das SBGG war ein notwendiger Schritt, aber kein abschließender. Ein Jahr nach seiner Einführung ist klar: Dieses Gesetz muss weiterentwickelt werden – hin zu einer rechtlichen Realität, die geschlechtliche Vielfalt ohne Einschränkungen respektiert, schützt und stärkt.
Erschwerend kommt hinzu, dass in der politischen Debatte rund um das Gesetz wiederholt ein vermeintlicher Konflikt zwischen Selbstbestimmung und dem Schutz von Frauen und Kindern konstruiert wurde. Diese Narrative haben Eingang in den Gesetzgebungsprozess gefunden, obwohl es in keinem der 16 Länder weltweit, die seit 2012 Selbstbestimmungsgesetze umgesetzt haben, zu entsprechenden systematischen Problemen gekommen ist. Im Koalitionsvertrag wurde festgehalten, das Gesetz verfrüht bis zum 31. Juli 2026 mit Fokus auf Frauen und Kinder zu evaluieren. Diese Schwerpunktsetzung orientiert sich stark an der gesellschaftlich polarisierten Debatte, in der das Selbstbestimmungsgesetz fälschlicherweise als Risiko für Frauen oder Kinder dargestellt wurde. Eine Evaluation muss sich jedoch an den Menschenrechten und Grundfreiheiten orientieren, die dem Gesetz zugrunde liegen, wie auch im Gesetz selbst als Ziel der Evaluierung nach fünf Jahren festgelegt. Nur so kann sie dazu beitragen, bestehende Schwachstellen zu benennen und zukünftige Weiterentwicklungen im Sinne echter Selbstbestimmung zu gestalten.
Zugleich lässt sich nach einem Jahr Selbstbestimmungsgesetz sagen:
- Das Gesetz funktioniert. Die Erfahrungsberichte von Personen, die das Gesetz genutzt haben und auf der Webseite sbgg.info gesammelt wurden, zeigen, dass die Umsetzung in weiten Teilen unbürokratisch, respektvoll und verlässlich verläuft. Menschen, die von der neuen Regelung Gebrauch gemacht haben, berichten von Erleichterung, mehr Sicherheit und einem neuen Gefühl gesellschaftlicher Zugehörigkeit. Die Erfahrungen aus den Communitys und aus Beratungsstellen zeigen: Das Selbstbestimmungsgesetz stärkt das Vertrauen in den Staat, weil es verdeutlicht, dass Grundrechte für alle gelten – nicht nur auf dem Papier, sondern im Alltag.
- Das Gesetz hat sich bewährt. Es trägt zur Entstigmatisierung und gesellschaftlichen Teilhabe bei und ist ein wichtiger Beitrag zu einem modernen, grundrechtsbasierten Staatsverständnis. Die positive Resonanz aus der Praxis spricht für sich.
- Das Selbstbestimmungsgesetz ist Ausdruck einer demokratischen Reife. Es steht für eine Gesellschaft, die Vielfalt nicht nur anerkennt, sondern schützt. In einer lebendigen Demokratie darf es keine Gruppe geben, deren Identität und Würde in Frage gestellt oder staatlich geprüft werden muss. Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht – und in einer freiheitlichen Ordnung selbstverständlich.
Trotz aller Kritik bleibt festzuhalten: Das Selbstbestimmungsgesetz hat einen diskriminierenden Zustand beendet und erstmals gesetzlich den Grundsatz verankert, dass jeder Mensch über den eigenen Geschlechtseintrag nur selbst bestimmen kann. Das Selbstbestimmungsgesetz stärkt damit nicht nur trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen – es stärkt uns alle.
Unterzeichnende Organisationen:
- Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
- Bundesverband Trans*
- Deutscher Frauenrat
- Evangelische Frauen in Deutschland e.V.
- LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt
Zusätzlich erklärt BDKJ-Bundesvorsitzende Daniela Hottenbacher:
“Das SBGG steht für Selbstbestimmung volljähriger Menschen. Echte Selbstbestimmung muss jedoch auch für Kinder und Jugendliche gelten, unabhängig von der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter*innen oder gerichtlicher Entscheidungen.
Darüber hinaus kann das Signal, dass das Selbstbestimmungsgesetz an die Gesellschaft sendet, nur dann zu einer gelungenen demokratischen Zukunft beitragen, wenn alle Menschen in ihrer Identität gesehen und anerkannt werden.“
Weiterlesen:
- Mehr als 22.000 Änderungen des Geschlechtseintrags nach SBGG: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/daten-zur-aenderung-geschlechtseintrag.html
- Statement des Paritätischen Gesamtverbands zu einem Jahr SBGG: https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/selbstbestimmungsgesetz-ein-jahr-in-kraft/
Quelle: Pressemitteilung Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Bundesverband Trans*, Deutscher Frauenrat, Evangelische Frauen in Deutschland e.V. und LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 31.10.2025
DGB: Arbeitsmarktzahlen: Sozialabbau schürt Ängste statt Arbeitsplätze zu schaffen
Mit Blick auf die Arbeitsmarktzahlen sagte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied:
„Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ist mau, die Zahl der Arbeitslosen verharrt knapp unter der Drei-Millionen-Grenze. Mit jeder neuen Meldung über Stellenabbau in der Industrie sorgen sich mehr Menschen um ihren Arbeitsplatz. Die Bundesregierung muss jetzt gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln ohne Menschen zu verunsichern.
Wer für Arbeitslose und Arbeitssuchende Leistungen streichen und das soziale Netz löchriger machen will, tut nichts für Arbeitsplätze, sondern schürt nur Ängste vor dem sozialen Abstieg. Gerade in unsicheren Zeiten müssen Arbeitnehmer*innen sich darauf verlassen können, beim Verlust ihres Jobs gut abgesichert zu sein. Da das Arbeitslosengeld in der Regel nur ein Jahr gezahlt wird, ist das Schutzniveau der Grundsicherung für alle Beschäftigten ein wichtiges Thema.
Deshalb ist es falsch, dass die Bundesregierung den Menschen den Notgroschen abnehmen will, wenn sie Grundsicherung brauchen. Wer sich einen bescheidenden Wohlstand erarbeitet hat, soll nach dem Willen der Union nach sehr kurzer Zeit seine Ersparnisse aufbrauchen. Doch solche Ersparnisse sind oftmals für die Altersvorsorge gedacht, und bitter nötig, wenn die Rente alleine nicht zum Leben reicht. Offensichtlich sollen bei der Union nur große Vermögen geschont werden: Merz will Superreiche weiter bei der Steuer bevorzugen, und dafür Arbeitnehmer*innen, denen längere Arbeitslosigkeit droht, die Ersparnisse wegnehmen.“
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 30.10.2025
DKHW: Kompetenzen für Kinderrechte stärken – Praxisportal kinderrechte.de geht an den Start
Ab sofort stellt das Deutsche Kinderhilfswerk ein umfangreiches Angebot rund um das Thema Kinderrechte gebündelt und kostenlos auf einer Plattform zur Verfügung. Auf dem neuen Praxisportal www.kinderrechte.de finden Fachkräfte aus Kita, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Verwaltung und Justiz ein umfangreiches Wissensangebot, praxisnahe Informationen und Projektimpulse. Ziel des Portals ist es, Fachkräfte dabei zu unterstützen, die Rechte der Kinder stärker in ihren Arbeitsfeldern zu integrieren.
Neben fundierten Wissensangeboten liefern verschiedene Datenbanken Ideen für den Arbeitsalltag, unterstützen die Bildungsarbeit, den fachwissenschaftlichen Austausch sowie die Vernetzung für Workshops, Beratungen und Veranstaltungen. Qualifizierungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten des Deutschen Kinderhilfswerkes bieten zudem praxisnahe Ansätze zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und dienen dazu, eigene Kompetenzen gezielt zu erweitern. Außerdem zeigen zahlreiche Praxisbeispiele, wie Kinderrechte bereits erfolgreich umgesetzt werden. Das Praxisportal wird im Rahmen der Koordinierungsstelle Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfswerkes vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
„Aktuelle Umfragen des Deutschen Kinderhilfswerkes zeigen, dass wir bei der Bekanntheit der Kinderrechte in Deutschland in den letzten Jahren zwar kleine Fortschritte erzielt haben, aber diese sind nicht zufriedenstellend. Wir brauchen daher dringend eine Bildungsoffensive in Sachen Kinderrechte. Mit unserer Kinderseite www.kindersache.de sind wir diesbezüglich bei den Kindern schon sehr gut aufgestellt, mit dem neuen Praxisportal www.kinderrechte.de schaffen wir jetzt auch für die Fachkräfte aus Kita, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Verwaltung und Justiz eine hervorragende Möglichkeit, sich neues Wissen zum Thema Kinderrechte anzueignen, sich mit anderen Interessierten zu vernetzen oder beispielsweise von anderen Initiativen zu lernen“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.
Das neue Praxisportal bietet auch eine Methodendatenbank mit erprobten Ideen und Ansätzen für den Arbeitsalltag sowie eine Expertinnen- und Expertendatenbank, um erfahrene Fachpersonen für Workshops, Beratungen oder Schulungen direkt zu kontaktieren. Es gibt außerdem Einblicke in Förder- und Kooperationsmöglichkeiten mit dem Deutschen Kinderhilfswerk – für alle, die eigene Projekte starten oder weiter vertiefen möchten.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. vom 10.11.2025
eaf: Geplante Grundsicherung droht Kinderarmut zu verschärfen
eaf: Sanktionen für Eltern kürzen faktisch auch Existenzminimum der Kinder
Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) warnt vor negativen Folgen der geplanten Regelungen zur Grundsicherung für Kinder, deren Familien derzeit Bürgergeld beziehen. Sie fordert Bundesregierung und Parlament dazu auf, die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien im weiteren Gesetzgebungsverfahren stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ziel muss es sein, die Lage von Kindern in armen Familien zu verbessern und nicht zu verschlechtern.
„Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses von Anfang Oktober hatten uns in einem wichtigen Punkt sehr positiv gestimmt“, erklärt Bundesgeschäftsführerin Nicole Trieloff. “Die darin vorgesehene Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft und Einführung eines pauschalierten Mehrbedarfs für umgangsberechtigte Elternteile entspricht langjährigen Forderungen der eaf – dies hätte die Situation vieler Trennungskinder deutlich verbessert. Der Blick in den nun vorliegenden Referentenentwurf ist jedoch enttäuschend – beides fehlt komplett darin.“
Statt Verbesserungen drohen laut eaf neue Belastungen. „Wir befürchten, dass Kinder künftig unter den Folgen verschärfter Sanktionsregelungen leiden. Wenn die Leistungen der Eltern gekürzt werden, sinkt das Budget der gesamten Familie – und Kinder trifft das immer mit. Werden zusätzlich die Kosten der Unterkunft gestrichen, droht im schlimmsten Fall Wohnungslosigkeit. Versäumnisse der Eltern – verschuldet oder unverschuldet – sollten nicht zu Lasten der Kinder gehen.
Kritisch bewertet die eaf zudem, dass Eltern künftig bereits ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes verpflichtet werden können, eine Arbeit aufzunehmen oder an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilzunehmen. „Es ist gut, Eltern frühzeitig zu beraten und sie beim Wiedereinstieg zu unterstützen“, betont die Bundesgeschäftsführerin. „Der Zeitpunkt sollte jedoch mit Blick auf das Wohl und die Entwicklung des Kindes gewählt werden – nicht allein nach arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben.“
Quelle: Pressemitteilung evangelische arbeitsgemeinschaft familie e.V. (eaf) vom 04.11.2025
nak: Menschen mit Armutserfahrung fordern Respekt, Sicherheit und Schutz vor psychischer Gefährdung
Menschen aus ganz Deutschland kommen zum Treffen der Menschen mit Armutserfahrung in Berlin zusammen, um sich für ihre Rechte einzusetzen. Themen der dreitägigen Veranstaltung sind unter anderem der Schutz vor psychischer Gefährdung, eine zuverlässige Grundsicherung, ein sozialer Notfallmechanismus für gesellschaftliche Krisen, Kinder- und Jugendarmut und die Gewährleistung einer gesunden Ernährung.
Alex Embs berichtet: „Für mich stellt sich die Frage: Arm durch Krankheit oder krank durch Arbeit. Ich selbst bin aufgrund einer psychischen Erkrankung in die Armutsspirale geraten, Ich verbringe relativ viel Zeit damit, mich durch die Bürokratie zu kämpfen und extrem lange Bearbeitungszeiten kommen dazu.“
Sie kritisiert: „Die psychiatrische Gesundheitsversorgung ist leider nicht bundeseinheitlich geregelt. Anlaufstellen in psychischen Krisen gibt es kaum oder sie sind in Krisenzeiten nicht erreichbar. Die Warteliste für einen Psychotherapieplatz sind zum Teil über 12 Monate und viele Therapeuten haben noch nicht mal mehr eine Warteliste. Das ist sehr belastend. Wir fordern anonym nutzbare, niedrigschwellige und zielgruppenspezifische Beratungs- und Therapieangebote, die rund um die Uhr und kostenfrei für Ratsuchende nutzbar sein müssen.“ Zudem müssten Informationen zu suizidpräventiven Angeboten einfach und übersichtlich zur Verfügung stehen. Hilfe in psychischen Krisen sollte so einfach zu bekommen sein, wie ein Friseurbesuch.
„Psychische Erkrankungen und Belastungen kommen mit Armut zusammen. Das Kontroll-System der Jobcenter ist für viele Menschen schwer auszuhalten“, mahnt Alex Embs. Darum werde die gegenwärtige Sanktionsdebatte den Menschen überhaupt nicht gerecht. „Die Diskriminierung von Menschen mit psychischer Behinderung darf in der Politik keinen Platz haben!“ stellt Embs fest. Wirksame Hilfen fehlen: „Wartezeiten von 12 Monaten sind nicht auszuhalten. Der Zugang zu Psychotherapie muss so einfach wie ein Friseurbesuch werden!“
Manja Starke sorgt sich um die Menschen, die aufgrund von Sanktionen ihre Wohnungen verlieren: „Bisher haben einige Vermieter gerne Mieter mit Leistungsbezug gehabt, da damit die Miete gesichert war. Denn selbst wenn es eine Kürzung der Leistungen gab, blieb die Miete bisher davon weitgehendst unberührt. Die geplanten Änderungen führen aber dazu, dass die Miete eben nicht mehr sicher ist. Und das betrifft vor allem auch Menschen, die eh schon Probleme haben, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen.“ Darum müssten die Kosten der Unterkunft immer sicher sein.
Yvonne S. erlebt, wie existenzbedrohlich knappe Hilfen sind: „Der Bürgergeldsatz sieht 2 Euro im Monat für Bildung vor. Aber wo und wie kann man sich mit 2 Euro bilden? Nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind pro Tag 10 Euro für ein gesunde Ernährung nötig. Der Regelsatz in der Grundsicherung sieht dafür nur 6,50 Euro für alleinstehende Erwachsene vor – Kinder und leistungsberechtigte Personen in einer Bedarfsgemeinschaft bekommen noch weniger. Und: Kinder haben zwei Eltern. Es ist aber nicht dafür gesorgt, dass nach Trennungen an beiden Lebensorten des Kindes das Nötige finanziert wird. Außerdem möchte ich echte Chancengleichheit und Teilhabe für alle Kinder und Jugendliche.“
Auch Jobcenter sollten gefordert und in die Pflicht genommen und Rentenansprüche nicht einfach voll auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden, so die Organisationsgruppe des Treffens: „Wir fordern: Fördern first!“ so die politische Erklärung zum Treffen.
Quelle: Pressemitteilung Nationale Armutskonferenz (nak) vom 06.11.2025
VBM: Fürsorge darf kein Nachteil sein – VBM fordert: Fürsorge-Verantwortung als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz!
Fürsorge darf kein Nachteil sein – VBM fordert: Fürsorge-Verantwortung als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz!
Der Verband berufstätiger Mütter e. V. (VBM) wurde 1990 in Köln am sprichwörtlichen Küchentisch gegründet — aus einer klaren Haltung heraus:
„Unsere Gründungsfrauen waren es leid, dass bestqualifizierte, erwerbsfähige und erwerbswillige Frauen — berufstätige Mütter — ihre Karriereambitionen und Erwerbsarbeit als Mütter nur dann verwirklichen konnten, wenn private Aushandlungsprozesse dies erfolgreich zuließen.“ Cornelia Spachtholz, Vorstandsvorsitzende Verband berufstätiger Mütter e. V. (VBM) und Initiatorin Equal Pension Day
Daran hat sich bis heute wenig geändert. Wer unbezahlte Sorgearbeit leistet – ob für Kinder, Angehörige oder die Gesellschaft –, wird strukturell und kulturell benachteiligt, wenn es um gleiche Chancen, Einkommen und Anerkennung geht.
Deshalb unterstützt der VBM ausdrücklich den Vorstoß der LUA-Carewerkschaft, die mit ihrer Petition „Diskriminierung stoppen – Care ins Grundgesetz!“ fordert, „Fürsorgeverantwortung“ als Diskriminierungsmerkmal in Artikel 3 des Grundgesetzes zu verankern.
„Diese Forderung greift ein zentrales Anliegen des VBM auf, dass der Verband seit seiner Gründung im Jahr 1990 immer wieder formuliert:
Fürsorge darf nicht benachteiligen — sie ist der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält, allerdings bisher uns Frauen und Mütter karriere- und einkommensperspektivisch im Nacken sitzt mit dem Bumerang der Altersarmut, während sie gleichzeitig den Rücken der Männer stärkt.“ Cornelia Spachtholz, VBM e. V.
„Sandra Runge hat bereits während der Pandemie mit #ProParents einen wichtigen Impuls gesetzt, um sichtbar zu machen, dass Fürsorgeverantwortung auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) berücksichtigt werden muss.
Dies haben wir als VBM von Beginn an unterstützt – und zugleich betont: Das AGG reicht nicht aus. Wir müssen an den Kern, an das Grundgesetz selbst.
Unser Dank gilt daher auch Jo Lücke, Franzi Helms und dem gesamten Team der LUA-Carewerkschaft für ihr Engagement.
Auch diese Initiative zeigt, wie stark zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit sein kann und dass wir im Schulterschluss gemeinsam dafür kämpfen müssen, dass unbezahlte Care-Arbeit endlich den Stellenwert erhält, den sie verdient.“ Cornelia Spachtholz, VBM e. V.
„Als Psychologin, Erzieherin und Mutter weiß ich, wie sehr Fürsorgearbeit unsere mentale Gesundheit, unser Selbstbild und unsere gesellschaftliche Teilhabe prägt.
Care-Arbeit ist Beziehungspflege, emotionale Intelligenz und gesellschaftliches Rückgrat in einem.
Es ist höchste Zeit, dass diese Verantwortung rechtlich anerkannt und vor Diskriminierung geschützt wird.
Wer Fürsorge trägt, trägt unsere Gesellschaft und verdient dafür Respekt, nicht Benachteiligung.“ Sanata Doumbia-Milkereit, Vorständin VBM e. V.
Hashtags: #Fürsorge #Care #CareArbeit #unbezahlteCarearbeit #Diskriminierungsmermal #Diskriminierung #Familienpolitik #Grundgesetz #Mütter #Frauen #Vereinbarkeit #Erwerbsarbeit #Karriere #Einkommen #Rente #Petition #BerufUndFamilie #Gleichberechtigung #Gleichstellung
Quelle: Pressemitteilung Verband berufstätiger Mütter e.V. (VBM) vom 10.11.2025
VBM-Statement zur geplanten Sonderregelung Verkürzung der Elternzeit im Grundsicherungsbezug
„Eltern erster und zweiter Klasse? – Zeit für echte Gleichstellung!“
Die geplante Verkürzung der Elternzeit im Bürgergeldbezug schafft weitere soziale Ungleichheit. Der VBM fordert: Keine Benachteiligung von Eltern durch Armut, Herkunft oder Wohnort – sondern gleiche Rechte, gleiche Chancen! Zeit für ein Elternschutzgesetz und Fürsorge als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz!
Die Bundesregierung plant die Elternzeit für Eltern im Bürgergeldbezug auf ein Jahr zu verkürzen. Was auf den ersten Blick als klares Signal für schnelleren Weg in die Erwerbstätigkeit aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Diskriminierung auf sozialer Ebene und auch als Gefahr „Eltern in erste und zweite Klasse“ einzuteilen.
Keine Eltern zweiter Klasse!
„Eine Mutter im Bürgergeldbezug darf keine Schlechterstellung ihrer Elternzeitwahl haben! Wir dürfen Eltern nicht in Eltern erster Klasse und Eltern zweiter Klasse stigmatisieren und diskriminieren, indem wir sie nicht mit gleichwertigen Elternrechten ausstatten! Ein weiterer Anlass ein Elternschutzgesetz zu fordern – und Fürsorgeleistung als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz aufzunehmen!“ Cornelia Spachtholz, Vorstandsvorsitzende Verband berufstätiger Mütter e.V. (VBM).
Der VBM positioniert sich damit klar gegen die geplante Verkürzung der Elternzeit im Bürgergeldbezug und fordert stattdessen Rechtssicherheit, Wahlfreiheit und Gleichstellung aller Eltern – unabhängig vom sozialen Status oder Herkunft.
Elternzeit? So kurz wie möglich und so lange wie nötig!
Natürlich steht der Verband berufstätiger Mütter e.V. (VBM) seit jeher für das Motto:
„Elternzeit so kurz wie möglich und so lange wie nötig – am besten kombiniert mit Teilzeit oder Weiterbildung.“
Denn ein längerer Ausstieg aus dem Erwerbsleben benachteiligt insbesondere Mütter nachhaltig in Karriere, Einkommen und Rente.
Aber: Wenn politische Maßnahmen soziale Unterschiede verschärfen und Elternrechte beschneiden, ist eine Grenze überschritten!
„Es darf nicht sein, dass Eltern, die ohnehin mit finanziellen Einschränkungen leben, zusätzlich mit rechtlichen Benachteiligungen belastet werden.“ Cornelia Spachtholz, VBM e.V.
Ungleiche Bedingungen durch fehlende Infrastruktur
Gut ist, dass der Referentenentwurf zumindest berücksichtigt, dass Betreuungsplätze fehlen:
Laut DIW mangelt es bereits im Jahr 2024 an rund 300.000 Kitaplätzen für unter Dreijährige. Das ist ein strukturelles Defizit, das seit Jahren absehbar war und bekannt ist!
Doch das führt zu einem absurden Ergebnis:
- In Regionen ohne ausreichende Betreuungsplätze dürfen Eltern länger Elternzeit nehmen.
- In Regionen mit bedarfsgerechter ausreichender Betreuungsinfrastruktur wird Elternzeit auf ein Jahr verkürzt!
„Das ist keine Gleichstellung, sondern Standortlotterie!“ sind sich die VBM-Vorstandsfrauen einig.
Wahlfreiheit braucht Struktur und gleiche Lebensverhältnisse
„Wir brauchen Strukturen, die die gleichwertige Wahlfreiheit des Lebensmodells und gleichwertige Lebensverhältnisse ermöglichen – unabhängig von Herkunft, Familienkonstellation, Arbeitssituation und Familienstandort!“ fordert Spachtholz.
Denn jedes Kind entwickelt sich individuell. Und jedes Kind braucht Zeit, um Vertrauen zu neuen Bezugspersonen außerhalb der Familie aufzubauen. Auch das Kindswohl muss in der Gesetzgebung berücksichtigt werden!
„Selbstverständlich muss auch weiterhin gelten: Eine Mutter darf ihr Kind so lange stillen, wie es für Mutter und Kind erforderlich ist.“ – Cornelia Spachtholz, VBM e.V.
Politik, die keine Elterngruppen gegeneinander ausspielen
Unterm Strich bleibt:
Unsere politischen Entscheidungsträger:innen dürfen nicht eine Elterngruppe gegen die andere ausspielen, indem sie Gesetze verschärfen, die soziale Spaltungen vertiefen.
Stattdessen braucht es:
- Gleichwertige Elternrechte, unabhängig vom Einkommen
- Verlässliche Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur
- Und die rechtliche Anerkennung von (unbezahlter) Fürsorgearbeit als gesellschaftlich wertvolle Leistung
„Elternzeitverkürzung mit diskriminierender Klassifizierung in Eltern erster und zweiter Klasse, nein – aber qualitativer und quantitativer Ausbau der Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur, unbedingt!“ fordert Spachtholz.
Unser Fazit:
Eltern sollen wählen dürfen und nicht kämpfen müssen.
Die geplante Regelung zeigt, wie dringend Deutschland ein Elternschutzgesetz braucht, das soziale und gleichstellungsorientierte Gerechtigkeit, Wahlfreiheit und das Kindswohl gleichermaßen schützt.
Fürsorge ist keine Schwäche, sondern eine Stärke – und sie gehört ins Grundgesetz!
Quelle: Pressemitteilung Verband berufstätiger Mütter e.V. (VBM) vom 31.10.2025
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
SoVD, Volkssolidarität und VdK: Online Veranstaltung "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Lebensrealitäten und Reformbedarfe"
Termin: 19. November 2025
Veranstalter: SoVD, VdK und Volkssolidarität
Ort: Online
Im Fokus der Veranstaltung stehen die Fragen: „Wird die Grundsicherung den Lebensrealitäten der Menschen gerecht?“ und „Welche Reformen sind notwendig, damit die Grundsicherung auch wirklich alle Hilfebedürftigen erreicht?“.
Es wirken mit:
- Margret Böwe (Sozialverband VdK Deutschland e.V., Referentin für Armut und Grundsicherung)
- Rose Lang (Verdi-Sprecherin Erwerbslosenausschuss Rhein Neckar)
- Dr. Armin Grau (MdB, Fraktion Die Grünen, Sprecher für Arbeit und Soziales).
- Meral Ökten (Armutsaktivistin)
- Michael Popp (Sozialverband VdK Deutschland e.V., Referent für Alterssicherung)
- Dr. Julia Simonson (Deutsches Zentrum für Altersfragen, kommissarische Institutsleiterin)
- Sarah Vollath (MdB, Fraktion Die Linke, Sprecherin für Renten- und Alterssicherungspolitik)
- Holger Weidauer (Volkssolidarität Bundesverband e.V., Referent für Sozialpolitik)
- Anna Wyduba (Sozialverband Deutschland e.V., Referentin für Sozialpolitik)
Die Veranstaltung richtet sich an fachlich Interessierte und ist kostenfrei.
Bitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an. Die Zugangsdaten für Zoom erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung.
FES: Rechte Frauen: Charisma, Klicks, Triumph?
Termin: 20. November 2025
Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung
Ort: Berlin
Immer häufiger prägen Frauen die Führung und Außenwirkung rechter Parteien in Europa. Aber ist das „weibliche Antlitz“ des Rechtspopulismus oder -extremismus auch eine Triebkraft für die Wähler:innenwanderung aus der Mitte nach rechts? Und was steht auf dem Spiel, wenn es um Frauenrechte geht?
Ein neuer Film und eine Studie beleuchten diese Phänomene – und wir präsentieren beide in einem gemeinsamen Launch-Event.
Eine aktuelle Studie der Reihe „Triumph der Frauen?“ der Friedrich-Ebert-Stiftung analysiert, wie Charisma, Rollenbilder und Social-Media-Strategien weiblicher Führungspersonen, insbesondere der Spitzenpolitiker*innen Giorgia Meloni, Marine Le Pen und Alice Weidel zusammenwirken – und welche Folgen das für Gleichstellung und Demokratie hat.
Zum Launch zeigen wir den ZDF-Film „Rechte Frauen – Weiblich, national, radikal“ – eine Dokumentation über politische Täuschung, emotionale Rhetorik und das gefährlich moderne Comeback alter Ideologien.
Anschließend sprechen wir mit der Regisseurin Nicola Graef, einer Autorin der Studie sowie weiteren spannenden Gästen über eine historische und faktenbasierte Einordnung sowie demokratische Gegenstrategien.
Das Programm der Einladung finden Sie hier.
BFM Impulse: New Work Men – Welche Männlichkeitsbilder braucht moderne Arbeit?
Termin: 25. November 2025
Veranstalter: Bundesforum Männer e.V.
Ort: Online
Wir stecken mitten im Wandel: Arbeit, Leben, Männlichkeit – vieles wird neu gedacht.
Mit „New Work Men“ haben sich Jacomo Fritzsche und Daniel Pauw mit dem Wandel in der Arbeitswelt befasst: Wie können Männer in der modernen Arbeitswelt ihre Rolle anders gestalten, alte Muster hinterfragen und neue Formen von Führung, Kooperation und Selbstführung entdecken? Auf der Grundlage dieser Analyse haben die beiden ein Trainingsprogramm entwickelt, um Kompetenzen wie Selbstreflexion, mentale Gesundheit und kollaboratives Handeln gezielt zu stärken.
In dieser Ausgabe von BFM Impulse gehen beide Autoren mit uns auf Spurensuche: Wo stecken Männer in alten Arbeitsmustern fest? Welche neuen Impulse brauchen sie – beruflich und persönlich? Und was muss sich in der Arbeitswelt verändern, damit neue Wege möglich werden?
Willkommen zu einem Austausch über Arbeit, Männlichkeit und Zukunft.
In unserer digitalen Veranstaltungsreihe BFM Impulse kommen in unregelmäßigen Abständen Menschen zu Wort, die sich mit unterschiedlichen Aspekten einer gleichstellungsorientierten Männerpolitik beschäftigen – sei es als Autor:in, Journalist:in, Künstler:in oder Wissenschaftler:in.
Der Paritätische: Orange Days aus der Inforeihe Kinder, Jugend und Familie
Termin: 25. November – 10. Dezember 2025
Veranstalter: Der Paritätische Gesamtverband
Ort: Online
Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Auch in Deutschland ist Gewalt gegen Frauen ein massives Problem. Die polizeilich erfassten Fälle stiegen in den vergangenen Jahren weiter an.
Der Paritätische möchte den Tag zum Anlass nehmen, um zu zeigen, dass Gewalt gegen Frauen alle angeht. In seinen Strukturen befinden sich 141 Frauenhäuser und 196 Frauenberatungsstellen. Besonders häusliche Gewalt ist alles andere als eine Seltenheit. Frauen, Kinder und Jugendliche sind die Hauptbetroffenen.
Seit 1991 macht die UN-Kampagne „Orange the World“ auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Sie erstreckt sich vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Der Paritätische Gesamtverband möchte die sogenannten „Orange Days“ nutzen, um das Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt insgesamt noch stärker in den Fokus zu rücken. Insbesondere soll auch die Situation der (mit)betroffenen Kinder und Jugendlichen beleuchtet werden.
Verantwortlich für inhaltliche Rückfragen:
Katrin Frank, Referentin Familienhilfe/-politik, Frauen / Frühe Hilfen
Der Paritätische Gesamtverband, Tel.: 030 24636-465, E-Mail: faf@paritaet.org.
Verantwortlich für die Veranstaltungsorganisation:
Stefanie Sachse, Sachbearbeitung Referat Familienhilfe/-politik, Frauen / Frühe Hilfen
Der Paritätische Gesamtverband, Tel.: 030 24636-323, E-Mail: stefanie.sachse@paritaet.org
Der Paritätische: Inforeihe Kinder, Jugend und Familie - Gefühle sind für alle da: Folgen geschlechtsspezifischer Gefühlserziehung und wie wir ihr begegnen können
Termin: 16. Dezember 2025
Veranstalter: Der Paritätische Gesamtverband
Ort: Online
Schon früh lernen Kinder, welche Gefühle sie zeigen dürfen und welche besser nicht. Jungen* sollen mutig sein, Mädchen* empathisch – beides engt ein.
Geschlechtsspezifische Gefühlserziehung prägt, wie Kinder sich selbst und andere wahrnehmen, wie sie Beziehungen gestalten und mit Herausforderungen umgehen und wie und ob sie lernen dürfen, gesunde und sozialverträgliche Ausdrucksformen für ihr Empfinden zu finden oder nicht.
In einem Online-Vortrag beleuchtet Susanne Mierau, Diplom-Pädagogin, Familienbegleiterin und Autorin, wie diese Prägungen entstehen, gibt Anregungen zur Reflexion und lädt ein, über die Folgen von Rollenstereotypen nachzudenken und eine gefühlsoffene Erziehung zu gestalten.
Diese Punkte möchten wir gern im Nachgang des Vortrags mit Ihnen diskutieren.
Mit
Susanne Mierau, Diplom-Pädagogin, Familienbegleiterin und Autorin / Institut für Bindungsbegleitung | Geborgen Wachsen
Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Für die Teilnahme an der Fachveranstaltung werden keine Beiträge erhoben.
Verantwortlich für inhaltliche Fragen
Borris Diederichs, Referent Kinder- und Jugendhilfe
jugendhilfe(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 328
Verantwortlich für organisatorische Fragen
Sabine Haseloff, Sachbearbeitung Referat Kinder- und Jugendhilfe
jugendhilfe(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 327
Der Paritätische: Inforeihe Kinder, Jugend und Familie "Frühe Hilfen und Kindertagesstätten – Kooperation im Aufwachsen“
Termin: 17. Dezember 2025
Veranstalter: Der Paritätische Gesamtverband
Ort: Online
Welche Gemeinsamkeiten von Frühen Hilfen und Kindertagesstätten prägt die Unterstützung und Förderung von Kindern unter drei Jahren und deren Eltern? Inwieweit taugt der frühkindliche Bildungsbegriff als programmatische Klammer für eine interinstitutionelle und multiprofessionelle Kooperation? Wie gestaltet sich die konkrete Umsetzung der Kooperation? Welche Perspektiven ergeben sich daraus? – In einer partizipativ angelegten Infoveranstaltung sollen aus den Frühen Hilfen heraus Anknüpfungspunkte zu den Kindertagesstätten analysiert und vor dem Hintergrund aktueller politischer Entwicklungen diskutiert werden.
An der Veranstaltung wirkt mit:
Prof. Dr. phil. Jörg Fischer, stellvertret. Vorsitzender des Beirats der Bundesstiftung Frühe Hilfen und des NZFH
Für die Teilnahme an der Fachveranstaltung werden keine Beiträge erhoben.
Verantwortlich für inhaltliche Rückfragen:
Katrin Frank, Referentin Familienhilfe/-politik, Frauen / Frühe Hilfen
Der Paritätische Gesamtverband, Tel.: 030 24636-465, E-Mail: faf@paritaet.org.
Verantwortlich für die Veranstaltungsorganisation:
Stefanie Sachse, Sachbearbeitung Referat Familienhilfe/-politik, Frauen / Frühe Hilfen
Der Paritätische Gesamtverband, Tel.: 030 24636-323, E-Mail: stefanie.sachse@paritaet.org