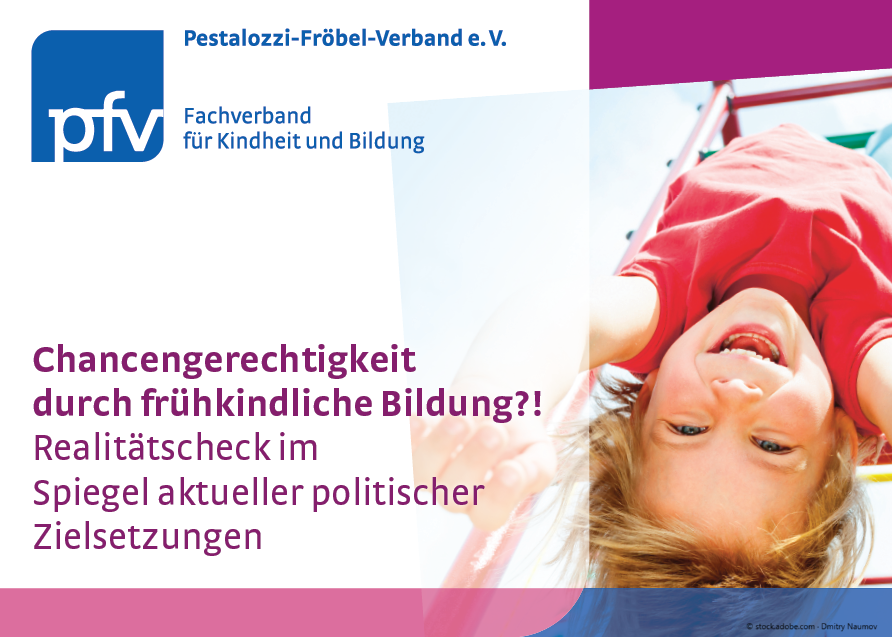AUS DEM ZFF
Neues Dossier erschienen: „Mit Sicherheit – nicht?“
Mit dem neuen Dossier lädt das Gunda-Werner-Institut dazu ein, „Sicherheit“ grundlegend neu zu definieren: nicht als exklusiven Schutz für wenige, sondern als Grundrecht für alle — besonders für Menschen, die durch Armut, Gewalt oder Ausgrenzung verunsichert sind.
Unsere ZFF-Geschäftsführerin, Sophie Schwab, setzt in ihrem aktuellen Beitrag für das Dossier „Deutschland: Fürsorge statt Festungen“ ein klares Zeichen: Sicherheit darf nicht allein an Waffen, Grenzen oder Kontrolle geknüpft werden. Sie plädiert dafür, den Blick zu öffnen — über Migrations-, Außen- und klassische Sicherheitspolitik hinaus — hin zu einer Sicherheit, die auf Beziehung, Fürsorge und dem Wissen basiert: Ich bin nicht allein.
Wer sicher leben will, braucht Zugang zu Wohnraum, Bildung und Gesundheitsversorgung, Schutz vor Gewalt und Diskriminierung sowie die Möglichkeit, für andere zu sorgen, ohne selbst zu fallen. Sicherheit bedeutet deshalb auch: Zeit, Geld und Infrastruktur.
Mit Sicherheit – nicht? | Gunda-Werner-Institut | Heinrich-Böll-Stiftung
Unabhängiger Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Die Pflege eines Angehörigen kostet Zeit und Kraft. Wie lässt sich eine verantwortungsvolle Pflege mit dem Beruf verbinden? Der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wurde eingesetzt, um Lösungen dafür zu erarbeiten.
Unsere ZFF-Geschäftsführerin, Sophie Schwab, wurde zur Neubesetzung des Beirats für die Vereinbarkeit Pflege und Beruf als Mitglied berufen.
Weitere Informationen zum Beirat finden Sie hier.
Podcastfolge Feminismus mit Vorsatz x GWI zu reproduktiver Gerechtigkeit
Die dritte und letzte Folge der Trilogie über reproduktive Gerechtigkeit widmet sich der Frage, unter welchen Bedingungen Kinder in Deutschland tatsächlich würdevoll großgezogen werden können.
U.a. mit Sophie Schwab, ZFF-Geschäftsführerin, richtet die Folge den Blick auf die tief verwurzelte soziale Schieflage. Zugleich entwirft sie eine Vision davon, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die die Rechte von Kindern wirklich ernst nimmt und Familien solidarisch unterstützt.
Hier reinhören: Folge 51 | Was Familien wirklich brauchen – und was ihnen fehlt | Feminismus mit Vorsatz Podcast
SGB-II-Reform gefährdet Familien: Verbände fordern Nachbesserungen

Mit einem gemeinsamen Appell wenden sich die Liga für unbezahlte Arbeit e. V. (LUA), der Deutsche Juristinnenbund e. V. (djb), das Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF), der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) und die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) an die Bundesregierung. Die Verbände fordern, dass die geplante Reform des SGB-II die besondere Situation von Menschen mit Fürsorgeverantwortung angemessen berücksichtigt. „Eine nachhaltige Erwerbsintegration braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Wer Kinder betreut oder Angehörige pflegt, kann nicht unter Sanktionsdruck in den Arbeitsmarkt gezwungen werden, wenn die strukturellen Voraussetzungen fehlen“, so die gemeinsame Position.
Betreuungsinfrastruktur fehlt
Bundesweit fehlen rund 430.000 Kita-Plätze. Öffnungszeiten decken häufig nicht die Arbeitszeiten ab, Ferienbetreuung ist vielerorts nicht verfügbar. Ohne gesicherte, verlässliche, qualitativ hochwertige Betreuungsinfrastruktur kann jedoch eine Erwerbsaufnahme nicht nachhaltig gelingen. Die strukturellen Defizite dürfen nicht auf einzelne Sorgeverantwortliche abgewälzt werden. Genau das sieht jedoch der Entwurf mit der Verschärfung der Zumutbarkeitsregelungen vor, wenn Eltern schon ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen.
Qualifizierung muss Vorrang haben
Die Verbände sind sich einig: Qualifizierungsmaßnahmen müssen klar Vorrang vor kurzfristiger Vermittlung in eine beliebige Beschäftigung haben. „Nur so entstehen Perspektiven auf eine stabile, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die die eigenständige Existenzsicherung von Frauen langfristig sichert und sie vor Dequalifizierung schützt“, betont eaf-Bundesgeschäftsführerin Nicole Trieloff.
Sanktionen gefährden ganze Familien
Besonders kritisch sehen die Verbände die geplanten Sanktionsverschärfungen. Kürzungen von 30 Prozent bis zum vollständigen Entzug des Regelbedarfs treffen nicht nur die sanktionierten Personen, sondern faktisch auch ihre Kinder und ggf. Partner*innen. „Das gefährdet die Existenzsicherung ganzer Familien. Damit verfehlt der Sozialstaat seinen Schutzauftrag – und die Gleichberechtigung der Mütter kommt zu kurz“, warnt Prof. Dr. Susanne Baer, Präsidentin des djb. „Kinder und Jugendliche leiden damit unmittelbar, wenn weniger für gesundes Essen oder den Wintermantel bleibt. Sollten zusätzlich auch noch Unterkunftskosten begrenzt werden, geraten auch Schutzräume ins Wanken, die eigentlich Sicherheit, Nähe und Entwicklung ermöglichen sollten „, ergänzt Britta Altenkamp, Vorsitzende des ZFF.
Der neue § 32a sieht vor, dass nach drei verpassten Meldeterminen der gesamte Regelbedarf entfällt. Zwar sind Ausnahmen denkbar, etwa wenn ein Kind krank ist, die Kita geschlossen bleibt oder ein Pflegenotfall eintritt. Die Nachweispflicht liegt jedoch bei den Betroffenen und ist schwer zu erfüllen. „Besonders Alleinerziehende und Paare mit mehreren Kindern sind aufgrund ihrer Care-Verantwortung armutsgefährdet. Der Referentenentwurf trägt dieser Realität nicht Rechnung – im Gegenteil: Er verschärft die Situation durch unrealistische Anforderungen und existenzgefährdende Sanktionen“, kritisiert Jo Lücke, Vorsitzende der Liga für unbezahlte Arbeit.
Umgangsmehrbedarf
Zurzeit wird der Regelbedarf eines Kindes im Haushalt von Alleinerziehenden für Umgangstage gekürzt und an den anderen Elternteil im Bürgergeld-Bezug gezahlt. Dies verursacht hohen bürokratischen Aufwand für Eltern und Behörden, der mit einem Umgangsmehrbedarf vermieden wird. „Je mehr ein Kind in zwei Haushalten lebt, desto höher sind die Kosten. Zusätzliche Kosten werden aber nicht eingespart. Wir fordern einen Umgangsmehrbedarf, damit der mitbetreuende Elternteil das Kind versorgen kann, während im Haushalt des alleinerziehenden Elternteils nicht gekürzt wird“, betont Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des VAMV. Für das Reformpaket hatte der Koalitionsausschuss einen Umgangsmehrbedarf vorgesehen. Dieses Versprechen muss jetzt eingelöst werden.
Die Verbände fordern:
- Gesicherte Betreuungsinfrastruktur als Voraussetzung für Erwerbsaufnahme – nicht nur auf dem Papier, sondern real verfügbar und mit Arbeitszeiten vereinbar
- Vorrang von Qualifizierung vor kurzfristiger Vermittlung für nachhaltige Erwerbsintegration und Vermeidung von Dequalifizierung
- Keine Gefährdung von Familien durch Sanktionen
- Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft und Einführung eines Umgangsmehrbedarfs für Trennungsfamilien
Über die Verbände:
Liga für unbezahlte Arbeit (LUA) e. V. ist die gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung für alle familiär Care-Arbeitenden in Deutschland. Sie setzt sich für die rechtliche Absicherung und gesellschaftliche Aufwertung von Care-Arbeit ein. Mehr unter www.lua-carewerkschaft.de
Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb) ist ein Zusammenschluss von Juristinnen, Volkswirtinnen und Betriebswirtinnen, der sich für die Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und die Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Mehr unter www.djb.de
Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF) ist ein familienpolitischer Fachverband, der sich für eine solidarische und vielfaltsorientierte Familienpolitik einsetzt. Mehr unter www.zukunftsforum-familie.de
Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) vertritt seit 1967 die Interessen von Einelternfamilien in Deutschland und setzt sich dafür ein, diese als gleichberechtigte Familienform anzuerkennen und entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Mehr unter www.vamv.de
evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der die Bedeutung und die Leistungen von Familien sichtbar macht, indem er sich für ihre Bedürfnisse und gesellschaftlichen Anliegen in Politik, Gesellschaft und Kirche engagiert. Mehr unter www.eaf-bund.de
Die vollständigen Stellungnahmen stehen zum Download bereit unter:
Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 08.12.2025
Das ZFF fordert eine umfassende Reform des Abstammungsrechts statt Inselreförmchen
Anlässlich der heutigen ersten Lesung des Gesetzes zur Reform der Vaterschaftsanfechtung warnt das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) vor erheblichen Schwächen der geplanten Regelungen.
Britta Altenkamp, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF), betont: „Wir brauchen jetzt kein Inselreförmchen, sondern eine grundlegende, kohärente Reform des gesamten Abstammungsrechts. Es ist an der Zeit für eine Reform, die alle Kinder unterstütz. Das bedeutet soziale Elternschaft im Sinne des Kindeswohl ausdrücklich zu stärken, statt biologische Abstammung noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Außerdem heißt es, die Vielfalt moderner Familien rechtlich abzusichern – insbesondere in queeren Familienkonstellationen und Patchworkfamilien mit der Möglichkeit einer einvernehmlichen Mehrelternschaft und der rechtlichen Gleichstellung von Zwei-Mütter-Familien. Zudem muss Diskriminierungs- und Gewaltschutz im Abstammungsrecht konsequent mitgedacht werden. Der vorliegende Entwurf schafft hingegen neue Unsicherheiten – gerade dort, wo Kinder Stabilität am dringendsten brauchen: in der Familie.
Aus unserer Sicht werden die geplanten Regelungen Konfliktsituationen, insbesondere bei Trennungen oder bestehender Gewalt, verschärfen. Sozial-familiäre Beziehungen zu rechtlichen Vätern werden abgewertet, verlässliche Bindungen destabilisiert und verfassungsrechtliche Spielräume für Vielfalt nicht genutzt.
Wir lehnen den Gesetzentwurf daher in seiner aktuellen Form ab, auch wenn an einigen Stellen durchaus richtige Impulse zu finden sind. Wir rufen die Parlamentarier*innen aller demokratischer Parteien dazu auf, sich im weiteren Verfahren für Verbesserungen im Sinne der Vielfalt von Familie einzusetzen.“
Zum Hintergrund:
Der Gesetzesentwurf reagiert auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Rechten leiblicher Väter. Im gleichen Urteil wies das Gericht auch auf die Möglichkeit hin, rechtliche Mehrelternschaft zu etablieren – diese Möglichkeit wird hier allerdings nicht ausgeschöpft. Das ZFF nahm bereits zum Referent*innenentwurf ausführlich Stellung.
Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 04.12.2025
ZFF beim Austausch mit Bundesministerin Prien

Karin Prien im Austausch mit Familienverbänden
Am 2. Dezember war die ZFF-Geschäftsführerin Sophie Schwab zu Gast bei Bundesministerin Karin Prien. Das ZFF brachte in das Gespräch insbesondere drei zentrale Anliegen ein: die Situation pflegender Familien, die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen sowie den dringenden Bedarf an verlässlicher Kinderbetreuung. Wir bedanken uns für den konstruktiven Austausch und freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit.
Quelle: Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Neue Grundsicherung: Geplante Reform lässt Familien und Kinder im Stich!
Die Bundesregierung begründet ihren Referent*innenentwurf für die geplante Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit veränderten wirtschaftlichen und strukturellen Bedingungen. Gleichzeitig sollen Haushaltsmittel eingespart und Kontrollmechanismen im SGB II ausgeweitet werden. Das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) kritisiert den Entwurf deutlich, weil darin zentrale Prinzipien des Sozialstaats infrage gestellt werden. Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum dürfe nicht durch Sanktionsmechanismen relativiert werden.
Britta Altenkamp, Vorsitzende des ZFF, betont: „Der Sozialstaat hat die Aufgabe, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu schützen und ihnen Perspektiven zu eröffnen – nicht sie durch Sanktionen unter das Existenzminimum zu drücken. Verschärfte Sanktionen erzielen darüber hinaus keine nachhaltigen Einsparungen, sondern verschärfen soziale Problemlagen. Die geplante Reform ist Symbolpolitik, die Misstrauen gegenüber Leistungsbeziehenden schürt, statt Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Besonders schwer wiegen die Auswirkungen für Familien und ihre Kinder. Werden Leistungen für Erwachsene gekürzt oder gestrichen, trifft dies diejenigen am härtesten, die keinerlei Einfluss auf die Situation haben: Kinder und Jugendliche. Sie leiden unmittelbar, wenn weniger für gesundes Essen oder den Wintermantel bleibt. Damit wird aus Sicht des ZFF ein Bereich verletzt, der verfassungsrechtlich besonders geschützt ist: das kindliche Existenzminimum.“
Altenkamp fährt fort: „Viele Familien leben schon jetzt am Rand ihrer Belastbarkeit. Wenn zusätzlich Unterkunftskosten begrenzt, Karenzzeiten gestrichen und Eltern kleiner Kinder früher in Erwerbsarbeit gedrängt werden, geraten Schutzräume ins Wanken, die eigentlich Sicherheit, Nähe und Entwicklung ermöglichen sollen. Für Familien – und insbesondere Alleinerziehende – die jeden Tag aufs Neue kämpfen müssen, kann diese Reform den Schritt in existenzielle Not bedeuten und zu Wohnungslosigkeit, sozialer Ausgrenzung und zum Verlust vertrauter Lebensorte führen.
Um Kinderarmut nachhaltig zu bekämpfen und Familien zu entlasten, braucht es neben der Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft und der Einführung eines Umgangsmehrbedarfs endlich eine realitätsgerechte Berechnung des kindlichen Existenzminimums. Kurzfristig müssen der Kindergeldübertrag im SGB II abgeschafft, das Bildungs- und Teilhabepaket vereinfacht und nicht-pauschalierbare Leistungen wie Klassenfahrten oder Mittagessen direkt über Schule und Kita bereitgestellt werden. Langfristig setzt sich das ZFF weiterhin für eine echte Kindergrundsicherung mit niedrigschwelligem Zugang und flächendeckenden Familienanlaufstellen ein.
Wir fordern die Bundesregierung nachdrücklich auf, die Reform grundlegend zu überarbeiten. Es braucht einen Ansatz, der Schutz, Teilhabe und Würde aller Menschen in den Mittelpunkt stellt – nicht Kontrolle und Sanktion!“
Die Stellungnahme des ZFF anlässlich des Referent*innenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) „Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (13. SGB II-ÄndG)“ finden Sie hier.
Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 24.11.2025
SCHWERPUNKT I: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
BMBFSFJ: Straftaten gegen Frauen und Mädchen nehmen weiter zu - Häusliche Gewalt auf Höchststand
BMI, BMBFSFJ und BKA veröffentlichen Bundeslagebilder
„Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“
und „Häusliche Gewalt“ für das Jahr 2024
Die Zahl der weiblichen Opfer von Gewalt- und anderen Straftaten steigt in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) weiter an. Die Straftaten finden dabei sowohl im analogen als auch im digitalen Raum statt.
Bundesfrauenministerin Karin Prien: „Gewalt gegen Frauen ist ein alltägliches Verbrechen, das wir nicht hinnehmen dürfen. Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Angst und ohne Gewalt. Als Bundesfrauenministerin setze ich mich dafür ein, dass wir durch gezielte Maßnahmen und stärkere Prävention, bessere Daten und ein starkes Hilfsnetzwerk endlich echten Schutz bieten. Ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der Frauen sicher und frei leben können.“
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt: „Der Schutz von Frauen hat für uns höchste Priorität. Wir setzen auf klare Konsequenz und konsequente Kontrolle: Frauen sollen sich sicher fühlen und sich überall frei bewegen können. Deshalb führen wir die Fußfessel nach spanischem Vorbild ein – sie begrenzt die Wege der Täter und gibt den Betroffenen mehr Sicherheit. Zudem stufen wir K.O.-Tropfen, die zunehmend als verbreitetes Tatmittel genutzt werden, als Waffe ein. So schaffen wir die Grundlage für spürbar strengere Strafverfolgung.“
BKA-Präsident Holger Münch: „Die Zahl der Straftaten an Frauen steigt kontinuierlich. Wir sehen hier allerdings nur das Hellfeld. Gerade bei Häuslicher Gewalt, die oft hinter verschlossenen Türen geschieht, gibt es ein hohes Dunkelfeld. Erste Ergebnisse unserer aktuellen Opferbefragung LeSuBiA zeigen, dass nur ein Bruchteil der tatsächlich erlebten Gewalt zur Anzeige gebracht wird. Darum müssen wir darauf hinwirken, dass mehr Betroffene den Mut finden, Taten anzuzeigen, um den Schutz und die Hilfe für Opfer zu verbessern. Eines ist klar: Wir müssen Gewalt gegen Frauen und Gewalt im häuslichen Umfeld entschieden bekämpfen. Die heute veröffentlichten Lagebilder liefern zusammen mit den in Kürze veröffentlichten Ergebnissen von LeSuBiA eine verlässliche Grundlage, um die Hintergründe von Gewalt besser zu verstehen und wirksame Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen zu entwickeln.“
Mehr Straftaten gegen Frauen und Mädchen
Im Jahr 2024 wurden in der PKS 53.451 weibliche Opfer von Sexualdelikten erfasst (+2,1 %, 2023: 52.330). Knapp die Hälfte war zum Tatzeitpunkt minderjährig. Die meisten dieser Frauen und Mädchen wurden Opfer von sexueller Belästigung (36,4 %), Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellem Übergriff (insgesamt 35,7 %) sowie sexuellem Missbrauch (27,5 %).
2024 wurden 308 Mädchen und Frauen getötet. Tötungsdelikte an Frauen können über die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht als „Femizide“ im Sinne des allgemeinen Verständnisses „Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist“ interpretiert werden, da keine bundeseinheitliche Definition des Begriffs „Femizid“ existiert und in der PKS keine Tatmotivation erfasst wird. Eine trennscharfe Abbildung und Benennung von Femiziden ist daher auf Basis der vorliegenden kriminalstatistischen Daten nicht möglich. Insgesamt wurden in der PKS 328 Mädchen und Frauen als Opfer vollendeter Tötungsdelikte erfasst (-8,9 %, 2023: 360). Da in der PKS 2024 erstmals der Verletzungsgrad der Opfer bundeseinheitlich erfasst wurde, ist nun eine Unterscheidung zwischen den von vollendeten Tötungsdelikten insgesamt betroffenen Opfern und den tatsächlich tödlich verletzten Personen möglich. Betroffene Opfer können beispielsweise Kinder sein, die bei der Tat auch angegriffen, aber nur verletzt wurden. 859 Frauen und Mädchen wurden Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten (–8,4 %; 2023: 938).
18.224 Frauen und Mädchen waren Opfer digitaler Gewalt, beispielsweise durch Cyberstalking oder Online-Bedrohungen. Mit einem Anstieg um 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2023: 17.193) ist die Zahl weiblicher Opfer im Bereich digitale Gewalt damit erneut gestiegen – der stärkste Anstieg in allen Fallgruppen.
Im Bereich der Politisch motivierten Kriminalität wird die Tatmotivation berücksichtigt. Hier zeigt sich mit 558 erfassten Straftaten im Jahr 2024 ein erneut hoher Anstieg bei frauenfeindlichen Straftaten (+73,3 %). Damit setzt sich der Anstieg aus dem Vorjahr fort (2023: +56,3 %). Knapp die Hälfte der Delikte entfällt auf den Straftatbestand Beleidigung. Bei den registrierten 39 Gewaltdelikten handelt es sich in den meisten Fällen um Körperverletzungen. 2024 wurde in diesem Zusammenhang ein versuchtes Tötungsdelikt erfasst.
Lagebild zeigt Anstieg bei Häuslicher Gewalt
Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 265.942 Menschen Opfer Häuslicher Gewalt, ein neuer Höchststand. Damit ist knapp ein Viertel aller in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Opfer der Häuslichen Gewalt zuzuordnen. Die Opfer sind mit 70,4 Prozent überwiegend weiblich. Zur Häuslichen Gewalt zählt sowohl die Partnerschaftsgewalt als auch die Innerfamiliäre Gewalt, also Gewalthandlungen zwischen Eltern, Kindern, Geschwistern und anderen Angehörigen.
Es zeigt sich, dass zunehmend auch Männer und Jungen von Innerfamiliärer und Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Im Jahr 2024 waren mit 78.814 Betroffenen fast 30 Prozent der Opfer Häuslicher Gewalt männlich.
Wie schon in den Vorjahren waren die meisten Opfer Häuslicher Gewalt von Partnerschaftsgewalt betroffen (171.069 Personen; 64,3 %). 94.873 Personen (35,7 %) waren Innerfamiliärer Gewalt ausgesetzt.
Im Bereich der Partnerschaftsgewalt stieg die Zahl der Opfer um 1,9 Prozent auf 171.069. Partnerschaftsgewalt trifft nach wie vor überwiegend Frauen: rund 80 Prozent der Opfer sind weiblich. Unter den Tatverdächtigen dagegen sind Männer weiterhin deutlich überrepräsentiert (77,7 %). Häufigstes verzeichnetes Delikt war sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Opfern die Körperverletzung. 132 Frauen und 24 Männer wurden im vergangenen Jahr durch Partnerschaftsgewalt getötet.
Von Innerfamiliärer Gewalt waren 2024 insgesamt 94.873 Personen betroffen. Das entspricht einem Anstieg um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 54,2 Prozent der Opfer sind weiblich, 45,8 Prozent männlich. Am stärksten von Innerfamiliärer Gewalt betroffen sind Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Häufigstes Delikt ist auch bei der Innerfamiliären Gewalt die Körperverletzung. 130 Menschen wurden im vergangenen Jahr im Kontext Innerfamiliärer Gewalt getötet (2023: 155, -16,1 %). 71 von ihnen waren männlich, 59 weiblich.
Auffällig ist sowohl bei der Partnerschaftsgewalt als auch der Innerfamiliären Gewalt ein Anstieg der Straftaten im digitalen Raum. Im Kontext von Partnerschaftsgewalt stieg die Anzahl der Opfer von digitaler Gewalt gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent auf 4.876, im Rahmen der Innerfamiliären Gewalt um 20,4 Prozent auf 2.027.
Hohes Dunkelfeld bei Häuslicher Gewalt
Die Zahl der polizeilich registrierten Opfer Häuslicher Gewalt ist innerhalb der letzten fünf Jahre um insgesamt 17,8 Prozent gestiegen. Viele Taten im Bereich Partnerschaftsgewalt, sexualisierte und digitale Gewalt werden jedoch nicht angezeigt, etwa aus Angst, Abhängigkeit oder Scham. Erste Ergebnisse der Dunkelfeld-Opferbefragung „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag (LeSuBiA)“ ermöglichen einen Blick auf und in das Dunkelfeld: Die Anzeigequote liegt meist unter zehn Prozent, bei Partnerschaftsgewalt sogar unter fünf Prozent. Die Frequenz und der Schweregrad der Gewalterfahrung ist bei Frauen über alle Gewaltformen hinweg höher als bei Männern. Rund ein Viertel der Opfer von Partnerschaftsgewalt wird mehrfach Opfer. Zudem erleben die Betroffenen von Partnerschaftsgewalt oft mehrere Gewaltformen. Auch Erfahrungen mit Gewalt in der Kindheit sind nach den Ergebnissen der Studie weit verbreitet: Jede zweite in der Studie befragte Person berichtet – unabhängig vom Geschlecht – im Leben schonmal körperliche Gewalt durch Eltern und Erziehungsberechtigte erlebt zu haben.
Die Studie LeSuBiA, die das BKA in Kooperation mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt hat, untersucht Gewalterfahrungen von Menschen in Deutschland. Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Partnerschaftsgewalt, sexualisierte Gewalt und digitale Gewalt.
Weitere Informationen zum Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ finden Sie hier:
www.bka.de/StraftatengegenFrauen2024
Weitere Informationen zum Lagebild „Häusliche Gewalt“ finden Sie hier: www.bka.de/HaeuslicheGewalt2024
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 21.11.2025
SPD: Häusliche Gewalt stoppen – Schutz für Frauen jetzt stärken
Häusliche Gewalt nimmt dramatisch zu und Schutzlücken bleiben gefährlich. Näherungsverbote allein helfen nicht – wir brauchen elektronische Fußfesseln und mehr Arbeit mit Tätern, um Gewalt endlich wirksam zu begegnen.
„Wir werden Gewalt gegen Frauen konsequent bekämpfen. Die Zahlen zur häuslichen Gewalt erreichen einen neuen, erschreckenden Höchststand. Alle zwei Minuten wird ein Mensch, meist eine Frau, Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Dabei ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da viele Taten nicht angezeigt werden – aus Angst und Scham. Der gefährlichste Ort für Frauen bleibt dabei der Ort, an dem sie sich sicher fühlen sollten: das eigene Zuhause. Das darf nicht so bleiben, hier ist entschlossenes Handeln gefragt. Näherungsverbote allein reichen nicht aus, denn Täter halten sich oft nicht daran. Deshalb brauchen wir die elektronische Fußfessel, die Täter überwacht und Opfer schnell warnt. Außerdem muss bei den Tätern direkt angesetzt werden; mehr Täterarbeit ist dringend notwendig.
Jetzt braucht es Tempo. Der wichtige Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sollte zügig im Parlament beraten werden. Und ich bin froh, dass weitere Reformen Folgen werden. Wir müssen Frauen besser schützen.“
Quelle: Pressemitteilung SPD Fraktion im Bundestag vom 21.11.2025
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Mehr Gewalt, großes Dunkelfeld – Frauen brauchen echten Schutz
Anlässlich der Vorstellung der Bundeslagebilder „Häusliche Gewalt 2024“ und „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024“ erklären Dr. Irene Mihalic, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin, und Ulle Schauws, Sprecherin für Frauenpolitik:
Jeden Tag erleben Frauen Gewalt – zu Hause, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum. Es geht um Kontrolle, Körperverletzungen, sexualisierte Übergriffe und Mord. Die offiziellen Zahlen zeigen dabei nur einen Teil des von der Innenpolitik chronisch vernachlässigten Problems: Viele Betroffene erstatten aus Angst, Scham oder Abhängigkeiten keine Anzeige. Die neue Dunkelfeldbefragung „LeSuBiA“ (Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag) belegt eine extrem niedrige Anzeigequote bei Partnerschaftsgewalt von unter fünf Prozent. Auch belegen die Bundeslagebilder, dass Gewalt gegen Frauen weiter zunimmt – und das deutlich stärker als die Gewaltkriminalität insgesamt. Im Bereich der Politisch motivierten Kriminalität gegen Frauen zeigt sich ebenfalls ein hoher Anstieg – ein Ausdruck von wachsendem Antifeminismus und Frauenhass als einendem Element unterschiedlicher rechter Ideologien. Diese Situation darf kein Normalzustand bleiben. Die Maßnahmen der Bundesregierung sind ein erster Schritt, aber sie reichen nicht aus. Repressive Strafverfolgung ist ein Aspekt einer wirksamen Gewaltschutzstrategie. Aber die Fußfessel schützt nur einen kleinen Teil der Betroffenen und ist keine flächendeckende Lösung – das belegt sogar der Gesetzentwurf der Koalition selbst. Es braucht umfassenden Gewaltschutz nach Vorgaben der Istanbul-Konvention. Wir brauchen mehr Prävention, um Frauen tatsächlich wirkungsvoll vor Gewalt zu schützen. Spanien geht beispielsweise sehr entschlossen vor mit einem umfassenden Gewaltschutzgesetz und staatlichen Strukturen, die Sensibilisierung, Prävention, Opferschutz und Strafverfolgung wirksam verbinden. Solche Maßnahmen sollte die Bundesregierung zügig vorlegen, um Frauen tatsächlich wirkungsvoll vor Gewalt zu schützen. Es darf nicht bei Lippenbekenntnissen der Bundesregierung bleiben.
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 21.11.2025
AWO fordert zügige Umsetzung des neuen Gewalthilfegesetzes
Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen lässt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) das Haus des Bundesverbandes in Berlin in leuchtendem Orange erstrahlen. Die AWO setzt damit ein öffentlich sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – und verbindet den Anlass mit einer klaren politischen Forderung: Der im neuen Gewalthilfegesetz verankerte Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung muss ohne weitere Verzögerung umgesetzt werden.
Die AWO engagiert sich seit ihrer Gründung für die Verbesserung der Lebenssituation gewaltbetroffener Frauen – politisch wie praktisch als Trägerin von Frauenhäusern, Fachberatungs- und Interventionsstellen, Frauennotrufen und Schutzwohnungen. Aus der täglichen Arbeit ist bekannt, wie groß die Versorgungslücken im Hilfesystem sind. Viele schutzsuchende Frauen und mitbetroffene Kinder finden keinen Platz. Deutschland verfehlt weiterhin die Vorgaben der Istanbul-Konvention: Bundesweit fehlen mehr als 12.000 Frauenhausplätze.
Der aktuelle Bericht des Bundeskriminalamts „Häusliche Gewalt 2024“ und „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024“ zeigt besorgniserregende Entwicklungen. Gewalt gegen Frauen und Mädchen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Ein Höchststand wurde 2024 bei häuslicher Gewalt erreicht: Ihr fielen 265.942 Menschen zum Opfer, überwiegend weiblich. Damit entfiel fast ein Viertel aller polizeilich registrierten Opfer auf dieses Deliktfeld.
„Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen nimmt weiter zu – das ist ein erschreckender Befund, der uns alle zum Handeln auffordert. Der Rechtsanspruch aus dem Gewalthilfegesetz auf Schutz und Beratung muss deshalb zügig und vollumfänglich umgesetzt werden. Die angekündigten Bundesmittel zum Ausbau des Schutz- und Hilfesystems dürfen nicht dazu führen, dass Länder und Kommunen sich angesichts angespannter Haushalte aus ihrer finanziellen Verantwortung zurückziehen. Betroffene brauchen die Möglichkeit, eine Gewaltsituation sofort hinter sich zu lassen. Dieses Recht darf nicht an fehlenden Plätzen oder Zuständigkeiten scheitern“, so Claudia Mandrysch, Vorständin des AWO-Bundesverbands.
Die AWO fordert daher den sofortigen Ausbau des Schutz- und Hilfesystems sowie die Sicherstellung ausreichender Kapazitäten in Ländern und Kommunen, damit der Rechtsanspruch umgesetzt werden kann. Gewährleistet werden muss der vorbehaltlose und niedrigschwellige Zugang zum Hilfesystem, unabhängig von Einkommen, Vermögen, Herkunft, Aufenthaltsstatus, Gesundheitszustand oder Behinderungsgrad.
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 25.11.2025
DGB: Gewalthilfegesetz jetzt konsequent umsetzen! Hannack: „Schutz vor häuslicher Gewalt darf nicht vom Wohnort abhängen“
Anlässlich des morgigen Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bund, Länder und Kommunen auf, das Gewalthilfegesetz unverzüglich und konsequent umzusetzen. Die alarmierenden Statistiken machen deutlich: Jeden zweiten Tag kommt eine Frau durch häusliche Gewalt zu Tode. Trotz der erschreckenden Zahlen weisen Hilfestrukturen und deren Finanzierung nach wie vor eklatante Lücken auf – tausende Frauenhausplätze fehlen.
„Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Ob Frauen Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt finden, darf nicht vom Wohnort abhängen“, erklärt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Schutz und Unterstützung in Frauenhäusern müssen in allen Regionen Deutschlands gleichermaßen gesichert und zugänglich sein. Die notwendigen Verbesserungen kommen nur im Schneckentempo voran – das ist inakzeptabel. Wir brauchen bundesweit verbindliche Regelungen, die ein breit gefächertes, bedarfsgerechtes Unterstützungssystem sicherstellen, das dauerhaft finanziert ist. Allen Opfern von häuslicher Gewalt müssen Schutz und Hilfe gewährt werden – unabhängig von Einkommen, Aufenthaltsstatus, Herkunftsort, gesundheitlicher Einschränkung oder Behinderung.“
Die Finanzierung der Frauenhäuser erfolgt je nach Bundesland und Kommune in unterschiedlichem Maße; etliche Frauenhäuser sind sogar auf Spenden angewiesen. Betroffene, die nicht sozialleistungsberechtigt sind, müssen in vielen Bundesländern so hohe Unterbringungskosten zahlen, dass sie sich einen Platz nicht leisten können. Der DGB fordert die Länder auf, die Vorgaben des Gewalthilfegesetzes zügig umzusetzen und flächendeckend Beratungsangebote und Schutzunterkünfte für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder aufzubauen. Den ab 2032 einklagbaren Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung begrüßt der DGB ausdrücklich.
Der DGB macht sich zudem stark dafür, dass alle staatlichen Institutionen bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt so ausgestattet werden, dass die notwendigen personellen Ressourcen und Qualifikationen der Beschäftigten zur Verfügung stehen. Auch eine verstärkte Täterarbeit sei notwendig, um geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen. „Wir fordern die ausreichende Finanzierung des Hilfesystems mit Frauenhäusern, Schutzwohnungen, Fachberatungsstellen bei häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt, Interventionsstellen und Täterarbeit“, so Hannack abschließend. „Der Schutz von gewaltbetroffenen Frauen muss endlich Priorität haben.“
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 24.11.2025
Diakonie: Gewalt gegen Frauen und Mädchen trifft uns alle
Gewalt gegen Frauen und Mädchen bleibt ein massives gesellschaftliches Problem. Laut einer EU-weiten Studie ist jede dritte Frau in Deutschland von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. Alle vier Minuten wird eine Frau Opfer häuslicher Gewalt. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet worden, 191 davon durch Partner, Ex-Partner oder andere Familienmitglieder.
Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland: „Diese Zahlen sind erschütternd und verlangen entschlossenes Handeln. Gewalt gegen Frauen, ob in Familie und Partnerschaft, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum ist eine Menschenrechtsverletzung. Ihre Bekämpfung gehört ganz oben auf die politische Agenda. Dass Frauen und Mädchen in unserem Land weiterhin so großer Gefahr ausgesetzt sind, darf keine Gesellschaft hinnehmen. Politik, Institutionen und jede und jeder Einzelne tragen Verantwortung. Wir müssen jeder Form von Gewalt mit Prävention, klaren Konsequenzen und gesellschaftlichem Wandel begegnen. Dafür braucht es auch Zivilcourage im Alltag – in Schulen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Überall dort, wo Frauen Schutz und Solidarität brauchen.“
Die Zahl der bei der Polizei registrierten Fälle steigt seit Jahren kontinuierlich. Nach Einschätzung der Diakonie Deutschland zeigt dies, dass in der Vergangenheit zu wenige erfolgreiche Präventionsmaßnahmen umgesetzt wurden.
Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: „Mit dem im Februar in Kraft getretenen Gewalthilfegesetz wird ab 2032 ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bestehen. Das ist ein wichtiger Schritt. Allerdings brauchen Frauen, die akut von Gewalt bedroht sind, jetzt Hilfe. Frauenhäuser und Beratungsstellen sind aktuell von existenzbedrohenden Kürzungen betroffen. Wir sind besorgt, dass die vom Bund ab 2027 zugesicherten Mittel nur dafür genutzt werden, um bestehende Finanzierungslücken im Hilfesystem zu schließen, sie sind jedoch für den Ausbau des Hilfesystems gedacht.“
Zur geplanten Einführung der elektronischen Fußfessel zur Aufenthaltsüberwachung von Gefährdern sagt Ronneberger: „Die Maßnahme kann im Ansatz sinnvoll sein, droht jedoch zur reinen Symbolpolitik zu werden, wenn sie nicht Teil einer umfassenden Strategie ist, die die Ursachen von Gewalt gegen Frauen konsequent angeht.“ Darüber hinaus fordert die Diakonie gezielte Präventionsarbeit. Es brauche Kampagnen und Beratungsangebote, die sich auch an gewaltausübende Personen – überwiegend Männer – richten und gewaltfreie Handlungsoptionen aufzeigen. Prävention müsse früh ansetzen, betont Ronneberger: „In Schulen, Familienzentren, Jugendarbeit und Quartiersprojekten müssen Kinder und Jugendliche lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen.“
Frauen erleben psychische und physische Gewalt auch am Arbeitsplatz. Bis Ende 2026 will die Diakonie Deutschland deshalb ihr Gewaltschutzkonzept fest verankert haben. Das Schutzkonzept sieht vor, dass es transparente Ansprech- und Meldewege bei Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung gibt.
Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Finanzen, Personal und Recht der Diakonie Deutschland:
„Wir setzen uns entschieden gegen jede Form von Sexismus und geschlechtsbezogener Gewalt am Arbeitsplatz ein. Unsere Mitarbeitenden sollen sich sicher und geschützt fühlen. Dazu gehören auch Pflicht-Schulungen zur Gewaltprävention, um alle Mitarbeitenden, insbesondere Frauen, am Arbeitsplatz zu schützen.“
Hintergrund
Am 25. November wird weltweit der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Dieser Gedenk- und Aktionstag macht auf die strukturelle, körperliche und psychische Gewalt aufmerksam, der Frauen und Mädchen überall auf der Welt noch immer ausgesetzt sind. Frauen erleben Gewalt häufig in ihrem engsten Umfeld – in Ehe und Partnerschaft, durch Familienangehörige oder Bekannte. Das Phänomen betrifft Frauen aus allen sozialen und kulturellen Milieus. Im Rahmen der Orange Days – einer weltweiten UN-Kampagne – werden Gebäude, Rathäuser und Denkmäler in oranger Farbe angestrahlt. Orange steht für eine Zukunft ohne Gewalt, für Hoffnung und Solidarität.
EU-Studie: European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Gewalt gegen Frauen
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Diakonie Deutschland vom 24.11.2025
VAMV: Frauen und Kinder vor dem Familiengericht besser schützen!
Der VAMV fordert die Politik auf, endlich ein umfassendes Konzept zum Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern vorzulegen und auch in familiengerichtlichen Verfahren das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) vollständig umzusetzen.
„Viel zu oft treffen Familiengerichte Entscheidungen zum Sorge- und Umgangsrecht, ohne eine aktuelle Gefährdungslage zu berücksichtigen“, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV). „Der Schutz vor häuslicher Gewalt kommt zu kurz. Daher fordern wir gesetzliche Klarstellungen: In Fällen häuslicher Gewalt darf keine gemeinsame Sorge angeordnet werden und der Umgang des Kindes bei häuslicher Gewalt entspricht in der Regel nicht dem Wohl des Kindes“, so Daniela Jaspers. „Zudem müssen alle an den Verfahren beteiligten Professionen zu Dynamiken häuslicher Gewalt durch qualitativ hochwertige und zertifizierte Fortbildungen geschult werden.“
Gerade zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen der Vereinten Nationen (25.11.2025) ist es dem VAMV ein Anliegen, auf die Missstände in familiengerichtlichen Verfahren hinzuweisen. Zwar ist das Thema häuslicher Gewalt in den letzten Jahren etwas stärker in den Fokus der Politik und der Rechtsprechung (z.B. OLG Köln, Beschluss vom 10.01.2025 – 14 UF 4/25) gerückt. Dies ist insbesondere der Istanbul-Konvention sowie der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu verdanken. Allerdings stehen entsprechende Reformen im Familienrecht und im Familienverfahrensrecht immer noch aus. Obwohl bekannt ist, dass nicht nur Gewalt gegen das Kind selbst, sondern auch Gewalt gegen seine Hauptbezugsperson kindeswohlschädlich ist, wird in diesen Fällen zum vermeintlichen Kindeswohl häufig (begleiteter) Umgang mit dem gewalttätigen El-ternteil angeordnet. Dies gefährdet das Kind und führt dazu, dass der gewaltausübende Elternteil weiterhin Kontakt zum gewaltbetroffenen Elternteil, meist der Mutter, hat, und diese weiterhin psychisch oder physisch schädigen kann.
„In Sorge- und Umgangsrechtsentscheidungen müssen Kinder- und Frauenschutz immer zusammengedacht werden. Hier ist der Gesetzgeber gefordert“, unterstreicht Jaspers.
Quelle: Pressemitteilung Verband alleinerziehender Mütter und Väter,
Bundesverband e.V. (VAMV) vom 24.11.2025
VdK: Verena Bentele: „Gewalt gegen Frauen geht uns alle an“
- Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist starkes Zeichen der Solidarität
- Die Würde, der Respekt und der Schutz von Frauen und Mädchen sind nicht verhandelbar
Gewalt stellt laut der Weltgesundheitsorganisation eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen dar. VdK-Präsidentin Verena Bentele warnt anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November vor dem alarmierenden Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt auch in Deutschland:
„Die Zahlen zeigen einen erneuten Anstieg der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Noch immer wird viel zu oft darüber geschwiegen. Dieses Schweigen schützt die Täter und lässt die Betroffenen allein. Gewalt gegen Frauen betrifft uns alle. Wir müssen gemeinsam das Schweigen brechen. Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen setzen wir ein starkes Zeichen der Solidarität und sagen: Schaut nicht weg! Die Würde, der Respekt und der Schutz von Frauen und Mädchen sind nicht verhandelbar.
Wir dürfen nicht hinnehmen, dass statistisch gesehen eines von drei Mädchen im Laufe seines Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt. Als Gesellschaft müssen wir aktiven Schutz bieten. Das neue Gewalthilfegesetz ist ein zentraler Schritt in diese Richtung. Seine langsame Umsetzung führt jedoch weiterhin zu Lücken. Dass der geplante Rechtsanspruch auf Schutz und fachkundige Beratung für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder erst 2032 in Kraft treten soll, ist aufgrund der erneuten Zunahme der Gewalttaten für die Betroffenen dramatisch. Sie brauchen sofort Schutz, kompetente Beratung, Begleitung und ausreichend Plätze in Frauenhäusern.
Für Mädchen und Frauen mit Behinderung ist es sogar noch erschreckender: Rund jede zweite Frau in dieser Gruppe ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Damit auch sie wirksam vor Gewalt geschützt werden, müssen alle Angebote barrierefrei ausgebaut werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass Leistungserbringer von Hilfen für Menschen mit Behinderungen verbindliche Gewaltschutzkonzepte vorlegen und umsetzen.“
Laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2024 wurden 53.451 Frauen und Mädchen Opfer von Sexualdelikten, fast die Hälfte davon war minderjährig. Zudem registrierte die Polizei 308 Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen, 132 davon im Zusammenhang mit Partnerschaftsgewalt. Auch bei der häuslichen Gewalt gibt es mit 265.942 Opfern einen neuen Höchststand: ein Anstieg um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 17,8 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre. Zu rund 70 Prozent sind die Opfer Frauen und Mädchen.
Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 24.11.2025
SCHWERPUNKT II: Internationaler Tag der Kinderrechte
Deutscher Bundestag: „Jedes Kind zählt!“ – Kinderkommission zum Internationalen Tag Kinderrechte am 20. November 2025
Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages teilt mit:
Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. 196 Staaten haben in der Zwischenzeit diese Konvention, die allen Kindern auf der Welt in 54 Artikeln völkerrechtlich die gleichen verbindlichen Mindeststandards verbrieft, ratifiziert. In Deutschland und auf der ganzen Welt machen sich Kinder und Jugendliche seitdem an diesem Tag für die Umsetzung ihrer Rechte stark, dieses Jahr unter dem Motto: „Jedes Kind zählt!“
Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages als Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen im Parlament setzt sich mit ihrem Arbeitsprogramm aktiv für die Einhaltung und Stärkung der Rechte der Kinder ein.
Weltweit sind aufgrund von Krisen, Kriegen und Konflikten mehr Kinder denn je auf Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig werden überall die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe gekürzt. Das hat gravierende Folgen für Millionen Kinder und bringt nicht wenige von ihnen in akute Lebensgefahr.
Gerade deshalb ist es für die Kinderkommission besonders wichtig, den mit der Kinderrechtskonvention verbundenen Auftrag ins Zentrum von Politik und Gesellschaft zu stellen und Verbesserungen bei der Umsetzung der Kinderrechte einzufordern.
Der Vorsitzende der Kinderkommission, Michael Hose, MdB, erklärt hierzu:
„Kinderrechte sind keine wohlklingenden Absichtserklärungen, sondern konkrete Verpflichtungen. Sie gelten überall, im Krieg und im Frieden, im analogen wie im digitalen Raum. Gerade in einer Zeit, in der Kinder weltweit unter Armut, Gewalt und der Kommerzialisierung ihrer Lebenswelt leiden, braucht es eine Politik, die Kinder nicht nur schützt, sondern ihnen echte Teilhabe ermöglicht.
Die Kinderkommission setzt sich dafür ein, dass Kinderrechte in allen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden: in der Bildung, im digitalen Umfeld und beim Schutz vor Gewalt. Jedes Kind zählt und jedes Kind hat ein Recht auf eine sichere und gerechte Zukunft.“
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 20.11.2025
DKHW: Internationaler Tag der Kinderrechte: Klimaschutz ist Kinderschutz
Zum morgigen Internationalen Tag der Kinderrechte fordert ein breites Bündnis aus 24 Kinder- und Jugendverbänden sowie Kinderrechtsorganisationen die Bundesregierung zu entschlossenem Handeln beim Klimaschutz auf: Bis Ende des Jahres soll ein sozial gerechtes Klimaschutzprogramm beschlossen werden, das die nationalen Klimaziele erreicht und das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt.
Das Bündnis appelliert an die Bundesregierung: „Klimaschutz ist mehr als ein ökologisches Ziel. Klimaschutz ist Kinderschutz. Klimaschutz ist Schutz vor Armut, Ungleichheit und Zukunftsangst. Klimaschutz ist unser Recht und eure Pflicht!“ Ohnehin benachteiligte Menschen trifft die Klimakrise am härtesten – ob im Globalen Süden oder in Deutschland. Die Verbände fordern ein Klimaschutzprogramm bis Ende des Jahres, das die Klimaziele bis 2040 erreicht und das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt.
Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes: „Für das gesunde Aufwachsen von Kindern braucht es auch eine gesunde Umwelt. Kinder sind verletzlicher als Erwachsene, wenn sie Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits vor Jahren einen neuen Maßstab für Klima- und Grundrechtsschutz gesetzt, indem es feststellte, dass die heute unzureichende Klimaschutzpolitik Freiheits- und Grundrechte von morgen beeinträchtigt. Gerade deshalb muss die deutsche Bundesregierung gemäß den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention das Recht der Kinder auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt wesentlich umfangreicher als bisher in die nationale Gesetzgebung und das politische Handeln aufnehmen.“
Anna-Luisa Jansen, stellvertretende Vorsitzende der Jugendorganisation der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Jugend, über die Forderungen des Bündnisses: „Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Zukunft und gesellschaftliche Teilhabe – deshalb fordern wir den Ausbau von Bus und Bahn. Wer den ÖPNV teurer macht, schließt junge Menschen aus und gefährdet das Klima. Wir brauchen faire Ticketpreise: Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein. Gerade Familien, Schüler*innen und Auszubildende sind auf Bus und Bahn angewiesen, um zur Schule, Ausbildung und Freund*innen fahren zu können. Dabei ist klar: Faire Preise brauchen faire Arbeit. Die Beschäftigten im ÖPNV-Sektor stehen seit Jahren unter immenser Arbeitsbelastung, denn schon jetzt gibt es viel zu viele unbesetzte Stellen. Der Ausbau und die Modernisierung des ÖPNV gehen nur Hand in Hand mit ausreichend Kolleg*innen und guten Arbeitsbedingungen. Busse und Bahnen fahren nicht von alleine – dafür sorgen Beschäftigte, die seit Jahren unter Druck stehen. Sozial gerechter Klimaschutz bedeutet, dass niemand auf der Strecke bleibt. Mobilität ist keine Ware – sie ist Daseinsvorsorge und ein Versprechen an die nächste Generation.“
Konrad Brakhage, 1. Stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend, ergänzt: „Die Klimakrise betrifft junge Menschen jetzt! Gleichzeitig werden wir in Zukunft viel mehr von Extremwetterereignissen betroffen sein. Junge Menschen müssen in politische Entscheidungsprozesse, die ihr Leben so sehr beeinflussen, einbezogen werden. Deutschland muss mehr tun und bis Ende des Jahres ein Klimaschutzprogramm liefern, dessen Maßnahmen bei Kindern und jungen Menschen ankommen. Dabei ist eine ehrliche Beteiligung junger Menschen unerlässlich! Wir fordern gemeinsam mit allen unterzeichnenden Organisationen eine nachhaltige und verlässliche Finanzierung von Kinder- und Jugendverbänden, sowie Jugendringen, die es ermöglicht, die Stimmen junger Menschen in den Prozessen der Klimapolitik zu stärken.“
Zeichnende Verbände:
. Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland . Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend . Brot für die Welt Jugend . Bund der Deutschen Katholischen Jugend . Bundesjugendwerk der AWO . BUND Jugend . Der Kinderschutzbund . Deutsche Schreberjugend . Deutsches Kinderhilfswerk . Deutsche Wanderjugend . Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Jugend . Fridays for Future Deutschland . Jugend des Deutschen Alpenvereins . Johanniter Jugend . Katholische Landjugendbewegung Deutschlands . Kindernothilfe . Landesjugendring Baden-Württemberg . Naturfreunde Jugend . NAJU – Naturschutzjugend im NABU . PLAN International . SOS-Kinderdörfer weltweit . Terres des Hommes . Verband Christlicher Pfadfinder*innen . ver.di Jugend
Den Appell können Sie hier abrufen: https://www.dkhw.de/appell-klimaschutz
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. vom 19.11.2025
DKSB und Frauenhauskoordinierung: Gewaltschutz vor Sorge- und Umgangsrecht
Kinderschutzbund und Frauenhauskoordinierung fordern Gewaltschutz vor Sorge- und Umgangsrecht
Zum Internationalen Tag der Kinderrechte fordern der Kinderschutzbund und Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK): Der Grundsatz „Gewaltschutz vor Sorge- und Umgangsrecht“ muss gesetzlich verankert werden. Die Kinderrechte auf Schutz vor Gewalt und gewaltfreie Erziehung müssen endlich gegenüber den Elternrechten priorisiert werden. Stattdessen werden Kinder zum Verhandlungsobjekt und Druckmittel in Familiengerichtsentscheidungen und vorherige häusliche Gewalt in der Partnerschaft kaum berücksichtigt.
Trotz nachgewiesener häuslicher Gewalt und gegen den ausdrücklichen Willen der Kinder ordnen Familiengerichte regelmäßig Kontakte zum gewaltausübenden Elternteil an. Beide Verbände kritisieren, dass Kinder dadurch systematisch gefährdet werden. Deutschland verletzt damit seine völkerrechtlichen V1erpflichtungen aus der Istanbul-Konvention.
Häusliche Gewalt erreicht in Deutschland einen neuen Höchststand: 2024 waren über 265.000 Menschen betroffen, darunter Zehntausende Kinder. Rund 16.000 Kinder finden jährlich allein in Frauenhäusern mit ihren Müttern Schutz. Etwa 171.000 Fälle wurden im Bereich der Partnerschaftsgewalt registriert. Dabei sind in vielen Fällen auch Kinder direkt oder indirekt mitbetroffen. Dennoch werden Umgänge oft gegen den Willen der Kinder angeordnet.
Artikel 31 der Istanbul-Konvention verpflichtet Deutschland seit 2018, Gewaltvorfälle bei kindschaftsrechtlichen Entscheidungen zwingend zu berücksichtigen. Diese Verpflichtung wird derzeit nicht flächendeckend eingehalten, zum Nachteil von Zehntausenden Kindern.
„Im Familienrecht muss die Stimme der Kinder endlich mehr Gewicht bekommen. Es kann nicht sein, dass Kinder gegen ihren Willen zum Umgang mit gewalttätigen Elternteilen gedrängt werden.“, erklärt Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes.
„Solange Gerichte auf Umgang drängen, statt Gewalt als Ausschlusskriterium zu begreifen, bleiben Kinder und Mütter schutzlos. Die Bundesregierung muss das Familienrecht jetzt zügig und grundlegend reformieren, wie von Justizministerin Hubig angekündigt“, fordert Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin von Frauenhauskoordinierung e.V.
Quelle: Pressemitteilung Der Kinderschutzbund Bundesverband e.V. und Frauenhauskoordinierung e. V. vom 20.11.2025
NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT
BMBFSFJ: Neue Kampagne „Zeit, die prägt“ rückt Pflegeelternschaft in den Mittelpunkt
Bundesfamilienministerin Karin Prien besucht Jugendamt und tauscht sich mit Pflegeeltern aus
Kindern ein Zuhause geben, in dem sie Zuwendung, Stabilität und Zeit, die prägt erfahren können – das ist das Ziel der neuen bundesweiten Kampagne des Bundesfamilienministeriums. Sie stellt die Bedeutung von Pflegefamilien in den Mittelpunkt und möchte mehr Menschen ermutigen, selbst ein Pflegekind aufzunehmen. Zum Auftakt der Kampagne besuchte Bundesfamilienministerin Karin Prien das Jugendamt Pankow in Berlin und tauschte sich dort mit Pflegeeltern sowie Mitarbeitenden des Pflegekinderdienstes über deren Alltag, Erfahrungen und Herausforderungen aus.
Im Gespräch schilderten zwei Pflegefamilien eindrucksvoll, was es bedeutet, Kinder mit schwierigen Lebenswegen liebevoll zu begleiten. Ebenso stand die enge Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und Pflegefamilien im Fokus – eine Arbeit, die entscheidend dafür ist, dass Kinder und Jugendliche gut unterstützt werden.
Bundesfamilienministerin Karin Prien: „Pflegefamilien leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den Schutz und die Zukunft von Kindern in schwierigen Lebenssituationen. Sie geben Halt, Zeit, Wärme und ein Zuhause auf Zeit oder für immer. Dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar. Ebenso danke ich den Mitarbeitenden der Jugendämter, die diese Familien fachlich begleiten und Tag für Tag Verantwortung tragen. Wir möchten Pflegefamilien sichtbar machen, ihnen danken – und Menschen ermutigen, diesen Weg selbst zu gehen. Denn: Jede Pflegefamilie schenkt einem Kind etwas, das ein Leben lang prägt.“
„Zeig mir, wie schön Ankommen ist“ – drei Motive, ein Ziel
Unter dem Kampagnenmotto „Zeit, die prägt“ startet das Bundesfamilienministerium mit drei Motiven – darunter „Zeig mir, wie schön Ankommen ist“ – eine breite Informationsoffensive. Die Kampagne will sowohl die wertvolle Rolle von Pflegeeltern sichtbar machen als auch Menschen informieren, die sich für eine Pflegeelternschaft interessieren.
Für viele Kinder sind Pflegefamilien ein sicherer Ort, ein Stück Alltag, Stabilität und Geborgenheit. Gleichzeitig fehlen bundesweit jedes Jahr rund 4.000 Pflegefamilien. Die Folge: Engpässe, übervolle Einrichtungen und Entscheidungen, die – trotz großer Bemühungen – nicht immer optimal im Sinne des Kindes getroffen werden können. Die Kampagne will diese Lücke verkleinern und auf ein Thema aufmerksam machen, das bisher oft zu wenig Beachtung findet.
Kindern Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit bieten
Viele Kinder und Jugendliche können aus ganz unterschiedlichen Gründen zeitweise oder dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern leben. Sie brauchen eine Umgebung, die ihnen Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit bietet. Die neue Kampagne stellt deshalb umfassende Informationen zur Pflegeelternschaft bereit – verständlich, gebündelt und niedrigschwellig.
Auf der Kampagnenseite finden Interessierte:
- Voraussetzungen für die Pflegeelternschaft
- Antworten auf zentrale Fragen
- Erfahrungsberichte
- Kontakte zu Anlaufstellen
Das Ziel: den Weg zur Pflegefamilie transparent und gut nachvollziehbar zu gestalten.
Weitere Informationen bietet das Familienportal des Bundes.
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 08.12.2025
BMBFSFJ: Vor Inkrafttreten des Rechtsanspruchs: Ganztagsausbau geht kontinuierlich voran
Bundeskabinett beschließt Bericht über Ausbaustand des Ganztags für Grundschulkinder
Das Bundeskabinett hat den dritten Bericht der Bundesregierung über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder beschlossen. Am 1. August 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter jahrgangsweise in Kraft treten. Damit werden bis im Schuljahr 2029/30 Kinder der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe einen Anspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung haben.
Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien: „Im Ganztag liegt eine große Chance, um Kinder unabhängig vom Hintergrund ihrer Eltern zum Bildungserfolg zu führen. Zeitgemäßer Ganztag ist Lern- und Lebensort für Kinder und ermöglicht bessere Teilhabe. Gleichzeitig erlaubt der Ganztag, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – vor allem für Mütter – zu verbessern. Wir als Bund setzen uns gemeinsam mit Ländern und Kommunen für verlässliche, kindgerechte Ganztagsbildung und -betreuung ein. Das schafft starke Familien. Deshalb ist der Rechtsanspruch, der im nächsten Jahr zunächst für die erste Klasse in Kraft tritt, ein echter Meilenstein. Erfreulich ist, dass der dritte Bericht zum Ausbaustand erneut einen deutlichen Anstieg des Platzangebots zeigt. Um die verbleibende Lücke zwischen Angebot und Bedarf der Eltern zu schließen, müssen wir – Bund, Länder und Kommunen – gemeinsam den Ausbau weiter vorantreiben und kindgerechte Ganztagsplätze schaffen. Es ist gut, dass die Länder zuversichtlich auf das Platzangebot zum Schuljahr 2026/27 blicken.“
Der dritte Bericht der Bundesregierung über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder zeigt, dass die Mehrheit der Familien Ganztagsangebote in Anspruch nimmt: im Schuljahr 2023/24 besuchten rund 1,9 Millionen aller sechseinhalb- bis zehneinhalbjährigen Kinder in der Bevölkerung eine Ganztagsschule oder eine Tageseinrichtung (Hort). Das sind 57 Prozent (westdeutsche Länder 51%, ostdeutsche Länder 84%). Bis zum Schuljahr 2029/30 werden zusätzlich im deutschlandweiten Mittel etwa 264.000 Plätze benötigt. Der prognostizierte Ausbaubedarf hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert, u. a., da Länder und Kommunen mit Unterstützung des Bundes stetig neue Plätze geschaffen haben.
In der Prognose des Elternbedarfes wurde mit zwei Szenarien gearbeitet. Im Szenario eines konstant bleibenden Bedarfs werden im Schuljahr 2026/27 (2029/30) rund 166.000 (190.000) und im Szenario eines deutlich steigenden Bedarfs 284.000 (339.000) zusätzliche Plätze benötigt. Dabei fällt der überwiegende Teil des quantitativen Ausbaubedarfs auf die westdeutschen Flächenländer, während in den ostdeutschen Ländern vor allem ein qualitativer Ausbau stattfindet. Wird nur der zusätzliche Platzbedarf für die erste Klasse im Schuljahr 2026/27 betrachtet, für die der aufwachsende Rechtsanspruch zum 1. August 2026 zunächst gilt, werden bei konstantem Bedarf bis zu 30.000 und bei steigendem Bedarf bis zu 65.000 Plätze zusätzlich benötigt. Laut Bericht rechnen die Landesverantwortlichen damit, dass sie zu Beginn des Rechtsanspruchs im Schuljahr 2026/27 ein (eher) bedarfsdeckendes Angebot vorhalten können.
Die Bundesregierung stellt mit dem Beschleunigungsprogramm bis Ende 2022 sowie dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau 2023-2029 rund 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in den Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur zur Verfügung, um den notwendigen Platzausbau zu unterstützen. Den durch den Rechtsanspruch entstehenden zusätzlichen Betriebskosten der Länder trägt der Bund durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Rechnung: Die vertikale Umsatzsteuerverteilung wird zugunsten der Länder ab 2026 jährlich aufwachsend von 135 Mio. € auf bis zu 1,3 Mrd. € pro Jahr ab 2030 angepasst.
Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder vor (GaFöG-Bericht). Federführend ist das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, hier ist auch die Geschäftsstelle zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter angesiedelt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.bmbfsfj.bund.de/ganztag und www.recht-auf-ganztag.de
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 03.12.2025
BMBFSFJ: Prostituiertenschutz-Kommission nimmt Arbeit auf
Auftaktsitzung der Unabhängige Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten
Bundesministerin Karin Prien hat die unabhängige Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten (Prostituiertenschutz-Kommission) einberufen. Die Ergebnisse der Prostituiertenschutz-Kommission sollen zu einem besseren Schutz der in der Prostitution tätigen Menschen, insbesondere zu einem besseren Schutz vor Zwangsprostitution und Menschenhandel, beitragen.
Bundesministerin Karin Prien: „Die Debatten der vergangenen Wochen machen einmal mehr deutlich, dass wir die Situation von Menschen, die in der Prostitution tätig sind, dringend verbessern müssen. Besonders der Kampf gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und Gewalt ist für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Daher habe ich die unabhängige Expertenkommission zum Schutz von Prostituierten einberufen. Sie wird auf Grundlage des Evaluationsberichts zum Prostituiertenschutzgesetz mit der dort versammelten Expertise Empfehlungen erarbeiten, die es der Politik ermöglichen, fundierte und sachlich gut begründete Entscheidungen zum Schutz der Prostituierten zu treffen.“
Die Prostituiertenschutz-Kommission setzt sich aus zwölf Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fach- und Arbeitsrichtungen zusammen, u.a. aus den Bereichen Menschenhandel, Wissenschaft, Strafverfolgung, Plattformregulierung, soziale Arbeit und Gesundheit. Den Kommissionsvorsitz hat Prof. Dr. Tillmann Bartsch. Die weiteren Mitglieder sind Dr. Angelika Allgayer, Dr. Elke Bartels, Dr. Katrin Baumhauer, Helga Gayer, Prof. Dr. Matthias C. Kettemann, Dr. Stefanie Killinger, Jörg Makel, Mark Mrusek, Prof. Dr. Gregor Thüsing, Maike van Ackern und Stefan Willkomm.
Die Kommission wird erarbeiten, welche konkreten Handlungsoptionen Bund, Länder und Kommunen haben, um den Schutz von Prostituierten vor Zwang und Ausbeutung zu verbessern. Dabei soll sie sich auch Fragestellungen über die Evaluation des ProstSchG durch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hinaus widmen, um den größtmöglichen Schutz von Prostituierten zu erreichen.
Die Kommission wird gesetzliche und nicht-gesetzliche Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Prostituiertenschutzes erarbeiten. Die gesetzlichen Maßnahmenvorschläge sollen innerhalb von zwölf, die nicht-gesetzlichen Maßnahmenvorschläge innerhalb von 18 Monaten vorgelegt werden.
Weitere Informationen zur Evaluation finden Sie hier: https://www.bmbfsfj.bund.de
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 24.11.2025
BMBFSFJ und UBSKM: „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“ – Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt geht uns alle an
Bundesfamilienministerin Karin Prien und die Unabhängige Bundesbeauftragte Kerstin Claus stellen neue Maßnahmen vor
Zum 10. Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch haben Bundesbildungsministerin Karin Prien und die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, heute in Berlin neue Initiativen und Forschungsvorhaben vorgestellt, die den Kinderschutz in Deutschland weiter stärken sollen. Der Europäische Tag steht in diesem Jahr unter dem Zeichen der Forschung – denn eine solide Datengrundlage ist entscheidend, um Prävention, Aufklärung und Schutzmaßnahmen wirksam zu gestalten.
Bundesbildungsministerin Karin Prien: „Wir wünschen uns alle mehr Anstrengungen für einen besseren Kinderschutz. Wichtig ist aber, dass unser Handeln wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert ist. Gerade im Bereich der sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen gibt es ein enormes Dunkelfeld. Deshalb freue ich mich besonders, dass mit dem Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen künftig eine sichere Datengrundlage – auch für politische Maßnahmen – geschaffen wird. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal, ein Mädchen oder ein Junge. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt geht uns alle an – „Schieb Deine Verantwortung nicht weg!“
Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen Kerstin Claus: „Wir starten im kommenden Jahr die bundesweite „Safe!“-Jugendstudie zu Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen. Gerade in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen ist es essentiell, dass Politik zielgerichtet und evidenzbasiert handelt. Gleichzeitig wissen wir alle, dass die gesellschaftlichen Kosten, die sexuelle Gewalt verursacht, immens sind. Gewalterfahrungen führen zu Bildungsabbrüchen, haben gesundheitliche Folgen und Konsequenzen in den Erwerbsbiografien Betroffener. Dies konsequent in einer wissenschaftlichen Studie zu erarbeiten, ist mir ein großes Anliegen. Ich appelliere deshalb an die Bundesregierung, dass sie eine umfassende Folgekostenstudie auf den Weg bringt. Damit klar ist, was es uns als Gesellschaft kostet, wenn der Schutz von Kinder und Jugendlichen nicht priorisiert wird.“
Kampagne #NichtWegschieben wird 2025 fortgeführt
Ein zentraler Bestandteil der Aktivitäten zum Europäischen Tag ist die Fortführung der Aufklärungs- und Aktivierungskampagne „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“. Die Kampagne läuft seit drei Jahren erfolgreich und richtet sich an Erwachsene, um das Bewusstsein für ihre Verantwortung im Kinderschutz zu stärken. Die bisherigen Ergebnisse zeigen deutliche Fortschritte: Der Anteil der Menschen, die sexuelle Gewalt auch im eigenen Umfeld für möglich halten, ist seit Beginn der Kampagne von 41 Prozent auf 53 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sehen heute 60 Prozent der Befragten Familie, Freunde und Bekannte in der Pflicht, Kinder zu schützen – vor der Kampagne waren es 50 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass kontinuierliche Aufklärung Haltungen verändern und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, nachhaltig stärken kann.
In 2025/26 rückt die Kampagne die Frage in den Mittelpunkt, was Erwachsene konkret tun können, um sexuellen Missbrauch zu verhindern. Kernstück der Kampagne in diesem Jahr ist der Whatsapp-Messanger-Kurs „7 Wochen. 7 Tipps“, der sich an Eltern und Fachkräfte wendet. Ervermittelt, wie Erwachsene – insbesondere Eltern – Kinder stärken und Täterstrategien erkennen können. So empfiehlt die Kampagne etwa, Kinder ernst zu nehmen, Grenzen zu respektieren, offen über Sexualität und Körperwissen zu sprechen und nachzufragen, wie Kinder in Kitas, Schulen oder Vereinen geschützt werden. Die Kernbotschaft lautet: Jede und jeder von uns kann dazu beitragen, Kinder zu schützen – indem wir hinsehen, zuhören und handeln – und aktiv werden, bevor etwas passiert.
In 2026/27 wird die Kampagne ihren Schwerpunkt auf digitale sexuelle Gewalt legen. Dabei soll besonders verdeutlicht werden, dass auch Online-Räume Schutzkonzepte benötigen und Erwachsene Verantwortung tragen, Kinder und Jugendliche im Netz zu begleiten und zu schützen.
Forschung als Grundlage: Das Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt
Mit dem am 1. Juli 2025 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen (UBSKM-Gesetz) bekommt das neue Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen (ZEFSG) beim Deutschen Jugendinstitut e. V. (DJI) eine wichtige Rolle. Es soll helfen, Forschungslücken zu schließen und eine evidenzbasierte Grundlage für politische und gesellschaftliche Maßnahmen zu schaffen.
Das zentrale Projekt des von UBSKM geförderten Zentrums ist die bundesweite „Safe!“-Jugendstudie zu Gewalterfahrungen und deren Folgen, die im Jahr 2026 startet. In dieser repräsentativen Untersuchung sollen rund 10.000 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen bundesweit befragt werden. Ziel der Studie ist es, belastbare Daten über Häufigkeit, Formen und Folgen sexueller Gewalt und anderer Gewaltformen zu gewinnen. Die Ergebnisse werden 2027 vorliegen und in die Berichterstattung der Unabhängigen Bundesbeauftragten Kerstin Claus an Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung einfließen.
Schutz im digitalen Raum: Expertenkommission hat Arbeit aufgenommen
Parallel hat das Bundesministerium die Unabhängige Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ eingesetzt. Sie nahm im Herbst 2025 ihre Arbeit auf. Die Kommission wird eine umfassende Strategie für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in digitalen Medien entwickeln. Dabei geht es unter anderem um den sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken, die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern, Eltern und Fachkräften sowie die Erforschung der gesundheitlichen Folgen intensiver Mediennutzung. Ziel ist es, konkrete Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Zivilgesellschaft zu erarbeiten, um Kinder online wie offline besser zu schützen.
10. Europäischer Tag zum Schutz von Kindern
Der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Er wurde 2015 vom Europarat eingeführt, um die Umsetzung der Lanzarote-Konvention zu unterstützen. Diese verpflichtet alle Mitgliedstaaten, jede Form sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu verurteilen und entschlossen dagegen vorzugehen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „Forschung als Grundlage wirksamen Schutzes“ – denn fehlende Daten sind ein Hindernis für Fortschritt im Kampf gegen sexuelle Gewalt.
Weitere Informationen
Informationen zur Kampagne #NichtWegschieben:
Materialien und Spots zum Download print- und sendefähig:
https://files.rsm-support.de/s/cNdn5Nw7MpDxMdw
Informationen zum Europäischen Tag gegen sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Kindern:
https://www.coe.int/en/web/children/end-child-sexual-abuse-day
Zahlen und Fakten zu sexuellem Missbrauch:
https://beauftragte-missbrauch.de/mediathek/publikationen/zahlen-und-fakten
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vom 18.11.2025
CDU/CSU: Kinderschutz ist Kern staatlicher Verantwortung
„Kinderrechte sind keine freundliche Empfehlung, sondern ein Anspruch, der die ganze Gesellschaft bindet. Sie definieren nicht nur, was Kindern zusteht, sondern auch, was wir ihnen schulden. Wer von Kinderschutz spricht, spricht vom Fundament eines Gemeinwesens, das seine Zukunft ernst nimmt. Deshalb hat der Schutz von Kindern vor Gewalt, vor Ausbeutung, vor digitalen Risiken politische und moralische Priorität.
Die jüngsten Zahlen zur Gewalt gegen Kinder und Jugendliche lassen keinen Interpretationsspielraum. Sie zeigen, wie dringlich es ist, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden: Kinder brauchen verlässliche Sicherheit, in der analogen Welt genauso wie im digitalen Raum. Dazu gehört auch, jene technischen Instrumente endlich zu nutzen, die wir längst kennen und die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden: die verlässliche, rechtssichere Speicherung von IP-Adressen, ohne die schwerste Straftaten gegen Kinder oft nicht aufgeklärt werden können. Ein Rechtsstaat, der digitale Tatorte der meist anonymen Täter nicht mehr findet, verliert seine Fähigkeit, Kinder zu schützen.
Gleichzeitig müssen digitale Räume altersgerecht gestaltet sein. Plattformen wie TikTok, die Milliarden mit der Aufmerksamkeit junger Menschen verdienen, müssen endlich Verantwortung übernehmen. Ihre Algorithmen fördern Enthemmung, Aggression und Gewalt. Diese Risiken müssen wir endlich beherrschen. Wir werden handeln: entschlossen, wirksam – im Interesse unserer Kinder und der Zukunft unseres Landes.“
Quelle: Pressemitteilung CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 20.11.2025
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Für eine gerechtere Besteuerung von Vermögen – Petition zeigt Unterstützung für Reformen
Anlässlich der Beratung der Petition „Vermögenssteuer auf alle Vermögensarten“ im Petitionsausschuss erklären Karoline Otte, Mitglied im Finanzausschuss, und Max Lucks, Mitglied im Finanzausschuss und Petitionsausschuss:
„In Deutschland besitzen zwei Familien so viel Vermögen wie die untere Hälfte der Bevölkerung. Diese massive Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis auch politischer Entscheidungen. Sie wird von der Bundesregierung verschärft, die Steuersenkungen beschließt und vorantreibt, von denen vor allem wenige sehr reiche Menschen profitieren.
Für uns Grüne ist klar: Massive Vermögensungleichheit gefährdet das Vertrauen in den Staat, erschwert Klimaschutzmaßnahmen und schwächt die demokratische Teilhabe. Deshalb sehen wir die Petition von Attac und ihre breite Unterstützung als wichtigen Rückenwind für unseren Einsatz gegen die wachsende Vermögensungleichheit.
Um die Vermögensungleichheit in Deutschland zu verringern und ihre gravierenden Folgen abzumildern, setzen wir uns für eine gerechtere Besteuerung von sehr hohen Vermögen ein. Daran arbeiten wir aktiv weiter und sind sehr dankbar für den Austausch mit der Zivilgesellschaft. Petitionen wie diese senden ein wichtiges Signal an alle Abgeordneten und sind ein zentraler Impuls für die parlamentarische Arbeit.“
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 30.11.2025
Bundestag: Bundesrat will Schutzlücken bei häuslicher Gewalt schließen
Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf zur „Effektivierung des Gewaltschutzes in Hochrisikofällen“ (21/3068) vorgelegt. Damit sollen bestehende Schutzlücken im Umgang mit häuslicher Gewalt geschlossen werden. Der zivilrechtliche Gewaltschutz habe „einen unvermeidlichen zeitlichen Vorlauf“ und sei „nicht immer das optimale Schutzinstrument“, heißt es in der Begründung.
Mit der Neuregelung soll laut Länderkammer insbesondere auf Fälle reagiert werden, in denen Täter trotz gerichtlicher Schutzanordnungen weiter eskalierend handeln. Die Länderkammer verweist darauf, dass zivilrechtliche Gewaltschutzanordnungen zwar schnell ergehen könnten, deren praktische Wirksamkeit jedoch maßgeblich von verfahrens- und vollstreckungsrechtlichen Vorgaben abhänge. In streitigen oder manipulativen Konstellationen verfügten die Familiengerichte zudem nicht über die gleichen Ermittlungsinstrumente wie die Polizei. Dies könne dazu führen, dass hochgefährliche Täter trotz mehrfacher Verstöße nicht effektiv gestoppt würden.
Nach Darstellung des Bundesrates zeigen insbesondere Hochrisikofälle im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz deutliche Parallelen zu eskalierenden Stalking-Fällen. Das bestehende System aus Schutzanordnung, Ordnungsmitteln und zivilrechtlicher Vollstreckung könne dieser Dynamik nicht hinreichend entgegenwirken, da Ordnungsgelder nicht selten ins Leere gingen und Vollstreckungsverfahren zeitverzögernd wirkten. In solchen Situationen bedürfe es „wirksamer und abschreckender Interventionsmöglichkeiten, durch die gewalttätige Personen frühzeitig konsequent gestoppt und aktiv zur Verantwortung gezogen werden können“, heißt es weiter.
Vor diesem Hintergrund schlägt der Bundesrat vor, den Strafrahmen für besonders schwere Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz deutlich anzuheben. Künftig sollen etwa Zuwiderhandlungen, bei denen Täter Waffen mit sich führen, das Opfer erheblich gefährden oder durch wiederholte und fortgesetzte Taten dessen Lebensgestaltung maßgeblich beeinträchtigen, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden können. Zudem soll in diesen Fällen die Möglichkeit einer vorbeugenden „Deeskalationshaft“ nach Paragraf 112a Strafprozessordnung eröffnet werden. Nach Auffassung des Bundesrates entspricht dies den Erfordernissen eskalierender Gewaltbeziehungen, in denen Täter trotz polizeilicher Gefährderansprachen und zivilgerichtlicher Anordnungen nicht von weiteren Übergriffen abgehalten werden können. Durch eine befristete Inhaftierung könne eine akute Gewaltspirale unterbrochen und das Opfer geschützt werden, bevor sich das Risiko schwerer Gewalttaten weiter verdichte.
Ein weiterer Schwerpunkt des Entwurfs liegt auf der Verbesserung des Informationsflusses zwischen Familiengerichten und Polizei. Künftig sollen die Polizeibehörden bereits mit Eingang eines Antrags auf eine Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz unterrichtet werden. Dies soll den Behörden ermöglichen, Gefährdungslagen frühzeitig einzuschätzen, Erreichbarkeiten zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen der Gefahrenabwehr vorzubereiten. Nach Angaben des Bundesrates können so Schutzlücken vermieden werden, die entstehen, wenn eine verletzte Person noch vor Zustellung einer Entscheidung bedroht oder angegriffen wird.
Die Bundesregierung begrüßt den Vorschlag zur Stärkung des Informationsflusses grundsätzlich und prüft die weiteren Änderungen. Zugleich verweist sie auf einen eigenen, am 19. November 2025 beschlossenen Gesetzentwurf, der ebenfalls auf einen wirksameren Gewaltschutz zielt.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 691 vom 10.12.2025
Bundestag: Abweichungen von Kita-Standards nur übergangsweise
Um Kindern frühzeitig verlässliche Bildungs- und Teilhabechancen zu eröffnen, ist nach Ansicht der Bundesregierung eine ausreichende Zahl qualifizierter Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung erforderlich. Gleichwohl sei der Personalbedarf insbesondere in den westdeutschen Ländern weiter nicht vollständig gedeckt, heißt es in der Antwort (21/3007) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (21/2746) der Linksfraktion.
Es sei daher nachvollziehbar, dass Vorkehrungen getroffen würden, um mit dem Fachkräftemangel umzugehen und gleichzeitig den Betrieb in den Kindertageseinrichtungen aufrechtzuerhalten. Abweichungen von Standards sollten jedoch nur übergangsweise und gut begründet hingenommen sowie durch qualitätssichernde Initiativen flankiert werden. Richtschnur seien das Wohl und die gute Förderung der betreuten Kinder, heißt es in der Antwort.
Bund und Länder arbeiteten kontinuierlich daran, die Qualität der Betreuungsangebote weiterzuentwickeln, die Rahmenbedingungen der Fachkräfte zu verbessern und das Berufsfeld attraktiv zu gestalten.
Zudem unterstütze der Bund die Länder im Rahmen der Weiterentwicklung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes in den Jahren 2025/2026 und stelle dafür rund vier Milliarden Euro bereit. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 685 vom 08.12.2025
Bundestag: Kein Anspruch auf Vermögensaufbau für Bürgergeldempfänger
Der Petitionsausschuss sieht mehrheitlich einen Anspruch auf Vermögensaufbau für Bürgergeldempfänger als nicht sachgerecht an. In der Sitzung am Mittwoch verabschiedete der Ausschuss die Beschlussempfehlung an den Bundestag, das Petitionsverfahren zu einer entsprechenden Eingabe abzuschließen, „weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte“.
Mit der Petition wird gefordert, dass im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende Einkommen nicht berücksichtigt wird, „wenn es dem Aufbau von Vermögen im Rahmen der gesetzlich definierten Freibeträge dient“. Der Gesetzgeber erwarte von Beziehern von Grundsicherungsleistungen, dass sie außerplanmäßige Ausgaben, wie beispielsweise die Reparatur einer Waschmaschine, eines Staubsaugers oder einer elektrischen Zahnbürste aus Rücklagen finanzierten, schreibt der Petent.
In Paragraf 12 Absatz2 SGB II räume der Gesetzgeber zwar Freibeträge ein, ermögliche es den Leistungsbeziehern aber nicht, eine solche Rücklage aufzubauen. Selbst wenn Freunde oder Bekannte in Notsituationen finanzielle Hilfe leisten wollten, werde eine solche Zahlung auf den Regelbedarf angerechnet. Hierdurch werde sowohl eine finanzielle Unterstützung Dritter als auch ein regulärer Aufbau von Vermögen innerhalb der Freibeträge unmöglich, heißt es in der Petition. Dies ist aus Sicht des Petenten unangemessen und widerspricht dem Gedanken der Freibeträge. Er verweist zugleich darauf, dass sich durch die Schaffung einer „Bagatellgrenze“ auch sozialgerichtliche Verfahren reduzieren würden.
Der Petitionsausschuss weist in der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung darauf hin, dass das SGB II in Paragraf 12 zwar „für bereits vorhandenes Vermögen unterschiedlicher Art“ diverse Vermögensfreibeträge einräumt. Allerdings gehöre der weitere Vermögensaufbau während des Bezuges staatlicher Fürsorgeleistungen nicht zu den Zielsetzungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Vielmehr sei die Grundsicherung „eine nachrangige Fürsorgeleistung zur Sicherung des gegenwärtig notwendigen Existenzminimums“. Daher seien von den Leistungsberechtigten vorrangig auch alle Einnahmen in Geld – unter Beachtung der in Paragraf 11a SGB II geregelten Ausnahmen – für die Bestreitung des Lebensunterhalts einzusetzen.
Durch eine Änderung bei der Grundsicherung sei seit dem 1. Januar 2023 Vermögen in bestimmtem Rahmen geschützt, um Arbeitsuchende in ihrem Bestreben zu unterstützen, sich von der Hilfe unabhängig zu machen, ihnen einen gewissen Spielraum in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit zu erhalten sowie eine nachhaltige soziale Herabstufung zu vermeiden, schreiben die Abgeordneten. Die bisher erbrachte Lebensleistung eines jeden Einzelnen finde zudem eine angemessene Anerkennung.
Vor dem Hintergrund, dass Grundsicherungsleistungen nur als vorübergehende, nachrangige und steuerfinanzierte Fürsorgeleistungen ausgestaltet sind, hält der Ausschuss einen Anspruch auf Vermögensaufbau jedoch für „nicht sachgerecht“. Er könne sich dem Anliegen der Petition deshalb nicht anschließen, heißt es in der Beschlussempfehlung.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 664 vom 03.12.2025
BiB: Eltern mit finanziellen Sorgen zweifeln häufiger daran, den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht zu werden
Das Armutsrisiko von Familien hängt stark von ihrer Familienform ab: Vor allem Alleinerziehende sowie Haushalte mit drei oder mehr Kindern sind überdurchschnittlich häufig von Armut bedroht. Eine neue Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) auf Grundlage des familiendemografischen Panels FReDA nimmt neben objektiven Faktoren wie dem Einkommen auch die subjektive Einschätzung der eigenen finanziellen Lage in den Blick. Mit dem Ergebnis: Gerade Alleinerziehende, die ihr Einkommen als zu gering empfinden, haben deutlich häufiger das Gefühl, ihrer Elternrolle nicht vollständig gerecht zu werden.
„Unsere Analysen verdeutlichen, dass Kinder nicht grundsätzlich ein Armutsrisiko darstellen“, erklärt Dr. Pauline Kleinschlömer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am BiB und Mitautorin der Untersuchung. „Entscheidend ist vielmehr, in welcher Familienform sie aufwachsen.“ Neben kinderreichen Familien sind vor allem Alleinerziehende besonders armutsgefährdet. Sie sind es auch, die sich selbst am stärksten als arm empfinden. Dies hat spürbare Auswirkungen auf den Familienalltag: Bei Alleinerziehenden, die sich auch subjektiv als finanziell belastet ansehen, ist das Gefühl am ausgeprägtesten, ihren Kindern nicht gerecht zu werden.
Armutsgefährdung trotz Erwerbstätigkeit
Auch wenn Erwerbstätigkeit das Armutsrisiko im Allgemeinen mindert, reicht das Einkommen daraus in bestimmten Familienformen teilweise nicht aus, um eine Armutsgefährdung zu vermeiden. So arbeiten alleinerziehende Frauen besonders häufig in Vollzeit, dennoch sind sie und ihre Kinder von allen untersuchten Gruppen am stärksten armutsgefährdet. „Dieses Ergebnis zeigt, dass Maßnahmen zur Förderung einer auskömmlichen Erwerbstätigkeit und staatliche Transferleistungen für Haushalte mit niedrigen Einkommen Hand in Hand gehen sollten, um die Armutsrisiken von Gruppen wie Alleinerziehenden zu senken“, so Mitautor Dr. Jan Brülle vom BiB.
Betreuungsangebote und Transferleistungen können helfen
Gleichzeitig kann Erwerbstätigkeit aus Sicht der Forschenden nur dann zur Armutsvermeidung beitragen, wenn verlässliche und flexible Angebote zur Kindertagesbetreuung vorhanden sind. Frühere Analysen des BiB zeigen, dass besonders bei Alleinerziehenden und großen Familien der ungedeckte Betreuungsbedarf erheblich ist. Rund 27 Prozent der Alleinerziehenden und 33 Prozent der armutsgefährdeten Familien finden keinen Betreuungsplatz, obwohl sie einen Bedarf äußern.
Neben dem Ausbau der Kindertagesbetreuung bleibt auch die finanzielle Unterstützung ein zentrales Handlungsfeld. „Da Erwerbstätigkeit allein häufig nicht ausreicht, brauchen gerade Alleinerziehende und kinderreiche Familien ein Zusammenspiel aus bedarfsgerechter Betreuung und zielgerichteten sowie wirksamen staatlichen Transferleistungen“, resümiert Brülle.
Hier geht’s zum Download:
https://www.bib.bund.de/Publikation/2025/Objektive-und-subjektive-Armut-von-Familien.html?nn=118888
Quelle: Pressemitteilung Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 10.12.2025
BiB: Pandemie wirkt nach: Fitness von Kindern und Jugendlichen bleibt eingeschränkt
Die COVID-19-Pandemie hat zu einem deutlichen Rückgang der körperlichen Fitness bei Kindern und Jugendlichen in Europa geführt, insbesondere bei der Ausdauer, etwa beim Laufen über längere Strecken, und bei der Schnelligkeit, zum Beispiel beim Sprint. Vor allem die Ausdauer-Werte haben sich bis heute nicht vollständig erholt. Das zeigt eine am BiB durchgeführte Meta-Analyse, die Daten aus 32 Studien mit mehr als 270.000 Teilnehmenden aus 17 europäischen Ländern auswertete. Insgesamt flossen über 1,5 Millionen Fitnessmessungen in die Analyse ein – damit handelt es sich um die bislang umfassendste Auswertung pandemiebedingter Veränderungen der körperlichen Leistungsfähigkeit bei jungen Menschen in Europa.
Körperliche Fitness entsteht durch regelmäßige Bewegung und beschreibt messbare körperliche Leistungsfähigkeiten wie Ausdauer, Schnelligkeit oder Kraft. Während der Pandemie sank die Fähigkeit, den Körper bei Belastung ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen, die sogenannte „kardiorespiratorische Fitness“, besonders stark bei Kindern und Jugendlichen. Dabei gingen vor allem Ausdauer und Schnelligkeit deutlich zurück. Während sich Schnelligkeit beim Sprint nach der Öffnung von Schulen und Sportstätten rasch normalisierte, hat sich die Ausdauerfitness bis heute nicht vollständig erholt. „Vom Rückgang der Ausdauer waren in erster Linie Mädchen aller Altersklassen sowie Jugendliche beider Geschlechter im Alter von 13 bis 19 Jahren betroffen“, erklärt Mitautorin Dr. Helena Ludwig-Walz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Im Gegensatz dazu blieb die muskuläre Fitness weitgehend stabil.Die Studie unterstreicht darüber hinaus, dass Länder mit strengeren Corona-Schutzmaßnahmen größere Rückgänge in der kardiorespiratorischen Fitness während der Pandemie verzeichneten.
Körperliche Fitness zählt zu den wichtigsten Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. „Kindheit und Jugend sind entscheidende Lebensphasen, in denen sich gesundheitliche Verhaltensweisen und Chancen für das gesamte Leben prägen“, betont Prof. Dr. Martin Bujard, Mitautor und Leiter des Forschungsbereichs Familie und Fertilität am BiB. Die weiterhin bestehenden Rückstände in der Ausdauerleistung könnten langfristig zu einer höheren Krankheitslast beitragen und bestehende gesundheitliche Ungleichheiten weiter verstärken. Vor diesem Hintergrund betont die Studie die Dringlichkeit gezielter Maßnahmen zur Förderung von Bewegung und Fitness, beispielsweise durch Politik, Schule, Sportvereine und Eltern. Angesichts steigender psychischer Belastungen von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Studien des BiB nachgewiesen wurden, der Zunahme von starkem Übergewicht und wachsender Bildschirmzeiten, sollte körperliche Fitness stärker als zentrale gesundheitspolitische Aufgabe verstanden werden, so Ludwig Walz: „Besonders schulische Angebote und Sportvereine vor Ort bieten nachweislich wirksame Möglichkeiten, regelmäßige Bewegung wieder stärker im Alltag zu verankern.“
Dieser Text basiert auf folgender Publikation:
Ludwig-Walz, Helena; Heinisch, Sarah; Siemens, Waldemar; Niessner, Claudia; Eberhardt, Tanja; Dannheim, Indra; Guthold, Regina; Bujard, Martin (2025): Trends in physical fitness among children and adolescents in Europe: A systematic review and meta-analyses during and after the COVID-19 pandemic.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254625000833?via%3Dihub
Quelle: Pressemitteilung Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 03.12.2025
BiB: „Living apart together“ – Partnerschaften mit getrennten Wohnungen sind vor allem bei jungen Erwachsenen verbreitet
Jede achte Person zwischen 18 und 49 Jahren führte im Jahr 2021 eine feste Partnerschaft in getrennten Haushalten. Dies geht aus einer aktuellen Untersuchung hervor, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) veröffentlicht hat. Besonders verbreitet ist diese Lebensform unter jungen Erwachsenen, vor allem während Ausbildung oder Studium. Die dargestellten Ergebnisse basieren auf Angaben von über 20.000 Personen, die 2021 im Rahmen des familiendemografischen Panels FReDA befragt wurden.
„Partnerschaften in getrennten Haushalten stellen seit vielen Jahren eine etablierte Lebensform dar, die jedoch in den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich häufig auftritt“, beschreibt Prof. Dr. Heiko Rüger vom BiB das Phänomen. So lebt unter den 18- bis 24-Jährigen fast ein Drittel getrennt vom Partner, während der Anteil bei den 40- bis 49-Jährigen nur noch bei rund sieben Prozent liegt.
Bilokale Beziehungen, wie diese Lebensform wissenschaftlich genannt wird, entstehen häufig durch äußere Umstände: Rund 62 Prozent der Betroffenen geben an, dass vor allem berufliche, finanzielle oder wohnungsbedingte Ursachen das Zusammenziehen in einen gemeinsamen Haushalt verhindern. Wenn das Getrenntwohnen bewusst gewählt wird, stehen Motive wie fehlende Zusammenzugsbereitschaft oder der Wunsch nach Autonomie im Vordergrund.
Für viele, meist jüngere Paare, stellt das getrennte Zusammenleben eine Übergangsphase im Lebenslauf dar, die sich oft aus äußeren Umständen ergibt. „Ältere Personen schätzen häufig die vergrößerte Autonomie und den individuellen Freiraum, die durch getrennte Wohnungen entstehen, bei gleichzeitiger emotionaler Nähe und den Vorteilen einer Beziehung“, so Rüger.
Besonders häufig treten solche Beziehungen bei höher Gebildeten auf, zudem bei Ledigen, Geschiedenen oder Verwitweten, während sie unter Verheirateten kaum verbreitet sind. Die räumliche Distanz zwischen den Partnern ist meist gering: Fast die Hälfte wohnt weniger als 30 Minuten voneinander entfernt, knapp ein Drittel lebt weiter als eine Stunde entfernt, was als Fernbeziehung gilt.
Hinsichtlich der Lebenszufriedenheit zeigt sich ein klarer Trend: Personen in bilokalen Beziehungen sind zufriedener als Singles, aber leicht weniger zufrieden als zusammenlebende Personen. „Mit zunehmender Distanz zwischen den Haushalten nimmt die Zufriedenheit etwas ab, bleibt aber über dem Niveau von Singles“ erklärt Dr. Robert Naderi, Mitautor der Studie. Berücksichtigt man Faktoren wie Einkommen oder Kinderzahl, gleichen sich die Zufriedenheitswerte zwischen bilokal und monolokal Lebenden weitgehend an. „Paarbeziehungen mit getrennten Haushalten bieten die Möglichkeit, Autonomie und Partnerschaft zu vereinen, und tragen trotz räumlicher Trennung zur höheren Lebenszufriedenheit bei“, fasst Naderi zusammen.
Dieser Text basiert auf folgender Publikation:
Rüger, Heiko; Naderi, Robert (2025): Bilokale Paarbeziehungen in Deutschland: Häufigkeit, Gründe und Zufriedenheit. In: BiB.Aktuell 9/2025. https:www.bib.bund.de/Publikation/2025/BiB-Aktuell-2025-9
Quelle: Pressemitteilung Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 19.11.2025
Hans-Böckler-Stiftung: Einkommensungleichheit seit 2018 weiter angestiegen – Vertrauen in staatliche Institutionen sinkt mit Einkommen
Seit 2010 ist die Ungleichheit der Einkommen in Deutschland deutlich gestiegen, ab 2018 hat sich der Zuwachs an Ungleichheit noch einmal spürbar beschleunigt und nach den aktuellsten verfügbaren Daten des Sozio-ökonomischen Panels einen neuen Höchststand erreicht. Die Quote der Menschen, die in Armut leben, liegt ebenfalls bei einem Höchstwert (detaillierte Daten unten und in den Abbildungen in der pdf-Version dieser PM; Link unten). Einen erheblichen Einfluss hatte, dass die ausgleichende Umverteilungswirkung durch Steuern und Sozialtransfers seit 2010 tendenziell abgenommen hat. Insgesamt haben somit Personen mit niedrigen Einkommen von der relativ positiven Wirtschafts- und Einkommensentwicklung im vergangenen Jahrzehnt oft nur vergleichsweise wenig abbekommen – auch wenn der gesetzliche Mindestlohn durchaus einen positiven Einfluss bei den Erwerbs- und damit auch bei den verfügbaren Einkommen hatte. Zudem sind solche Menschen von den Krisen seit 2020 am stärksten betroffen. Zu diesen Ergebnissen kommt der neue Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.*
Parallel zur wachsenden wirtschaftlichen Ungleichheit nimmt laut der Studie die gesellschaftliche Polarisierung zu. Dabei zeigen sich deutliche Zusammenhänge auf mehreren Ebenen: Je niedriger das Einkommen ist, desto geringer fällt etwa das Vertrauen in staatliche und demokratische Institutionen aus. So vertraut knapp ein Viertel bzw. knapp ein Drittel der Erwerbspersonen unterhalb der Armutsgrenze Polizei oder Gerichten nicht oder nur in geringem Maße. Auch bei Angehörigen der unteren Mittelschicht ist die Skepsis erheblich (siehe auch Abbildung 1 in der pdf-Version). Und obwohl die Beteiligung bei der Bundestagswahl 2025 in allen Einkommensgruppen deutlich höher war als bei den Bundestagswahlen davor, lag sie auch dieses Mal mit sinkendem Einkommen niedriger. Schaut man auf die konkrete Wahlentscheidung, haben Erwerbspersonen, die in Armut leben, ihre Stimme überdurchschnittlich oft der AfD oder der Linken gegeben (Abbildung 2 in der pdf-Version; Link unten).
„Steigt die Ungleichheit der Einkommen, steigt gleichzeitig auch die Ungleichverteilung der Teilhabemöglichkeiten. Die Frage, wie sich die Konzentration der Einkommen entwickelt, hat somit eine eminent gesellschaftspolitische Bedeutung“, interpretiert Dr. Dorothee Spannagel, WSI-Verteilungsexpertin und Studienautorin, die Befunde. Das gelte gerade für die jüngste Entwicklung: Allein zwischen 2018 und 2022, dem aktuellsten Jahr, für das im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) Einkommensdaten vorliegen, ist der Gini-Koeffizient, der bekannteste statistische Indikator für Einkommensungleichheit, um gut sechs Prozent gestiegen (siehe auch Abbildung 3). „Das ist eine starke Zunahme, und dieser Trend wird durch Ergebnisse anderer Indikatoren unterstrichen“, sagt die WSI-Forscherin. Im Ergebnis hat die statistisch gemessene Einkommensungleichheit in Deutschland den höchsten Stand erreicht, seitdem das SOEP 1984 eingeführt wurde. Diese jährlich vom DIW Berlin durchgeführte Panelbefragung in 22.000 Haushalten ist eine maßgebliche Datenquelle für die Einkommenserhebung in Deutschland und den neuen Verteilungsbericht. Zudem stützt sich Spannagel auf die Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung, für die seit 2020 regelmäßig 5.000 bis 7.500 Erwerbstätige und Arbeitsuchende befragt werden – zuletzt nach der Bundestagswahl im März 2025.
„Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz spricht von einer globalen Ungleichheitskrise. Eine Variante sehen wir zunehmend deutlich auch bei uns in Deutschland. Wenn es eine soziale Marktwirtschaft nicht schafft, ihr Teilhabe- und Fairnessversprechen einzuhalten, ist das hoch problematisch für ihre Akzeptanz – und auch für die Akzeptanz unserer Demokratie“, ordnet Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des WSI, die Studienergebnisse ein. „Geradezu fatal ist es, wenn wirtschaftlich Mächtige und politisch Verantwortliche daraus die genau falschen Schlüsse ziehen. Mehr Einzelkämpfertum statt Miteinander, neue Hürden für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch deregulierte Arbeitszeiten, Abbau sozialer Rechte und sozialer Sicherung, Erleichterungen vor allem für Wohlhabende – das wird die Probleme unserer Gesellschaft nicht lösen, sondern verschärfen“, sagt die Soziologin. „Stattdessen sollten wir uns auf unsere Stärken besinnen und bewährte Arrangements erneuern, die leider erodiert sind. Dazu zählen Tarifverträge als praxisnahe, fair verhandelte und verbindliche Regeln im Arbeitsleben. Dazu zählt ein tragfähiges soziales Netz, das auch Mut dazu macht, sich auf Wandel und Transformation einzulassen, und eine leistungsfähige öffentliche Infrastruktur, von funktionierenden Verkehrswegen und bezahlbarer Energie bis zum Bildungs- und dem Gesundheitssystem. Und dazu zählt eine fairere Steuerpolitik, die Privilegierungen für sehr hohe Vermögen abbaut. Etwa durch weniger Schlupflöcher für Superreiche bei der Erbschaftsteuer und die Wiedereinführung der Vermögensteuer.“
In den Mittelpunkt des Verteilungsberichts 2025 stellt WSI-Expertin Spannagel die Einkommensentwicklung und insbesondere die Trends bei „armen“ und „reichen“ Haushalten. Dabei orientiert sie sich an in der Wissenschaft etablierten Maßstäben: Haushalte in Armut sind die mit Einkommen unterhalb von 60 Prozent des mittleren (Median-)Einkommens. Das Medianeinkommen entspricht beispielsweise einem jährlichen Nettoeinkommen von 25.732 Euro für eine alleinlebende Person, die Armutsgrenze liegt dementsprechend bei 15.439 Euro für eine alleinlebende Person. Haushalte, die über weniger als 50 Prozent Pressedienst · 20.11.2025 · Seite 3 von 11 des Medianeinkommens verfügen (12.866 Euro), leben in „strenger Armut“. Auf der anderen Seite der Verteilungsskala finden sich Haushalte mit mehr als 200 Prozent des Medianeinkommens. Ab dieser Grenze, die aktuell bei knapp 51.500 Euro netto für einen Single liegt, gilt ein Haushalt als einkommensreich. Sind es mehr als 300 Prozent, spricht man von großem Einkommensreichtum. Haushalte mit Einkommen oberhalb von 60 bis unterhalb von 200 Prozent des Medians werden zur Mittelschicht gezählt. Dabei geht es jeweils um das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen, das heißt nach Abrechnung von Steuern und Abgaben und Hinzurechnung von Transfers. Haushalte unterschiedlicher Größe werden über eine sogenannte Äquivalenzgewichtung auf Basis einer OECD-Skala vergleichbar gemacht.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
– Ungleichheit der Einkommen auf Höchststand –
Wie gleich oder ungleich die Einkommen verteilt sind, lässt sich über mehrere statistische Maße ermitteln. Das in der Wissenschaft am häufigsten verwendete ist der so genannte Gini-Koeffizient. Der „Gini“ reicht theoretisch von null bis eins: Beim Wert null hätten alle Menschen in Deutschland das gleiche Einkommen, bei eins würde das gesamte Einkommen im Land auf eine einzige Person entfallen. Diese Bandbreite macht deutlich, dass auch vermeintlich kleine Änderungen des Koeffizienten erhebliche Bedeutung haben. In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren gab es bereits einen deutlichen Zuwachs der Einkommensungleichheit in Deutschland, der auch im internationalen Vergleich enorm stark ausfiel. Danach verharrte der Wert einige Zeit auf dem erhöhten Niveau. Die Auswertung der neuesten verfügbaren SOEP-Daten im Verteilungsbericht zeigt, dass sich der Anstieg der Ungleichheit ab 2010 dann weiter fortgesetzt hat – in leichten Wellenbewegungen, aber insgesamt mit eindeutiger Tendenz und ab 2018 deutlich beschleunigt: 2010 lag der Gini-Wert noch bei 0,282. Bis 2022 kletterte er auf einen neuen Höchststand von 0,310 (Abbildung 3 in der pdf-Version dieser PM).
Der Trend zu mehr Ungleichheit zeigt sich unabhängig von der Fluchtmigration im letzten Jahrzehnt, er fällt allerdings schwächer aus, wenn man die Einkommensdaten geflüchteter Menschen bei der statistischen Analyse ausklammert. Tut man das, zeigt sich auf niedrigerem Niveau ebenfalls ein deutlicher Anstieg des Gini-Wertes.
Der sogenannte Theil-Index reagiert insbesondere auf Veränderungen am unteren Rand der Einkommensverteilung. Dagegen bildet der Palma-Index, das dritte statistische Maß, das WSI-Forscherin Spannagel berechnet hat, die Entwicklung am oberen Rand stärker ab. Auch diese beiden Indizes signalisieren von 2010 bis 2022, dass die Ungleichheit zugenommen und einen neuen Spitzenwert erreicht hat (Abbildung 4). Dabei ist der Theil-Index relativ stärker gestiegen als der Palma Index. Das deutet darauf hin, dass das vor allem an einer schwächeren Entwicklung niedriger Einkommen lag, die gegenüber den übrigen zurückgeblieben sind.
– Armut gewachsen, Reichtum relativ stabil, untere Mitte bröckelt –
Deutlich zugenommen hat seit 2010 auch die Einkommensarmut. Die Quote armer Haushalte stieg bis 2022, ebenfalls mit einzelnen Schwankungen, von 14,4 auf 17,7 Prozent (Abbildung 5). Auch bei der Armutsentwicklung war Fluchtmigration ein bedeutender Faktor, aber der Trend nach oben zeigt sich auch hier unabhängig davon, betont Forscherin Spannagel. Relativ noch stärker breitete sich „strenge“ Armut aus: 2010 waren 7,9 Prozent aller Haushalte davon betroffen, 2022 bereits 11,8 Prozent.
Weniger hat sich hingegen beim Anteil der einkommensreichen Haushalte in Deutschland verändert: Deren Quote stieg von 7,6 Prozent 2010 zwischenzeitlich leicht auf gut acht Prozent und sank dann, mit einigen Schwankungen, auf 7,2 Prozent im Jahr 2022. Der Anteil der sehr einkommensreichen Haushalte blieb stabil, er lag 2010 bei 1,9 und 2022 bei 2,0 Prozent.
Auch bei einem genaueren Blick auf die Mittelschicht zeigt sich „oben“ mehr Konstanz als „unten“: Ein Einkommen von 100 bis knapp unter 200 Prozent des Medians hatten über den gesamten Untersuchungszeitraum rund 42 Prozent der Haushalte. Dagegen wurde die „untere Mitte“ (über 60 bis unter 100 Prozent) etwas kleiner – der Anteil sank von 35,6 auf 32,3 Prozent. „Damit legen die Daten nahe, dass sich die untere Mitte vor allem verkleinert hat, weil Menschen in Armut abgerutscht sind, weniger, weil sie in die obere Mitte aufgestiegen sind“, schreibt Verteilungsexpertin Spannagel.
– Arme sind häufiger kritisch gegenüber Institutionen, gehen seltener zur Wahl –
Eine schwierige finanzielle Situation geht häufig einher mit Frustrationen und Verunsicherung. Das wiederum spiegelt sich auch in der Identifikation mit staatlichen und demokratischen Institutionen, in der politischen Beteiligung und bei Wahlentscheidungen wider. Bei allen drei Punkten, für die die Erwerbspersonenbefragung Daten aus dem März 2025 liefert, zeigen sich „deutliche Bruchlinien zwischen den Einkommensgruppen“, so die Forscherin.
Ein klarer Zusammenhang zur wirtschaftlichen Situation zeigt sich etwa beim Misstrauen gegenüber der Polizei, das zwischen knapp 24 Prozent unter Menschen in Armut und knapp neun Prozent unter Menschen in einkommensreichen Haushalten variiert – die übrigen Einkommensgruppen liegen zwischen diesen Werten. Sogar knapp 32 Prozent der Armen setzen kein oder nur geringes Vertrauen in Gerichte, unter den Reichen gilt das für gut elf Prozent. Misstrauisch gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien sind gut die Hälfte (51 Prozent) der Armen und gut 31 Prozent der Reichen. Gegenüber der Bundesregierung äußerten im März 61 bzw. 32 Prozent kein oder nur wenig Vertrauen.
Grundsätzlich ähnlich ist das Muster bei der Wahlbeteiligung: Sie sinkt ebenfalls mit dem Einkommen. Allerdings hat sich die Lücke bei der Bundestagswahl 2025 gegenüber dem Urnengang 2021 deutlich verkleinert. Dabei kam die laut der Erwerbspersonenbefragung erheblich gestiegene Beteiligung von ärmeren Menschen vor allem AfD und Linken zu Gute. Die beiden Parteien werden generell von Wähler*innen mit niedrigen Einkommen stärker gewählt als von Wähler*innen mit mehr Geld. Ein ähnliches Muster, aber weit weniger deutlich ausgeprägt, lässt sich noch bei SPD und BSW beobachten, während der Zusammenhang bei Union, Grünen und FDP in die andere Richtung geht.
– Drei Schwerpunkte gegen die materielle und politische Spaltung –
Die Daten zeigten, dass bei beschleunigt wachsender Ungleichheit „gesellschaftliche Spannungslinien stärker hervortreten“, warnt Spannagel. Auch andere Studien machten deutlich, dass „objektive Benachteiligungen, vor allem aber die Wahrnehmung `politischer Deprivation“, also das Gefühl, von politischen Akteuren marginalisiert zu werden, systematisch mit antidemokratischen Einstellungen und geringem politischen Vertrauen zusammenhängen.“ Um wachsender Ungleichheit, Armut und politischer Polarisierung gegenzusteuern, hebt die Wissenschaftlerin drei Maßnahmenkomplexe hervor:
Stärkung guter Erwerbsarbeit: Eine gut bezahlte, sichere Integration in den Arbeitsmarkt, wo gewünscht in Vollzeit, sei einer der Schlüssel, um die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen zu sichern, betont die Expertin. Die Rahmenbedingungen dafür gebe es längst: sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit Tarifvertrag. Eine passgenaue Qualifizierung und maßgeschneiderte Beratung von Menschen an den prekären Rändern des Arbeitsmarktes wäre ein weiterer Baustein – und würde dazu beitragen, in Zeiten des demografischen Wandels dringend benötigte Arbeitskräftepotenziale zu heben. Das gelte auch für alle Maßnahmen, die der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. Denn sie erleichtern Alleinerziehenden den Zugang zu angemessener Beschäftigung und ermöglichen Paarhausalten, vor allem mit Kindern, den Arbeitsumfang auszuweiten – für zahlreiche Haushalte ein Weg aus der Armut.
Stärkung der materiellen Teilhabe: Eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt und eine verlässliche soziale Sicherung seien keine Gegensätze, sondern sie ergänzten einander, betont die Verteilungsexpertin. Sowohl die Rentenzahlungen als auch die Leistungen der (neuen) Grundsicherung müssten Menschen eine grundlegende gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. In die falsche Richtung führten vor diesem Hintergrund die geplanten Nullrunden bei den Regelbedarfsleistungen und das Regierungsvorhaben, den „Vermittlungsvorrang“ wieder einzuführen, also das Prinzip: Die schnelle Vermittlung in womöglich nur kurzzeitige Erwerbstätigkeit hat Vorrang vor der nachhaltigen Sicherung einer angemessenen Erwerbstätigkeit, etwa durch Qualifizierung.
Stärkere Besteuerung höchster Einkommen und Vermögen: Eine Erhöhung der Steuern für Top-Verdiener*innen, vor allem aber für Menschen mit Topvermögen, ist nach Spannagels Analyse gleich aus zwei Gründen relevant: zum einen als Einnahmequelle für die öffentliche Hand, zum anderen, um dem Ungerechtigkeitsempfinden vieler Menschen entgegenzutreten. Zu den sinnvollen Instrumenten zählt Spannagel, den Spitzensteuersatz anzuheben und die derzeitige pauschale Abgeltungssteuer von 25 Prozent in die progressive Einkommenssteuer einzugliedern. In Zeiten knapper Kassen müssten Superreiche mehr zur Finanzierung des Gemeinwohls beitragen. „Dazu gehört auch die angemessene Besteuerung sehr hoher Erbschaften – wobei `Omas Häuschen´ selbstverständlich weiterhin steuerfrei zu übertragen sein muss“, betont Spannagel – und die Wiederaufnahme der Vermögenssteuer.
Quelle: Pressemitteilung Hans-Böckler-Stiftung vom 20.11.2025
IAB: Immer mehr Beschäftigte arbeiten in Neben- und Teilzeitjobs
Rund 4,72 Millionen Beschäftigte in Deutschland gingen im dritten Quartal 2025 einer Nebentätigkeit nach – eine Steigerung von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zudem erreicht die Teilzeitquote mit 40,1 Prozent den höchsten Wert in einem dritten Quartal. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.
Demnach übten 11,2 Prozent aller Beschäftigten neben ihrem Hauptjob noch eine Nebentätigkeit aus. Bezogen auf alle beschäftigten Arbeitnehmer*innen wurden pro Person mit 8,2 Stunden 0,2 mehr Arbeitsstunden in Nebenjobs geleistet als im Vorjahresquartal. Die Entwicklung folgt damit dem langfristigen Aufwärtstrend.
Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg im dritten Quartal 2025 um 1,0 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal, die der Vollzeitbeschäftigten hingegen sank um 0,7 Prozent. Die Teilzeitquote nahm um 0,4 Prozentpunkte zu und lag damit bei 40,1 Prozent. Der Anstieg der Teilzeitquote liegt auch an einem Beschäftigungszuwachs gerade in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie Erziehung und Unterricht und einem Beschäftigungsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe mit einem hohen Vollzeitanteil.
Im Durchschnitt leisteten Beschäftigte 3,1 bezahlte und 3,9 unbezahlte Überstunden. Dies entspricht einem Rückgang um 0,1 beziehungsweise 0,2 Stunden gegenüber dem Vorjahresquartal.
Die Zahl der Erwerbstätigen blieb mit 46 Millionen Personen im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu gleich. Saison- und kalenderbereinigt zeigt sich ein Absinken um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Auch das Arbeitsvolumen blieb mit 15,7 Milliarden Stunden im Vergleich zum Vorjahresquartal fast unverändert. Saison- und kalenderbereinigt stieg es um 0,1 Prozent minimal gegenüber dem Vorquartal.
„Die Flaute im deutschen Arbeitsmarkt hält weiter an: Aufwärts geht es nur bei Nebenjobs und Teilzeitquote“, so Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.
Datengrundlage
Die IAB-Arbeitszeitrechnung ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde. Im August 2024 gab es eine Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes. In diesem Zusammenhang hat das IAB seine Arbeitszeitrechnung weiterentwickelt. Dabei wurden neue Daten und Methoden berücksichtigt und die Berechnungen für den Zeitraum ab 1991 entsprechend neu vorgenommen. Die auf diese Weise ermittelten Zeitreihen erlauben somit weiterhin den langfristigen Vergleich der Arbeitszeitentwicklung ohne statistische Brüche. Eine detaillierte Darstellung der Revisionspunkte der IAB-Arbeitszeitrechnung wurde am 24.09.2024 im IAB-Forschungsbericht 20/2024 veröffentlicht.
Eine Tabelle zur Entwicklung der Arbeitszeit steht im Internet unter https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/tab_az2503.xlsx zur Verfügung. Eine lange Zeitreihe mit den Quartals- und Jahreszahlen ab 1991 ist unter https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/AZ_Komponenten.xlsx abrufbar.
Quelle: Pressemitteilung Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) vom 02.12.2025
Statistisches Bundesamt: Anteil der Jobs mit Niedriglohn im April 2025 unverändert bei 16 %
- Niedriglohnschwelle lag im April 2025 bei 14,32 Euro
- Niedriglohnanteil im Branchenvergleich im Gastgewerbe am höchsten
- Besserverdienende hatten im April 2025 einen fast dreimal höheren Bruttostundenlohn als Geringverdienende
Rund 6,3 Millionen Jobs zählten im April 2025 zum Niedriglohnsektor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag der Anteil der niedrigentlohnten Jobs an allen Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland wie im Vorjahr unverändert bei 16 %. Zuvor sank die Niedriglohnquote innerhalb von 10 Jahren von 21 % im April 2014 auf 16 % im April 2024, wobei der stärkste Rückgang zwischen April 2022 und April 2023 erfolgte. In diesem Zeitraum sank der Anteil der Jobs unterhalb der Niedriglohnschwelle an allen Beschäftigungsverhältnissen um 3 Prozentpunkte von 19 % auf 16 %. Eine Erklärung ist der Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns in diesem Zeitraum von 9,82 Euro auf 12,00 Euro.
Zum Niedriglohnsektor zählen alle Beschäftigungsverhältnisse (ohne Auszubildende), die mit weniger als zwei Drittel des mittleren Bruttostundenverdienstes ohne Sonderzahlungen entlohnt werden. Diese sogenannte Niedriglohnschwelle lag im April 2025 bei 14,32 Euro. 2024 hatte sie bei 13,79 Euro gelegen.
Jeder zweite Job im Gastgewerbe im Niedriglohnbereich
Gut die Hälfte aller Beschäftigungsverhältnisse (51 %) im Gastgewerbe lag im April 2025 im Niedriglohnsektor. Weit überdurchschnittlich war der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten auch in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (45 %) und im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (36 %). In der öffentlichen Verwaltung (2 %), im Sektor für Wasser, Abwasser und Beseitigung von Umweltverschmutzungen (6 %), im Bereich Erziehung und Unterricht (6 %) und in der Finanz- und Versicherungsbranche (6 %) waren die Anteile dagegen am niedrigsten.
Abstand zwischen Gering- und Besserverdienenden bleibt deutschlandweit unverändert
Der Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden – die sogenannte Lohnspreizung – blieb zwischen April 2024 und April 2025 nahezu unverändert.
Die Lohnspreizung ist ein Maß zur Beschreibung der Lohnungleichheit. Hierzu wird der Verdienstabstand zwischen den Geringverdienenden (untere 10 % der Lohnskala) und Besserverdienenden (obere 10 %) gemessen. Konkret wird der Bruttostundenverdienst des 9. Dezils, ab dem eine Person zu den Besserverdienenden zählt (2025: 39,65 Euro), ins Verhältnis gesetzt zum Verdienst des 1. Dezils, bis zu dem eine Person als geringverdienend gilt (2025: 13,46 Euro).
Besserverdienende erzielten 2025 das 2,95-Fache des Bruttostundenverdienstes von Geringverdienenden. Zwischen April 2024 und April 2025 war der Anstieg des 1. Dezils mit +3,5 % und der Anstieg des mittleren Bruttostundenverdienstes (Median) mit +3,9 % allerdings höher als der Zuwachs beim 9. Dezil mit +1,5 %. Zum Vergleich: Der gesetzliche Mindestlohn stieg in diesem Zeitraum um 3,3 %.
Methodische Hinweise:
Bei den Angaben handelt es sich um Ergebnisse der Verdiensterhebung für April 2025, in der mit einer geschichteten Stichprobe von 58 000 Betrieben Angaben zu Verdiensten und Arbeitszeiten der abhängig Beschäftigten erhoben werden. Verglichen wurden die Angaben mit den Ergebnissen der Verdiensterhebung für April 2024.
Zum Niedriglohnsektor zählen alle Beschäftigungsverhältnisse, die mit weniger als zwei Drittel des mittleren Verdienstes ohne Sonderzahlungen (Median) entlohnt werden. Der Median lag im April 2025 bei 21,48 Euro je Stunde und im April 2024 bei 20,68 Euro je Stunde. Auszubildende werden bei dieser Analyse ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse zu Beschäftigungsverhältnissen unterhalb der Niedriglohngrenze (z. B. nach Branchen) bietet die Themenseite „Mindestlohn“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dort ist auch eine Tabelle zur Lohnspreizung zu finden.
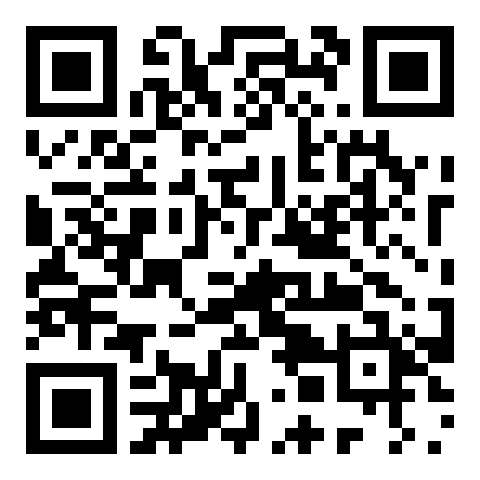
+++
Daten und Fakten für den Alltag:
Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 05.12.2025
INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN
AWO zum Internationalen Tag des Ehrenamts: Politik muss Engagement schützen
Zum heutigen Internationalen Tag des Ehrenamtes hebt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in einer gemeinsamen Untersuchung mit NABU und ISS die besondere Bedeutung des Engagements in Verbänden und Mitgliederorganisationen für die Zivilgesellschaft hervor. Dazu erklärt Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt:
„Zu diesem Tag gilt unser Dank allen ehrenamtlich Engagierten. Ihr Einsatz hält im wahrsten Sinne unsere Gesellschaft zusammen. Wo Menschen sich einbringen, Verantwortung übernehmen und vor Ort gemeinsam Lösungen entwickeln, wird Demokratie konkret erlebbar. Verbände und Vereine bleiben dafür trotz aller gesellschaftlicher Krisen und Veränderungen zentrale Orte. Sie fördern Teilhabe und gegenseitiges Vertrauen – so machen sie unsere Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Krisen und demokratiefeindliche Hetze.“
Damit Verbände wie die AWO auch in Zukunft attraktiv, handlungsfähig und offen für neue Formen des Mitmachens bleiben, müssen sie bereit sein, die Perspektiven zu wechseln und neue Wege zu gehen. Die gerade veröffentlichte Studie „Jenseits der Gewohnheit. Mitgliedschaft, Macht und Wandel neu denken“ bietet hierfür wichtige Impulse. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund (NABU) und dem Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) hat die AWO darüber nachgedacht, welche eigenen Hürden echten Veränderungsprozessen im Wege stehen und mehr Vielfalt im Engagement verhindern.
Gleichzeitig zeigt der aktuelle Freiwilligensurvey: Mehr als die Hälfte aller Engagierten wirkt in einem Verein oder Verband mit, besonders im sozialen Bereich. Die Erfahrungen der AWO bestätigen dies: „Bei der AWO erleben wir täglich, wie tragend soziales Engagement ist“, so Sonnenholzner, „Zugleich sehen wir mit Sorge, dass die Belastungen für Engagierte wachsen, besonders dort, wo staatliche Daseinsfürsorge bröckelt – zum Beispiel im ländlichen Raum. Das Ehrenamt darf nicht zum dauerhaften Ersatz für erodierende öffentliche Infrastruktur werden. Wenn freiwilliges Engagement staatliche Aufgaben auffangen muss, überfordert das die Menschen und gefährdet langfristig die Stabilität des Ehrenamts. Wir brauchen deshalb endlich ein Demokratiefördergesetz für eine verlässliche, starke Förderung von Engagement und sozialer Infrastruktur, denn eine resiliente Demokratie braucht starke Engagementstrukturen.”
Zur Studie „Jenseits der Gewohnheit. Mitgliedschaft, Macht und Wandel neu denken“: https://www.awo-nr.de/awo/aktuelles/detail/mitgliederverbaende-im-wandel-neue-publikation-jetzt-verfuegbar
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 05.12.2025
AWO-Zitat zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen
Zum heutigen Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen erklärt Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt:
„Eine inklusive Gesellschaft ist barriere- und diskriminierungsfrei. Davon ist Deutschland leider in vielen Bereichen noch sehr weit entfernt. Deswegen fordert die AWO die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen auf, ihren Verpflichtungen gegenüber Menschen mit Behinderungen nachzukommen und die Barrierefreiheit und den Diskriminierungsschutz in Deutschland voranzutreiben. Aktuell sehen wir vor allem die Bundesregierung in der Pflicht: Der vorliegende Referentenentwurf für das Behindertengleichstellungsgesetz ist im Kern eine bittere Enttäuschung und bleibt hinter bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen, den Versprechen der letzten Jahre und den Erwartungen der Betroffenen zurück, denn: Die Reform drückt sich vor einer umfänglichen Verpflichtung privater Unternehmen zur Herstellung von Barrierefreiheit – ein Armutszeugnis.“
Menschen mit Behinderungen sind vielerorts durch mangelnde Barrierefreiheit stark in ihrer selbstbestimmten Lebensgestaltung eingeschränkt: Ob ein Termin in der Arztpraxis, ein Essen im Restaurant oder der vorweihnachtliche Besuch auf einem Weihnachtsmarkt: Für viele Menschen mit Behinderungen sind diese Orte aufgrund zahlreicher Barrieren unerreichbar, weil private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen – im Gegensatz zu öffentlichen Einrichtungen – von den meisten Regelungen zur Herstellung von Barrierefreiheit ausgenommen sind. Die AWO fordert daher seit mehreren Jahren eine entsprechende Verpflichtung, damit Menschen mit Behinderungen ihren Alltag gleichberechtigt gestalten können.
Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen findet in diesem Jahr zum 33. Mal statt. Ziel des Tages ist es, auf der ganzen Welt das Bewusstsein für die Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit Behinderungen zu schärfen. Der diesjährige Tag steht unter dem Motto „Förderung inklusiver Gesellschaften für den sozialen Fortschritt“.
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 03.12.2025
AWO: Asylpolitik: AWO appelliert an Innenministerkonferenz – keine Entscheidungen auf Kosten Schutzsuchender
Zum Auftakt der 224. Innenministerkonferenz richtet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) einen dringenden Appell an die verantwortlichen Minister*innen der Länder: Die nationale Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) muss sich konsequent an Menschenwürde, Fachstandards und Rechtsstaatlichkeit orientieren.
Die AWO veröffentlicht hierzu heute einen offenen Brief an die Innenminister*innen der Länder. Darin macht der Bundesverband deutlich, dass die kommenden Wochen entscheidend dafür sind, welche konkreten Folgen die europäische Reform für Geflüchtete in Deutschland haben wird.
Als einer der größten Träger sozialer Beratung und Unterstützung für Migrant*innen und Geflüchtete formuliert die AWO drei zentrale Forderungen an die Landespolitik:
1. Bewegungseinschränkungen für Schutzsuchende ausschließen
Die derzeit geplanten Einrichtungen für Sekundärmigrationsverfahren bergen das Risiko haftähnlicher Bedingungen und zusätzlicher Belastungen für die Bewohner*innen. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit dürfen keinen Platz finden.
2. Besondere Schutzbedarfe fachlich – nicht polizeilich – feststellen
Die Vulnerabilitätsprüfung ist ein sensibler sozialfachlicher Prozess. Sie muss von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, nicht von Polizeikräften. Auch die Altersfeststellung gehört in die Jugendhilfe.
3. Gewaltschutz in Unterkünften verbindlich stärken
Die bundesweit entwickelten Mindeststandards zum Schutz geflüchteter Menschen müssen umgesetzt und mit klaren Zuständigkeiten, fester Finanzierung und der Expertise zivilgesellschaftlicher Angebote unterlegt werden.
Michael Groß, Präsident der AWO, erklärt dazu: „Die Länder tragen jetzt Verantwortung dafür, das neue Asylsystem im Rahmen ihrer Möglichkeiten so menschenwürdig wie möglich umzusetzen. Wir erwarten, dass Schutzsuchende nicht in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden und dass sensible Verfahren nicht an die Polizei delegiert werden. Deutschland darf hier nicht den Weg der Abschottung gehen, sondern zeigen, dass ein geordnetes Asylsystem und Humanität kein Widerspruch sind.“
Die AWO betont, dass die Umsetzung des GEAS nur gelingen kann, wenn Länder und Kommunen frühzeitig klare fachliche Standards verankern und die Perspektive der sozialen Arbeit ernsthaft einbeziehen.
Der offene Brief ist unter folgendem Link zum Herunterladen verfügbar:https://awo.org/wp-content/uploads/Pressemeldungen/2025/20251201_offener-Brief-IMK.pdf
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 01.12.2025
AWO legt Stellungnahme vor und fordert “antifaschistische Sozialpolitik”
In ihrer heute veröffentlichten Stellungnahme zur “Neuen Grundsicherung” warnt die Arbeiterwohlfahrt vor einem schwerwiegenden Angriff auf den Sozialstaat. Statt soziale Rechte abzubauen, brauche es ein neues Verständnis für die Bedeutung des Sozialstaats für die Demokratie.
Auf über 30 Seiten legt die AWO in ihrer Stellungnahme dar, welche Risiken die Reform für Betroffene birgt. “Die sogenannte ‘Neue Grundsicherung’ wird ihrem Namen in keiner Weise gerecht: Statt Menschen in schweren Lebenslagen Sicherheit zu geben, drängt sie sie in noch größere Not, Überforderung und im schlimmsten Fall in die Wohnungslosigkeit”, resümiert AWO-Präsident Groß die Einschätzung des Verbands zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. “In unseren Schuldnerberatungen, bei unseren Arbeitsmarktträgern und in vielen weiteren Einrichtungen treffen wir als AWO jeden Tag auf Menschen, die arm oder armutsgefährdet sind. Was diese Menschen brauchen, sind nicht härtere Sanktionen und Drohkulissen, sondern Vertrauen und Unterstützung auf ihrem Weg in gute Arbeit. Wir brauchen Instrumente, die den sozialen Aufstieg ermöglichen und nicht weiter ausbremsen.”
Aus Sicht der AWO stellt der Rückbau sozialer Rechte aber nicht nur die Betroffenen vor unzumutbare Härten. Auch die demokratische Grundordnung gerate in Gefahr, so Michael Groß: “Die Menschen in Deutschland erwarten zurecht, dass ihnen in schwierigen Situationen die Solidarität der Gesellschaft zuteil wird – das ist das Versprechen unseres Sozialstaats. Wer diese Erwartung enttäuscht und die Leute auch noch in vermeintlich ‘Leistungslose’ und ‘Fleißige’ aufteilt – wie es das Sanktionsregime der ‘Neuen Grundsicherung’ vorsieht – der verspielt Vertrauen in die Demokratie.” Um diesem Vertrauensverlust entgegenzuwirken, braucht es aus Sicht der AWO einen Sozialstaat, der sich um die Nöte der Menschen kümmert und ihnen vorurteilsfrei begegnet.
“Armutsfest, einfach, diskriminierungsfrei – das ist es, was wir unter ‘antifaschistischer Sozialpolitik’ verstehen. Denn eine Politik, die sich an diesen Zielen ausrichtet, führt uns zusammen, statt uns zu spalten und Rechtspopulisten in die Arme zu treiben”, so AWO-Präsident Groß.
Die ausführliche Stellungnahme des AWO Bundesverband e.V. zum Referentenentwurf zur Neuen Grundsicherung finden Sie unter folgendem Link: https://awo.org/position/stellungnahme-neue-grundsicherung/
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 21.11.2025
AWO: „Kein Herbst des sozialen Rückschritts“: Arbeiterwohlfahrt beschließt politische Ausrichtung
Vom 14. bis 16. November tagte die Bundeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt in Erfurt. Über 320 Delegierte aus ganz Deutschland berieten 198 Anträge und fassten dabei zentrale Beschlüsse für die politische und soziale Arbeit des Wohlfahrtsverbandes in den nächsten vier Jahren. Im Zentrum der Debatten standen der Einsatz für einen starken Sozialstaat und gegen Armut sowie der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus.
„Der Herbst der Reformen darf kein Herbst des sozialen Rückschritts werden“, erklärte AWO-Präsident Michael Groß zu einer von den Delegierten einstimmig beschlossenen Resolution. „Für uns ist klar: Wir werden uns der Agenda der Sozialkürzungen und des Rückbaus der sozialen Sicherheit, die die Bundesregierung verfolgt, entschieden widersetzen“. In der Resolution positioniert sich die AWO unter anderem gegen Leistungskürzungen und härtere Sanktionen im Bürgergeld. „Unsere Vorschläge orientieren sich nicht an vermeintlichen Einsparzielen auf dem Rücken der Ärmsten, sondern daran, Ungleichheit zu beenden und sozialen Aufstieg zu ermöglichen“, so Groß weiter. „Ich freue mich daher, dass wir als AWO heute die Forderung nach kostenlosem Mittagessen in allen Kindertagesstätten, Schulen und Ausbildungsstätten erhoben haben!“
In ihrer Rede vor der Bundeskonferenz dankte Bundessozialministerin Bärbel Bas der AWO für ihren unermüdlichen Einsatz für Gerechtigkeit und Solidarität: „Wer den Sozialstaat rasieren will, hat mich zur Gegnerin! Unser Sozialstaat ist nicht nur ein Sicherheitsnetz – er ist das Rückgrat unserer Demokratie. Wo Menschen sich sicher fühlen, wo sie wissen, dass niemand durch das Raster fällt, da wächst Vertrauen. Das ist es, was Hass und Hetze die Kraft nimmt. Sozialpolitik ist also immer auch Demokratiepolitik – das habt Ihr besser verstanden als viele andere im Land!“
Neben der Sozialstaatsdebatte beschäftigte die Delegierten auch der Einsatz für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit. Zu einer Resolution zu diesem Thema erklärte AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner: „Antisemitismus und Rassismus haben keinen Platz in unserer freien, demokratischen Gesellschaft. Mit großer Sorge müssen wir beobachten, wie menschenfeindliche Rhetorik und Gewalt von Jahr zu Jahr zunehmen – und immer salonfähiger werden. Wir stehen geschlossen zur Brandmauer und gegen alle, die sie angreifen.“
Die zentrale Rolle, die die Arbeiterwohlfahrt für eine nachhaltige, soziale Gesellschaft spielt, betonte auch Bundeskanzler Friedrich Merz in seinem Video-Grußwort an die Delegierten: „In diesen Zeiten kommt es mehr denn je darauf an, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen. Dass wir vorangehen, ohne jemanden zurückzulassen. Wir freuen uns, dass wir bei den großen Aufgaben, die vor uns liegen, die AWO an unserer Seite haben. Wir brauchen die Arbeiterwohlfahrt als konstruktiv-kritischen Partner der Politik.”
Vor Ort zu Gast waren neben der Bundessozialministerin auch der Thüringer Ministerpräsident Voigt, die Thüringer Sozialministerin Schenk sowie Erfurts Oberbürgermeister Horn.
Mario Voigt, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen: „Die AWO ist einer der großen Player in der Wohlfahrtspflege und auch für viele Thüringerinnen und Thüringer entscheidende soziale Stütze. Das Motto der diesjährigen Tagung ‚Demokratie.Macht.Zukunft‘ trifft den Nerv der Zeit. Denn auch wenn sich unsere Gesellschaft und auch unser Sozialstaat in einem stetigen Wandel befinden, gilt: Ein demokratisches und solidarisches Miteinander bleibt tragendes Fundament unserer Zukunft als Gesellschaft. Die AWO setzt mit ihrer Arbeit ein klares Zeichen dafür, dass soziale Daseinsvorsorge und gesellschaftlicher Zusammenhalt keine abstrakten Ziele sind, sondern täglich erfahrbare Realität – und nicht zuletzt Herzensangelegenheit der vielen in der AWO Engagierten in Haupt- und Ehrenamt.“
Katharina Schenk, Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie: „Die großen sozialpolitischen Fragen unserer Zeit – Rente, Pflege, Fachkräftemangel – lassen sich nur gemeinsam beantworten. Was es heißt, den Sozialstaat mitzugestalten, zeigt die AWO in Deutschland seit über einem Jahrhundert, seit 35 Jahren auch in Thüringen – pragmatisch, menschlich und zukunftsorientiert. Es braucht genau diese Mischung aus fachlicher Kompetenz und gesellschaftlichem Engagement, um einen handlungsfähigen, gerechten und solidarischen Sozialstaat zu sichern.“
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 16.11.2025
AWO-Präsident*innen im Amt bestätigt: Michael Groß und Kathrin Sonnenholzner wiedergewählt
Auf der ordentlichen Bundeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt in Erfurt haben die Delegierten die Vorsitzenden des Präsidiums, Michael Groß und Kathrin Sonnenholzner, im Amt bestätigt.
Wiedergewählt wurden auch die stellvertretenden Vorsitzenden Britta Altenkamp, Rudi Frick, Gabriele Siebert-Paul und Stefan Wolfshörndl. Ebenfalls gewählt wurden die 13 Beisitzer*innen des Präsidiums.
Die Arbeiterwohlfahrt gratuliert allen Gewählten zur Wahl und wünscht für die vierjährige Amtszeit eine glückliche Hand.
Die Bundeskonferenz ist das höchste Beschlussgremium der Arbeiterwohlfahrt. Sie tagt alle vier Jahre.
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 15.11.2025
DGB: Alarmierender Anstieg: Mehr Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen
Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember sagte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied:
„Die aktuelle wirtschaftliche Lage trifft Menschen mit Behinderungen und Langzeiterkrankte leider besonders hart; sie werden nicht nur vielfach aus Betrieben gedrängt, sondern haben es auch besonders schwer, wieder in Arbeit zu kommen. Viele Menschen mit Behinderungen sind trotz ihrer guten Qualifikationen nachweislich länger arbeitslos als Menschen ohne Behinderung.
Dieses arbeitsmarktpolitische Armutszeugnis muss die Bundesregierung antreiben, Schutzlücken zu schließen. Solange Betriebe versuchen, Beschäftigte mit Behinderungen über Aufhebungsverträge loszuwerden, umgehen Arbeitgeber vorsätzlich den besonderen Kündigungsschutz oder die vorgeschriebene Wiedereingliederung nach längeren Erkrankungen.
Der DGB fordert deshalb: Die Schwerbehindertenvertretung muss einfach bei allen personellen Entscheidungen zwingend beteiligt werden, sonst dürfen sie nicht gelten. Was für eine Kündigung ohne Information und Anhörung der Schwerbehindertenvertretung gilt, muss endlich auch für Aufhebungsverträge gelten – alles darf erst mit der Begleitung wirksam werden.
Darüber hinaus braucht es für Langzeiterkrankte einen Rechtsanspruch auf ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Wer nach einer langen, schweren Erkrankung wieder arbeiten möchte, darf nicht länger mit einem Aufhebungsvertrag vom Hof geschickt werden.
Das alles fordern wir als Gewerkschaften, weil Gleichberechtigte Teilhabe an Arbeit ein Menschenrecht ist – so steht es in der UN-Behindertenrechtskonvention.
Wir streiten solange dafür, bis dieses Recht in den Betrieben endlich konsequent durchgesetzt wird.“
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 02.12.2025
Diakonie Deutschland: „Zukunftspakt Pflege“ muss Weichen für eine nachhaltige Finanzierung und Versorgung stellen
Die Diakonie Deutschland erwartet von den für heute angekündigten Eckpunkten der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ Antworten auf die drängenden Fragen der Finanzierung und der Versorgungssicherheit in der Pflege. Die Eckpunkte stecken den Rahmen für eine Pflegereform im kommenden Jahr ab.
Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: „Die verlässliche Finanzierung der Pflegeversicherung muss jetzt geregelt werden. Die häusliche Pflege sollte gestärkt und pflegende Angehörige müssen entlastet werden. Klar ist: Die Kosten für die Pflege werden in den nächsten Jahren steigen, weil die Menschen immer älter werden und viele auch länger pflegebedürftig sind.“
Verschiedenen Berechnungen des Bundesgesundheitsministeriums kann man entnehmen, dass der Beitragssatz zur Pflegeversicherung bis 2030 um ein bis eineinhalb Prozent ansteigen könnte. „Die Politik sollte alles tun, um diesen Anstieg zu bremsen“, so Ronneberger. Als Sofortmaßnahme fordert die Diakonie Deutschland die vollständige Erstattung der Corona-Hilfen aus dem Bundeshaushalt. Das verschaffe der Pflegeversicherung in den nächsten beiden wirtschaftlich entscheidenden Jahren die nötige Stabilität. Anstelle einer Erhöhung des Beitragssatzes sollte die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung angehoben werden. Außerdem müsse der Bund der Pflegeversicherung die versicherungsfremden Leistungen erstatten. „Ohne einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt ist der Beitragsanstieg in der Pflegeversicherung nicht zu bremsen“, so Ronneberger.
Besonders wichtig sei eine bessere Versorgung bei Pflegenotfällen. Die Diakonie begrüßt entsprechende Reformvorschläge, mahnt aber die Finanzierung von Vorhaltekosten und Kurzzeitpflegeplätzen an. Parallel arbeite man mit den anderen Wohlfahrtsverbänden an einem Pflegenotfall-Telefon.
Ein besonderes Augenmerk solle die Bundesregierung auf die Digitalisierung der Pflege legen. „Tele-Pflege kann vor allem im ländlichen Raum Versorgungsengpässe abfedern. Videokommunikation ist derzeit eines der wichtigsten Nutzungsfelder der Digitalisierung. Damit das gelingt, müssen jetzt verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die geplanten Maßnahmen bleiben hier weit hinter den Erwartungen zurück“, so Ronneberger.
Kritisch sieht die Diakonie Deutschland auch die blockierte Investitionsförderung der Länder. Sie könnte Eigenanteile senken und die Modernisierung der Pflegeinfrastruktur beschleunigen.
Von den Kommunen erwartet Ronneberger mehr Engagement bei präventiven Hausbesuchen: „Wer ältere Menschen früh erreicht, kann Pflegebedürftigkeit deutlich verkürzen.“ Die geplante Aufwertung der kommunalen Pflegeplanung aufgrund besserer Daten sei aus diakonischer Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Die Pflegeplanung müsse verbindlich werden, damit die Kommunen hierfür Ressourcen einsetzen.
Für Interviews und O-Töne im Zusammenhang mit dem Abschlussbericht stehen Diakonie-Bundesvorständin Sozialpolitik Elke Ronneberger sowie Dr. Peter Bartmann, Leitung des Zentrums für Gesundheit, Rehabilitation und Pflege, gerne zur Verfügung.
Wir machen uns stark für eine große Pflegereform
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Diakonie Deutschland vom 11.12.2025
Diakonie zur neuen Grundsicherung: Rückschritt auf Kosten der Schwächsten
Die Bundesregierung hat einen Entwurf für eine neue Grundsicherung vorgelegt. Sie will eine effektivere Ausgestaltung der Sozialleistungen erreichen. Die Diakonie Deutschland bezweifelt, dass die neue Grundsicherung dabei hilft. „Ein großer Teil der Leistungsberechtigten muss sehr große Hürden überwinden, um sich selbstständig finanzieren zu können. Gründe dafür sind zum Beispiel persönliche Probleme, Lücken in der Ausbildung oder gesundheitliche Einschränkungen. Solche Barrieren lassen sich nicht einfach durch mehr Druck beiseiteschieben, sondern müssen aktiv bearbeitet werden. Dazu sind gezielte Maßnahmen zur sozialen und arbeitsmarktpolitischen Integration nötig: Menschen müssen in die Lage versetzt werden, ihr Leben langfristig selbstständig zu finanzieren“, erklärt Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland. Die Neuregelung stelle hingegen eine Abkehr von einer Unterstützung und Begleitung dieser Menschen auf Augenhöhe dar. Sie beende den von der Diakonie Deutschland mit der Einführung des Bürgergeldes begrüßten Paradigmenwechsel im Sozialgesetzbuch II.
Zwar könne von Leistungsberechtigten Mitarbeit und Mitwirkung eingefordert werden, so Schuch. „Kürzungen und Sanktionen treffen jedoch besonders Menschen mit psychischen Belastungen, Sprachbarrieren oder in persönlichen Krisen. Hier muss die jeweilige Lebenssituation berücksichtigt werden.“ Das Versprechen von Ausnahmen bei Sanktionen helfe wenig, weil die Betroffenen entsprechende Nachweise oft nicht schnell genug erbringen könnten, da sie häufig sehr lange auf psychologische Unterstützung warten müssten.
Wie der aktuelle Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung zeigt, nimmt fast die Hälfte aller Leistungsberechtigten ihre Ansprüche nicht wahr. Gründe dafür sind Scham, Angst vor Kontrolle oder mangelnde Kenntnis. „Nur wer sich traut, seinen Anspruch geltend zu machen, ist auch für Unterstützungsangebote erreichbar. Hier brauchen wir einen schnelleren und unbürokratischen Zugang. Besondere Hilfen am Arbeitsmarkt sind zwar gesetzlich vorgesehen, aber nicht ausreichend finanziert. Gezielte Investitionen in Begleitung, Integration und die Stärkung sozialer Teilhabe sind nötig. Hier muss die Koalition nachbessern.“
Kritisch sieht die Diakonie Deutschland außerdem die Kürzungen bei den Wohnkostenzuschüssen. „Diese Regelungen ignorieren die Realität auf dem angespannten Wohnungsmarkt und fördern Wohnungslosigkeit“, so Schuch.
Stellungnahme der Diakonie Deutschland zum Referentenentwurf „Neue Grundsicherung“
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Diakonie Deutschland vom 20.11.2025
djb: Gesetzesentwurf gegen Menschenhandel: djb warnt vor Vermischung von Sexarbeit und sexualisierter Gewalt
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) hat in einer aktuellen Stellungnahme zum Gesetzesentwurf des Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz zur Stärkung der strafrechtlichen Verfolgung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung zentrale Verbesserungen begrüßt, zugleich aber deutlichen Reformbedarf angemahnt. Entscheidend ist, dass der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung als Leitprinzip ernst genommen und durchgängig umgesetzt wird.
„Der Entwurf enthält wichtige Impulse, bleibt aber beim konsequenten Schutz der sexuellen Selbstbestimmung hinter internationalen und verfassungsrechtlichen Anforderungen zurück“, erklärt djb-Präsidentin Prof. Dr. Susanne Baer.
Der djb kritisiert, dass der Entwurf kein Gesamtkonzept für ein konsensbasiertes Sexualstrafrecht erkennen lässt. Deutschland muss die Vorgaben der Istanbul-Konvention endlich umfassend umsetzen, sodass jede nicht einverständliche sexuelle Handlung strafbar ist. Zudem problematisiert der djb, dass zentrale Begriffe, z.B. Zwangsprostitution, oft falsch eingesetzt werden und so Konsens und Gewalt vermischen. Mit Blick auf die neuen Straftatbestände warnt der djb vor Widersprüchen zum Prostituiertenschutzgesetz. Außerdem beanstandet der djb die begriffliche Einbettung von Minderjährigen in den Bereich „Ausbeutung in der Prostitution“, die verschleiert, dass es sich um sexuellen Missbrauch handelt.
Erneut betont der djb die Gefahren hinter einem pauschalen Sexkaufverbot. „Ein solches Verbot kriminalisiert selbstbestimmte Sexarbeit und verhindert nicht Ausbeutung, sondern verschärft sie häufig. Stattdessen braucht es ein regulatorisches Modell, das Rechte von Sexarbeiter*innen schützt, Ausstiegswege sichert und geschlechterbezogene Ungleichheiten berücksichtigt“, betont Dilken Çelebi, Vorsitzende der Strafrechtskommission im djb.
Ein wirksamer Opferschutz setzt ein konsensbasiertes Gesamtkonzept voraus – mit präzisen Begriffen, klarer Gesetzgebung ohne Widersprüche und einer an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierten Strafverfolgung. Dafür braucht es auch flankierende Reformen in der Strafprozessordnung und im Aufenthaltsrecht.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) vom 01.12.2025
djb: EuGH stärkt Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen – djb begrüßt Urteil
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) begrüßt das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Anerkennung einer gleichgeschlechtlichen Ehe in Polen (EuGH, Urteil vom 25.11.2025 – C-713/23). Der Gerichtshof bestätigt damit: EU-Mitgliedstaaten müssen eine im EU-Ausland rechtswirksam geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe zweier Unionsbürger*innen anerkennen. Dies ist ein wichtiger Schritt für mehr Rechtssicherheit und Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare in Europa.
„Die Entscheidung stellt klar, dass gleichgeschlechtliche Paare auf das Recht setzen können. Auch ihre Ehe ist in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union geschützt. Das ist gelebte demokratische Rechtsstaatlichkeit, und darauf kann Europa stolz sein,“ betont Prof. Dr. Susanne Baer, Präsidentin des djb.
Dem Verfahren lag der Fall eines deutsch-polnischen und eines polnischen Staatsangehörigen zugrunde, die 2018 in Deutschland eine Ehe geschlossen hatten und anschließend ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Polen begründen wollten. Das Standesamt in Warschau verweigerte die Anerkennung der Ehe. Der EuGH hat nun klargestellt, dass eine solche Verweigerung einen Eingriff in das europäische Recht der Freizügigkeit darstellt, weil sie zu schwerwiegenden Nachteilen führen kann. Unionsbürger*innen können ihr Recht auf Freizügigkeit nur sinnvoll ausüben, wenn ihnen ein kontinuierliches Familienleben garantiert bleibt – unabhängig davon, in welchem Unionsmitgliedstaat sie leben.
„Der EuGH hat alle von Polen vorgebrachten Argumente verworfen. Damit stärkt das Gericht den Grundrechtsschutz in der EU und setzt das Recht auf Freizügigkeit effektiv durch“, erklärt Valentina Chiofalo, Vorsitzende der Kommission Europa- und Völkerrecht des djb.
Prof. Dr. Anna Lena Göttsche, Vorsitzende der djb-Familienrechtskommission, hebt hervor: „Der EuGH stellt – im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – erneut klar, dass der grund- und menschenrechtliche Schutz des Privat- und Familienlebens für gleich- und verschiedengeschlechtliche Paare gleichermaßen gilt.“
Der EuGH lässt den Mitgliedstaaten weiterhin Spielräume bei der Ausgestaltung ihres Familienrechts. Sie sind aus EU-Recht etwa nicht verpflichtet, eine Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare zu ermöglichen. Der Fall verdeutlicht aber einmal mehr die Grenzen eines diskriminierenden Familienrechts. Insofern ist das Urteil auch ein erneutes Signal an den deutschen Gesetzgeber, sein Familienrecht nach der Einführung der „Ehe für alle“ endlich auch bei den Ehewirkungen im Abstammungsrecht eigeninitiativ auf die Höhe der Zeit zu bringen – nicht nur über die Anerkennung von im Ausland begründeten Familien, sondern diskriminierungsfrei auch für alle Familien, die in Deutschland entstehen.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) vom 28.11.2025
DKHW: „Kinderrechte-Index 2025“ – Deutsches Kinderhilfswerk sieht großen Nachholbedarf bei Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
Der „Kinderrechte-Index 2025“ des Deutschen Kinderhilfswerkes zeigt, dass es bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland noch großen Nachholbedarf gibt. Im Gesamtergebnis schneiden Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen überdurchschnittlich ab. Dies bedeutet, dass in diesen Bundesländern die Kinderrechte vergleichsweise am besten umgesetzt werden. Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen liegen im Durchschnitt. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt sind insgesamt unterdurchschnittlich eingeordnet.
Dem „Kinderrechte-Index 2025“ des Deutschen Kinderhilfswerkes liegen 101 Kinderrechte-Indikatoren zugrunde, die basierend auf der UN-Kinderrechtskonvention gemeinsam mit einem interdisziplinär zusammengesetzten Wissenschaftlichen Beirat auf der Basis des ersten Kinderrechte-Index 2019 fortgeschrieben oder neu entwickelt wurden. Dabei wurden sechs Kinderrechte in den Mittelpunkt gestellt: das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Schutz, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Bildung und das Recht auf Ruhe und Freizeit, Spiel und Erholung sowie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.
- Bei der Umsetzung des Rechts auf Beteiligung, das sowohl die politische Partizipation, Fragen einer kindgerechten Justiz als auch die Beteiligung in Bildungsinstitutionen in den Blick nimmt, schneiden Bremen, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen überdurchschnittlich ab.
- Das Recht auf Schutz, das neben dem präventiven Kinderschutz auch die Meldung und Behandlung von Kinderschutzfällen beinhaltet, setzen Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vergleichsweise am besten um.
- In Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Sachsen und Thüringen wird das Recht auf Gesundheit, das im Kinderrechte-Index sowohl den Zugang zum Gesundheitssystem als auch Prävention und Gesundheitsförderung umfasst, am besten umgesetzt.
- Bei der Umsetzung des Rechts auf angemessenen Lebensstandard als eine Voraussetzung für die gute körperliche, geistige, seelische und soziale Entwicklung des Kindes schneiden Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen vergleichsweise am besten ab.
- Das Recht auf Bildung auf der Grundlage der Bildungsinfrastruktur, der Chancengleichheit sowie der Vermittlung von Bildungsinhalten und -zielen setzen Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen am besten um.
- In Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen wird das Recht auf Ruhe und Freizeit, Spiel und Erholung sowie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben als ein entscheidendes Kriterium für die Qualität der Kindheit und für eine optimale Entwicklung und die Förderung der Widerstandsfähigkeit, vergleichsweise am besten umgesetzt.
Der Index untersucht die Situation von Kindern und Jugendlichen in den Bundesländern und zeigt so vor allem die kinderrechtlichen Entwicklungsbedarfe, aber auch Beispiele guter Umsetzung in den einzelnen Bundesländern auf. Damit ist der „Kinderrechte-Index 2025“ des Deutschen Kinderhilfswerkes ein Instrument insbesondere für Landesregierungen, die Stärken und Schwächen ihrer Kinder- und Jugendpolitik zu überprüfen und diese gezielt zu verbessern.
„Der Kinderrechte-Index 2025 des Deutschen Kinderhilfswerkes zeigt ganz deutlich auf, dass die Chancen der jungen Menschen in unserem Land nicht nur aufgrund ihres Elternhauses, sondern auch regional sehr unterschiedlich verteilt sind. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen kann insbesondere bezogen auf die Kinderrechte keine Rede sein. Der Wohnort entscheidet vielfach darüber, inwiefern Kinderrechte verwirklicht werden: etwa durch frühkindliche Bildungsangebote, Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Kommune oder in der Schule und im Verein, durch eine ausreichende ärztliche Versorgung, die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit oder funktionierende Kinderschutzsysteme. 33 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland stehen wir im Hinblick auf die Kinderrechte weiterhin vor einem föderalen Flickenteppich. Hier gilt es für jedes Bundesland, auf Grundlage der vielen Beispiele guter Praxis in den anderen Bundesländern ihre kinderrechtlichen Bemühungen zu verstärken. Dabei zeigt der Kinderrechte-Index 2025 ganz deutlich, dass die Umsetzung der Kinderrechte an vielen Stellen keine alleinige Frage der Kassenlage, sondern vielmehr des politischen Willens ist“, betont Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes und Leiterin des Wissenschaftlichen Beirates zum Kinderrechte-Index.
„In mehreren Bereichen gab es in den letzten Jahren Fortschritte. So haben seit dem ersten Kinderrechte-Index 2019 einige Bundesländer Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche gesetzlich gestärkt, Landeskinderschutzstrategien entwickelt oder Programme gegen Kinderarmut gestartet. Aber kein Bundesland setzt die Kinderrechte umfassend um, hier ist noch viel Luft nach oben. So braucht es in allen Bundesländern eine ressortübergreifende Kinder- und Jugendpolitik und damit einhergehend Strategien für die Umsetzung der Kinderrechte. Das gilt insbesondere für die Kinder- und Jugendbeteiligung und die langfristige Förderung von Beteiligungsstrukturen“, so Lütkes weiter.
„Auch die psychosoziale und mentale Gesundheit von Kindern muss flächendeckend gestärkt werden, beispielsweise durch den Ausbau von Vorsorge- und Hilfsangeboten. Landesstrategien zur Kinderarmutsprävention sollten Standard sein, kommunale Präventionsnetzwerke in diesem Bereich aufgebaut und langfristig gefördert werden. Es gilt zudem, Justiz und Verwaltung kindgerechter zu gestalten, etwa durch verbindliche Standards zur Qualifizierung und Fortbildung von Fachkräften in diesem Bereich. Der Kinderrechte-Index hat aber auch gezeigt, dass ein bundesweites, indikatorengestütztes Kinderrechte-Monitoring unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen etabliert werden sollte. Denn in wichtigen Bereichen wie der Gesundheit oder dem Armutserleben von Kindern und Jugendlichen fehlt es an ausreichend aufgeschlüsselten und kontinuierlich erhobenen Daten. Hier ist insbesondere der Bund gefordert mehr langfristige Forschung zu finanzieren und seiner Verpflichtung zur Überwachung der Kinderrechte nachzukommen“, sagt Anne Lütkes.
Der Kinderrechte-Index 2025 des Deutschen Kinderhilfswerkes basiert auf einem Methodenmix. So wurden auf Grundlage von bereits verfügbaren öffentlichen Daten und eigenen Datenerhebungen 101 Kinderrechte-Indikatoren gebildet. Es wurden Analysen zu Rahmenbedingungen wie Gesetzen, Institutionen, Netzwerken und Programmen durchgeführt sowie Daten durch eine repräsentative Umfrage unter 3.218 Kindern und Jugendlichen in den Bundesländern erhoben. Durch schriftliche Befragungen verschiedener Landesministerien aller Bundesländer und in weitergehenden Recherchen werden zudem Beispiele guter Praxis für die Umsetzung von Kinderrechten aufgezeigt. Der Kinderrechte-Index wird ergänzt durch Einschätzungen und Forderungen der Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates des Deutschen Kinderhilfswerkes, der auch an der Schwerpunktsetzung der Studie, der Auswertung der Indikatoren und an der Entwicklung der Kinder- und Jugendumfrage mitgewirkt hat.
Der Kinderrechte-Index 2025 erscheint online. Den zusammenfassenden Studienbericht, die sechs Analysepapiere zu den Teilindizes, Steckbriefe zu den Ergebnissen der einzelnen Bundesländer sowie eine Beschreibung zur Methodik finden Sie unter www.dkhw.de/kinderrechte-index.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. vom 11.12.2025
eaf: Neue Zeitpolitik für Familien mit kleinen Kindern
Mit Dynamischer Familienarbeitszeit win-win-win für Familien, Gesellschaft und Wirtschaft
Viele Mütter wünschen sich, ihre Erwerbsarbeitszeit auszuweiten und viele Väter hätten gerne mehr Zeit für die Kinder. Mit einer Dynamischen Familienarbeitszeit möchte die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) Eltern die Umsetzung ihrer Wünsche erleichtern. Eine heute von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichte Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung mit aktuellen Daten zur Rushhour des Lebens zeigt, dass ein solches zeitpolitisches Angebot für das Leben von Familien viele positive Effekte haben kann.
„Wir wenden uns mit unserer Idee insbesondere an die Väter“, so eaf-Präsident Prof. Dr. Martin Bujard. „Über 70 Prozent von ihnen wünschen sich mehr Zeit für die Familie. Wir möchten sie darin unterstützen, in der Kleinkindzeit ihre Erwerbsarbeit zugunsten von Sorgearbeit zu reduzieren, wie es Mütter bereits seit Jahren tun. Nur wenn Väter früh Verantwortung für Haushalt und Kinder übernehmen, gelingt eine faire Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen den Eltern. Dann haben Mütter bessere Chancen, ihre Arbeitszeit in den verschiedenen Lebensphasen schrittweise wieder zu erhöhen.“
Ihre Eckpunkte für eine solche Dynamische Familienarbeitszeit für die Zeitspanne zwischen Elterngeldende und Einschulung des jüngsten Kindes hatte die eaf bereits 2022 vorgestellt: Elternpaare, bei denen beide in dieser Zeit ihre Erwerbstätigkeit zugunsten von Sorgearbeit einschränken, sollen durch eine staatliche finanzielle Leistung unterstützt werden. Bedingung dafür ist, dass beide Elternteile nur innerhalb eines festgelegten Stundenumfangs erwerbstätig sind. Die eaf wird ihren Vorschlag in Kürze konkretisieren und als Forderung in die Politik tragen.
„Wir sehen hier die Chance auf eine win-win-win-Situation für Wirtschaft, Gesellschaft und Eltern“, erklärt Bujard, der zusammen mit Dr. Leonie Kleinschrot Autor der FES-Analyse ist.
Quelle: Pressemitteilung evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) vom 26.11.2025
Familienbeirat: Familien brauchen bessere Jobchancen und mehr Solidarität
Im Rahmen zweier Familienforen in Kooperation mit dem Familienzentrum der Lauterbach-Schulen in Reinickendorf kam der Berliner Beirat für Familienfragen mit Eltern, Schulkindern und Fachkräften ins Gespräch. Ein zentrales Ergebnis: Besonders Mütter, Alleinerziehende und Eltern mit Migrationserfahrung stehen vor großen Hürden auf dem Arbeitsmarkt.
Vor allem Mütter berichteten von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Trotz vorhandener Qualifikationen finden viele von ihnen keinen Zugang zu existenzsichernder Arbeit. Unflexible Arbeitszeiten und fehlende Kinderbetreuung in den Randzeiten verhindern die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten oder Sprachkursen. Gleichzeitig erschwert häufig die mangelnde Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse den beruflichen (Wieder-)Einstieg.
Die Eltern äußerten klar den Wunsch nach fair bezahlten Jobs jenseits klassischer Hilfstätigkeiten, besseren Chancen auf berufliche Qualifizierung und einem Arbeitsmarkt, der ihre familiäre Realität berücksichtigt. Im Austausch wurden weitere zentrale Problemlagen deutlich:
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Schichtarbeit, lange Arbeitswege oder die Betreuung von Angehörigen mit Beeinträchtigung bringen viele Familien an ihre Grenzen. Es fehlt an flexiblen Arbeitszeitmodellen und niedrigschwelligen Entlastungsangeboten.
- Alltagsbelastung und finanzielle Unsicherheit
Steigende Lebenshaltungskosten, Wohnungsmangel und lange Bearbeitungszeiten bei Sozialleistungen führen zu wachsenden Existenzängsten und dauerhafter Überforderung.
- Personalmangel in Schule und Hort
Eltern berichteten von fehlenden Fachkräften und mangelnder individueller Förderung an den Schulen ¬ mit direkten Folgen für die Bildungschancen ihrer Kinder.
- Sozialer Zusammenhalt und Diskriminierung
Diskriminierungserfahrungen etwa aufgrund des Kopftuchs oder einer Beeinträchtigung sind für viele Familien Realität. In den Gesprächen an der Reinickendorfer Schule war der Wunsch nach mehr Respekt und einem solidarischen Miteinander deutlich spürbar.
Kazım Erdoğan, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen: „Familien stemmen tagtäglich enorme Belastungen – zwischen Arbeit, Sorge, Schule und Existenzsicherung. Damit Kinder gute Chancen haben und gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingt, müssen Politik und Verwaltung Familien konsequent entlasten und ihre Lebensrealität ins Zentrum des Handelns stellen: durch bessere Zugänge zum Arbeitsmarkt, verlässliche und flexible Kinderbetreuung, mehr Personal im Bildungsbereich sowie gezielte Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit und Diskriminierung.“
Die detaillierten Ergebnisse der beiden Familienforen können Sie hier downloaden.
Quelle: Pressemitteilung Berliner Beirat für Familienfragen vom 03.12.2025
LSVD+: Welttag der Menschenrechte
LSVD⁺ fordert Verantwortung der Bundesregierung ein
Heute ist der Welttag der Menschenrechte, der an die Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erinnert. Dazu erklärt Henny Engels für den Bundesvorstand des LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt zur Bedeutung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche sowie weiteren queere Menschen (LSBTIQ*):
Dieses Jahr hat gezeigt, wie rasant der antidemokratische Backlash weltweit voranschreitet. Deutschland trägt eine besondere historische Verantwortung für die Verfolgung von LSBTIQ* und muss sich deswegen – auch weltweit – für den Schutz von LSBTIQ* einsetzen. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr internationales Engagement für die Menschenrechte von LSBTIQ* zu verstärken. Deutschland muss sein Wort halten und die bereits im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms nach Pakistan ausgereisten LSBTIQ* aus Afghanistan retten. Weil der Bedarf für humanitäre Hilfe seit Jahren ansteigt, dürfen die Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit nicht bestehen bleiben. Mindestens 0,5 % der Gelder in der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit müssen in LSBTIQ*-spezifische Projekte fließen. Zudem erwarten wir, dass Deutschland sein Engagement in der Equal Rights Coalition (ERC) fortsetzt und weiter ausbaut. Nur mit klaren politischen Signalen und ausreichenden Ressourcen kann der weltweit zunehmenden Bedrohung für LSBTIQ* wirksam begegnet werden.
Die demokratische Zivilgesellschaft gerät zunehmend unter Druck. Shrinking Spaces schränken ihre Handlungsmöglichkeiten ein: Während autoritäre Denkmuster an Einfluss gewinnen, verliert die Selbstverpflichtung zum Schutz von Menschenrechten an Bedeutung. Besonders deutlich wird dies bei der Menschenwürde von LSBTIQ*-Personen, die in vielen Ländern offen in Frage gestellt wird; unter anderem in Afghanistan, Georgien, Iran, Irak, Russland. In Ghana, Mali, Burkina Faso und Liberia stehen LSBTIQ*-kriminalisierende Gesetzesentwürfe vor der Verabschiedung. In Kasachstan steht ein landesweites Gesetz vor der Verabschiedung, das nach russischem Vorbild sogenannte „LGBTI-Propaganda“ verbieten soll – ohne jede rechtliche Definition und mit potenziell weitreichenden Folgen für LSBTIQ*-Personen, Menschenrechtsverteidiger*innen, Medien, Kunst- und Kulturschaffende sowie den gesamten zivilgesellschaftlichen Raum. Auch innerhalb der EU muss Deutschland deutlicher Position beziehen, nicht nur bei der Bekämpfung von Rollbacks fundamentaler Rechte in anderen Mitgliedstaaten und bei Beitrittskandidaten, sondern auch bei der Aufrechterhaltung internationaler Schutzverpflichtungen, unter anderem bei der Einführung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS).
Weiterlesen:
Quelle: Pressemitteilung LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 10.12.2025
VAMV: Alternativbericht zur Istanbul-Konvention
Das Bündnis Istanbul-Konvention (BIK) hat am 17.11.2025 seinen 2. Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland GREVIO, dem unabhängigen Expert*innengremium des Europarats, vorgelegt und zeigt auf: Es bestehen weiterhin massive Lücken beim Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt.
Auch sieben Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens fehlen in Deutschland eine ressortübergreifende Gesamtstrategie, handlungsfähige Institutionen und die notwendigen Ressourcen, um das Recht aller Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies Leben umzusetzen. Es fehlt zudem an einer klaren Verbindlichkeit bei der bundesweiten Umsetzung der Maßnahmen. Insbesondere für Gruppen, wie Frauen und Mädchen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, mit Behinderungen, diversen geschlechtlichen Identitäten und Wohnungs- und obdachlose Frauen, ist der in der Konvention verankerte Zugang zu Prävention, Schutz, Beratung und Recht nach wie vor mangelhaft. Offen ist auch, gesetzlich sicher zu stellen, dass der Gewaltschutz Vorrang vor dem Umgangsrecht hat.
Quelle: Pressemitteilung Verband alleinerziehender Mütter und Väter,
Bundesverband e.V. (VAMV) vom 20.11.2025
VBM: Studie Elterngeld/ Elternzeit
Elterngeld-Befragung – Erfahrungen aus der Praxis gesucht
In einer aktuellen Befragung wird untersucht, welche Faktoren die Aufteilung von Elternzeit und Elterngeld beeinflussen und wie sich Einkommen und Elterngeld in unterschiedlichen Familienformen auswirken – etwa bei Paaren, Getrennterziehenden oder Alleinerziehenden sowie beim ersten und zweiten Kind.
Die Prognos AG führt die Befragung im Auftrag des Verbands berufstätiger Mütter e. V. (VBM) durch. Ziel ist es, anhand realer Beispiele sichtbar zu machen, ob das heutige Elterngeld bestehende Einkommensunterschiede zwischen Müttern und Vätern verringert oder verstärkt.
Teilnehmen können Eltern, die
+seit 2015 erstmals Elterngeld bezogen haben,
+derzeit kein Elterngeld mehr beziehen und
+vor dem ersten Bezug ausschließlich abhängig beschäftigt waren.
Der Fragebogen umfasst Angaben zur eigenen Person, zur Aufteilung der Elterngeldmonate, zu Einkommen vor, während und nach dem Bezug sowie zur Höhe des Elterngeldes.
Weitere Hinweise und den Fragebogen finden Sie hier: https://survey.prognos.com/index.php/719276
Quelle: Verbands berufstätiger Mütter e. V. (VBM)
WEITERE INFORMATIONEN
FES-Analyse: Eltern in der Rushhour des Lebens entlasten: Die Dynamische Familienarbeitszeit - jetzt verfügbar!

Familien mit kleinen Kindern fehlt vor allem eines: Zeit. Unsere neue Analyse Eltern in der Rushhour des Lebens entlasten: Die Dynamische Familienarbeitszeit zeigt deutlich, wie stark sich Erwerbs- und Sorgearbeit in der „Rushhour des Lebens“ verdichten und wie groß die Lücke zwischen Ideal und Realität ist.
Väter arbeiten häufiger mehr Stunden, als sie wollen. Mütter älterer Kinder reduzieren ihre Erwerbsarbeit stärker, als es ihren eigenen Vorstellungen entspricht. Das Ergebnis: ein hoher Gender-Care und Gender-Working-Time-Gap, der langfristige Ungleichheiten verstärkt.
Die Analyse von Martin Bujard und Leonie Kleinschrot (BiB) macht sichtbar, was sich Eltern wirklich wünschen, und wie die Dynamische Familienarbeitszeit zu einer Verbesserung der partnerschaftlichen Aufteilung beitragen kann.
Gleichstellung intergeschlechtlicher Menschen // Intersex equality in Europe

Am 10. Dezember ist der Internationale Tag der Menschenrechte. Menschenrechte sind dann am stärksten, wenn sie universell gelten. Auch Bestrebungen zur Gleichstellung profitieren von der Solidarität möglichst vieler Menschen.
Intergeschlechtliche Menschen sind besonders stark von Menschenrechtsverletzungen betroffen. So wird beispielsweise ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt, wenn nicht dringliche, medizinische Eingriffe an ihren Geschlechtsmerkmalen im Kindesalter (und damit häufig ohne effektive Einwilligung) vorgenommen werden.
Die Beobachtungsstelle hat sich intensiv mit Fragen der Gleichstellung intergeschlechtlicher Menschen beschäftigt:
- Mit unserer Expertise zur Operationsverbot-Gesetzgebung in Deutschland, Malta und Portugal leisten wir einen inhaltlichen Beitrag zur europaweiten Debatte über den effektiven Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor Menschenrechtsverletzungen.
- Mit unserem Dossier zur Gleichstellung intergeschlechtlicher Personen in Europa fragen wir, wie gut die EU die Menschenrechte intergeschlechtlicher Personen schützt, stellen die Europaratsempfehlung vom Oktober 2025 zum Thema vor und erfahren von politisch Aktiven der Zivilgesellschaft, wo sie Handlungsbedarfe sehen.
- Unsere Infografik stellt die zentralen Aspekte der Europaratsempfehlung kurz vor.
Alle drei Veröffentlichungen sind auf Deutsch und Englisch erschienen und können unter https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/schwerpunktthemen/lgbtiq#89 kostenlos heruntergeladen werden.
Stellenausschreibung der eaf und EEB: Projektkoordinator:in gesucht
Die eaf und EEB suchen zum 1. Januar 2026 ein neues Teammitglied, das sie als Projektkoordinator:in für das Programm „Verstetigung und Qualitätssicherung von Elternbegleitung“ verstärkt. Auf der Website finden Sie die dazu passende Stellenausschreibung.

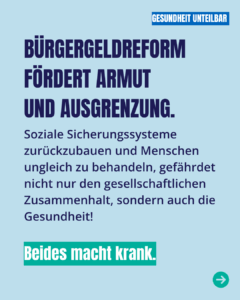
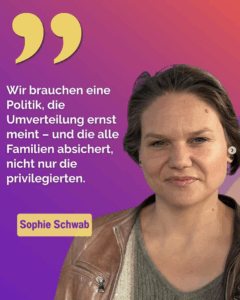
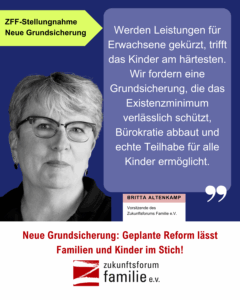
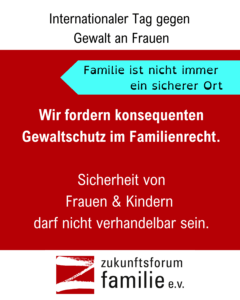
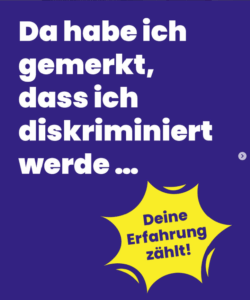
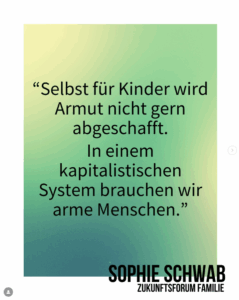
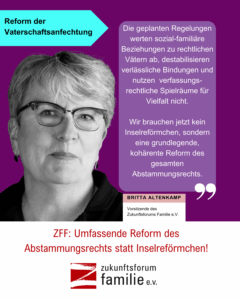
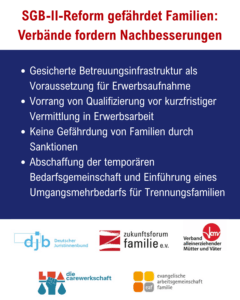


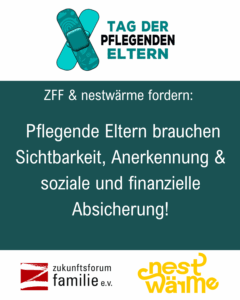
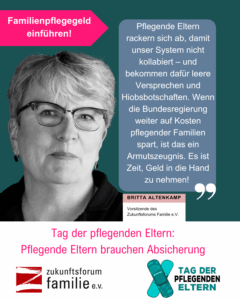

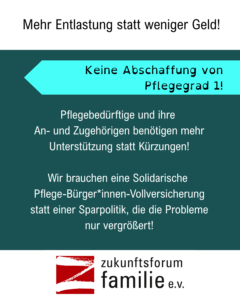
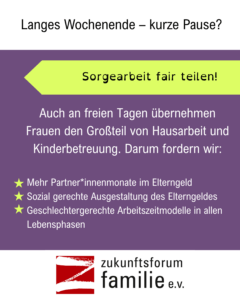


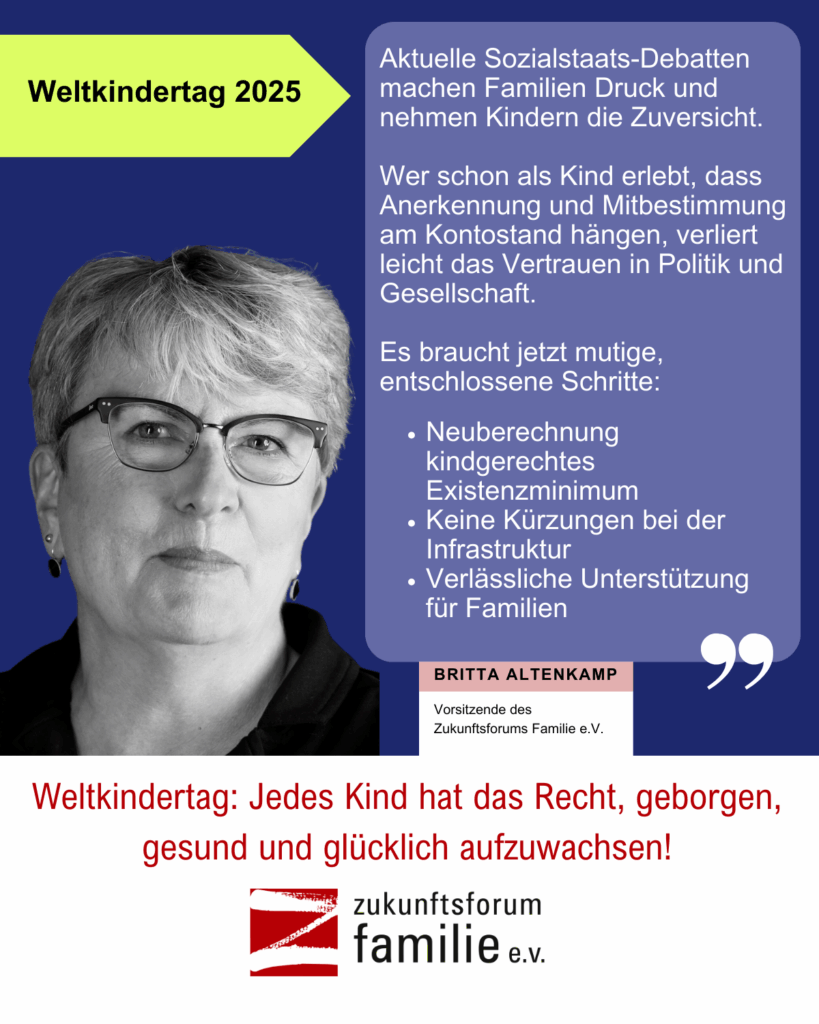
 Termin: 09. Juni 2026
Termin: 09. Juni 2026
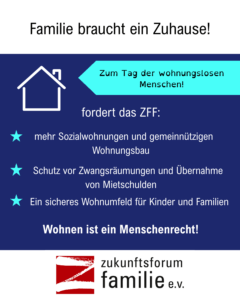
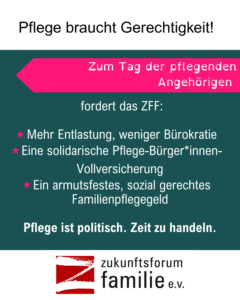
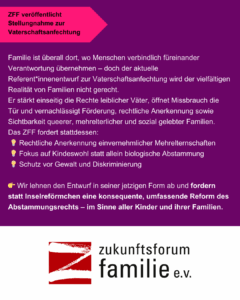

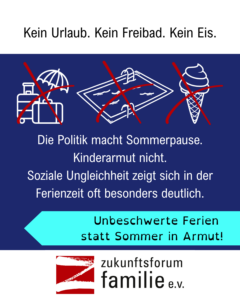


 Zum Arbeitsstart der neuen Bundesregierung äußert sich das Bündnis Sorgearbeit fair teilen zum Koalitionsvertrag: Die Regierung hat sich gleichstellungs-, familien- und wirtschaftspolitische Ziele gesetzt, die das Bündnis begrüßt. Während einige der geplanten Maßnahmen in die richtige Richtung weisen, widersprechen andere der Zielsetzung grundsätzlich.
Zum Arbeitsstart der neuen Bundesregierung äußert sich das Bündnis Sorgearbeit fair teilen zum Koalitionsvertrag: Die Regierung hat sich gleichstellungs-, familien- und wirtschaftspolitische Ziele gesetzt, die das Bündnis begrüßt. Während einige der geplanten Maßnahmen in die richtige Richtung weisen, widersprechen andere der Zielsetzung grundsätzlich.