Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ (20/13183) hat in einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am Montag, 4. November 2024, viel grundsätzliche Zustimmung gefunden. Im Detail gab es aber auch Kritik und Verbesserungsvorschläge.
Hauptbestandteil des Gesetzentwurfes ist die gesetzliche Verankerung der bestehenden Einrichtung der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (Unabhängige Bundesbeauftragte). Zudem ist eine Berichtspflicht für die Unabhängige Bundesbeauftragte zum Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgesehen. Um Betroffene wirksam und verlässlich bei individuellen Aufarbeitungsprozessen zu unterstützen, will der Bund ein Beratungssystem bereitstellen. Es soll ein Beratungsservice finanziert werden, der geeignet ist, die individuelle Aufarbeitung zu fördern und damit die Lebenssituation von Betroffenen zu verbessern. Die Verbindlichkeit des staatlichen Auftrags zur allgemeinen Aufklärung, Sensibilisierung und Qualifizierung soll durch einen gesetzlichen Auftrag an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung konkretisiert werden, heißt es im Entwurf.
Die Unabhängige Beauftragte Kerstin Claus sprach anlässlich der Anhörung von einem Meilenstein. Elementar sei die regelmäßige Berichtspflicht gegenüber Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Damit werde es möglich, Lücken im Beratungs- und Hilfesystem zu adressieren.
Die Präsidentin des Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, forderte wie auch mehrere weitere Sachverständige, zur Erreichung der Ziele des Gesetzentwurfs „die finanziellen und personellen Ressourcen zu stärken“. Das sei bisher nicht in ausreichendem Maße vorgesehen. Die kommunalen Spitzenverbände wiesen in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hin, dass etwa durch das erweiterte Recht der von Missbrauch Betroffenen auf Akteneinsicht bei den Jugendämtern ein Mehraufwand entstehe, für den der Gesetzentwurf keinen finanziellen Ausgleich vorsehe.
Als „verstörend“ bezeichnete der Vorsitzende des Vereins „gegen-missbrauch“, Ingo Fock, die „Begleitdiskussion aus ökonomischen Gründen“. Die Nicht-Aufarbeitung von Missbrauch führe sehr oft dazu, dass Traumatisierte auf Sozialleistungen angewiesen seien. Fock forderte insbesondere, die Fachberatungsstellen finanziell besser auszustatten. Silke Noack von der Nationalen Informations- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend wies auf die Notwendigkeit einer guten Erreichbarkeit von Beratungsangeboten für Betroffene hin, um die Zugangsschwelle niedrig zu halten. Es gebe viel zu wenig Fachberatungsstellen und diese seien damit oft zu weit entfernt. Auch Angela Marquardt, Mitglied des Betroffenenrates bei der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kritisierte eine unzureichende finanzielle Unterlegung des Gesetzentwurfs. „Kostenneutral wird das nicht gehen“, erklärte sie im Blick auf die erweiterten Aufgaben, „Sie können nicht all die Dinge im Ehrenamt leisten“.
Mehrere Sachverständige kritisierten, dass der Bereich, für den ein Recht auf Akteneinsicht geschaffen werden soll, zu eng gefasst ist. So seien zum Beispiel Unterlagen aus Kinderschutzverfahren der Akteneinsicht entzogen, bemängelte Karin Böllert, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Franziska Drohsel, Rechtsreferentin der Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend als Vertretung von rund 360 Beratungsstellen, forderte die Aufnahme eines Zeugnisverweigerungsrechts für Betroffene von Missbrauch in Strafverfahren. Dies würde es vielen erleichtern, eine Beratung aufzusuchen und über das Erlebte zu sprechen.
Der Kinder- und Jugendpsychiater Jörg M. Fegert, der 2010 von der ersten Unabhängigen Beauftragten mit der Begleitforschung beauftragt worden war, forderte eine Berichtspflicht der Unabhängigen Beauftragten nicht nur einmal pro Legislaturperiode, sondern jährlich oder mindestens alle zwei Jahre. Letzteres kristallisierte sich im Verlauf der Anhörung als Konsens heraus.
Mehrere Sachverständige bemängelten so wie der Generalsekretär und Geschäftsführer des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Marc Frings, die vorgesehene Altersgrenze von 50 Jahren für das Recht auf Akteneinsicht. Sehr oft komme das Bedürfnis oder die Bereitschaft zur Aufarbeitung der Jugenderlebnisse erst im höheren Alter. Mehrfach kritisiert wurde auch der Geltungsbereich des geplanten Gesetzes, der sich im Wesentlichen auf staatliche und staatlich geförderte Einrichtungen der Jugendhilfe erstreckt. Der Psychologe Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut erinnerte an das „sehr viel weitergehende“ Schutzkonzept des 2010 einberufenen Runden Tischs Sexueller Kindesmissbrauch, das alle Angebote für Minderjährige bis hin zu Jugendreisen und Musikschulen umfasse.
David Knöß, Ressortleiter Gesellschaftspolitik bei der Deutschen Sportjugend, wies auf das geplante Zentrum für Safe Sport hin, das das Bundesinnenministerium im nächsten Jahr aufbauen wolle. Die Abgeordneten sollten darauf achten, dass hier keine Doppelstrukturen geschaffen werden.
Einhellig war in der Anhörung der Wunsch nach einer zügigen Weiterberatung und Verabschiedung des Gesetzentwurfs. Viele Sachverständige zeigten dafür die Bereitschaft, ihre weitergehenden Vorschläge auf die nächste Legislaturperiode zu vertagen.
Das Video zur Anhörung und die Stellungnahmen der Sachverständigen auf: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13_familie/Anhoerungen/1025656-1025656
Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ (20/13183) hat in einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am Montag, 4. November 2024, viel grundsätzliche Zustimmung gefunden. Im Detail gab es aber auch Kritik und Verbesserungsvorschläge.
Hauptbestandteil des Gesetzentwurfes ist die gesetzliche Verankerung der bestehenden Einrichtung der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (Unabhängige Bundesbeauftragte). Zudem ist eine Berichtspflicht für die Unabhängige Bundesbeauftragte zum Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgesehen. Um Betroffene wirksam und verlässlich bei individuellen Aufarbeitungsprozessen zu unterstützen, will der Bund ein Beratungssystem bereitstellen. Es soll ein Beratungsservice finanziert werden, der geeignet ist, die individuelle Aufarbeitung zu fördern und damit die Lebenssituation von Betroffenen zu verbessern. Die Verbindlichkeit des staatlichen Auftrags zur allgemeinen Aufklärung, Sensibilisierung und Qualifizierung soll durch einen gesetzlichen Auftrag an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung konkretisiert werden, heißt es im Entwurf.
Die Unabhängige Beauftragte Kerstin Claus sprach anlässlich der Anhörung von einem Meilenstein. Elementar sei die regelmäßige Berichtspflicht gegenüber Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Damit werde es möglich, Lücken im Beratungs- und Hilfesystem zu adressieren.
Die Präsidentin des Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, forderte wie auch mehrere weitere Sachverständige, zur Erreichung der Ziele des Gesetzentwurfs „die finanziellen und personellen Ressourcen zu stärken“. Das sei bisher nicht in ausreichendem Maße vorgesehen. Die kommunalen Spitzenverbände wiesen in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hin, dass etwa durch das erweiterte Recht der von Missbrauch Betroffenen auf Akteneinsicht bei den Jugendämtern ein Mehraufwand entstehe, für den der Gesetzentwurf keinen finanziellen Ausgleich vorsehe.
Als „verstörend“ bezeichnete der Vorsitzende des Vereins „gegen-missbrauch“, Ingo Fock, die „Begleitdiskussion aus ökonomischen Gründen“. Die Nicht-Aufarbeitung von Missbrauch führe sehr oft dazu, dass Traumatisierte auf Sozialleistungen angewiesen seien. Fock forderte insbesondere, die Fachberatungsstellen finanziell besser auszustatten. Silke Noack von der Nationalen Informations- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend wies auf die Notwendigkeit einer guten Erreichbarkeit von Beratungsangeboten für Betroffene hin, um die Zugangsschwelle niedrig zu halten. Es gebe viel zu wenig Fachberatungsstellen und diese seien damit oft zu weit entfernt. Auch Angela Marquardt, Mitglied des Betroffenenrates bei der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kritisierte eine unzureichende finanzielle Unterlegung des Gesetzentwurfs. „Kostenneutral wird das nicht gehen“, erklärte sie im Blick auf die erweiterten Aufgaben, „Sie können nicht all die Dinge im Ehrenamt leisten“.
Mehrere Sachverständige kritisierten, dass der Bereich, für den ein Recht auf Akteneinsicht geschaffen werden soll, zu eng gefasst ist. So seien zum Beispiel Unterlagen aus Kinderschutzverfahren der Akteneinsicht entzogen, bemängelte Karin Böllert, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Franziska Drohsel, Rechtsreferentin der Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend als Vertretung von rund 360 Beratungsstellen, forderte die Aufnahme eines Zeugnisverweigerungsrechts für Betroffene von Missbrauch in Strafverfahren. Dies würde es vielen erleichtern, eine Beratung aufzusuchen und über das Erlebte zu sprechen.
Der Kinder- und Jugendpsychiater Jörg M. Fegert, der 2010 von der ersten Unabhängigen Beauftragten mit der Begleitforschung beauftragt worden war, forderte eine Berichtspflicht der Unabhängigen Beauftragten nicht nur einmal pro Legislaturperiode, sondern jährlich oder mindestens alle zwei Jahre. Letzteres kristallisierte sich im Verlauf der Anhörung als Konsens heraus.
Mehrere Sachverständige bemängelten so wie der Generalsekretär und Geschäftsführer des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Marc Frings, die vorgesehene Altersgrenze von 50 Jahren für das Recht auf Akteneinsicht. Sehr oft komme das Bedürfnis oder die Bereitschaft zur Aufarbeitung der Jugenderlebnisse erst im höheren Alter. Mehrfach kritisiert wurde auch der Geltungsbereich des geplanten Gesetzes, der sich im Wesentlichen auf staatliche und staatlich geförderte Einrichtungen der Jugendhilfe erstreckt. Der Psychologe Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut erinnerte an das „sehr viel weitergehende“ Schutzkonzept des 2010 einberufenen Runden Tischs Sexueller Kindesmissbrauch, das alle Angebote für Minderjährige bis hin zu Jugendreisen und Musikschulen umfasse.
David Knöß, Ressortleiter Gesellschaftspolitik bei der Deutschen Sportjugend, wies auf das geplante Zentrum für Safe Sport hin, das das Bundesinnenministerium im nächsten Jahr aufbauen wolle. Die Abgeordneten sollten darauf achten, dass hier keine Doppelstrukturen geschaffen werden.
Einhellig war in der Anhörung der Wunsch nach einer zügigen Weiterberatung und Verabschiedung des Gesetzentwurfs. Viele Sachverständige zeigten dafür die Bereitschaft, ihre weitergehenden Vorschläge auf die nächste Legislaturperiode zu vertagen.
Das Video zur Anhörung und die Stellungnahmen der Sachverständigen auf: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13_familie/Anhoerungen/1025656-1025656
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 752 vom 05.11.2024

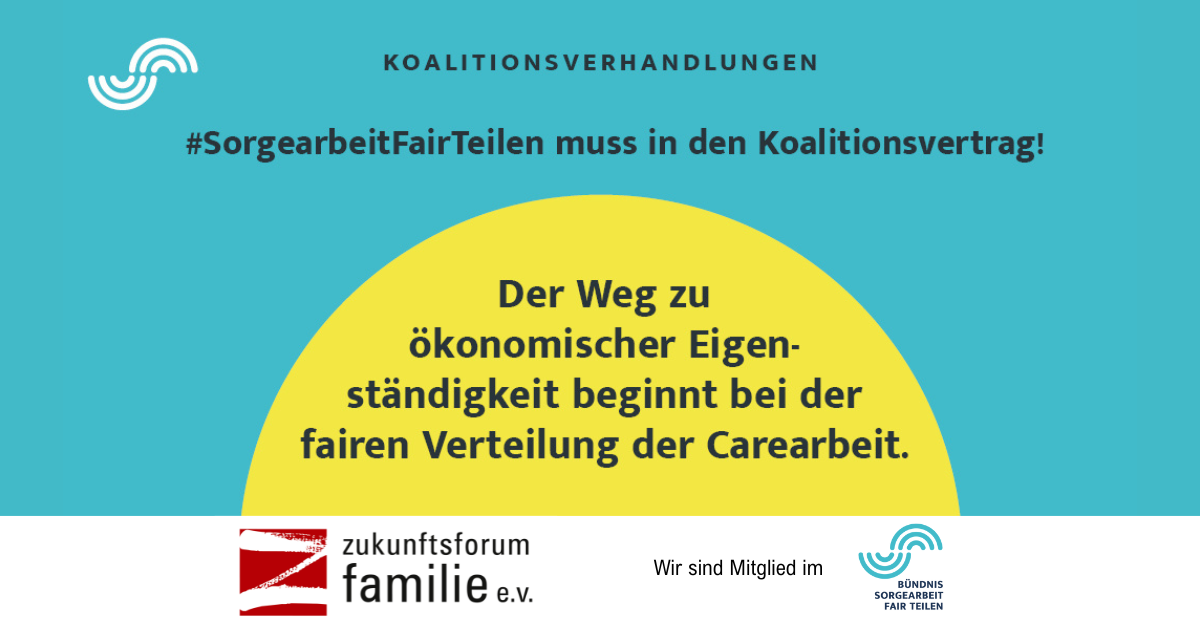
 Das Bündnis Sorgearbeit fair teilen appelliert an die Parteien, die faktische Gleichstellung von Frauen und Männern endlich mit oberster Priorität umzusetzen. Geschlechtergerechtigkeit beginnt mit der fairen Verteilung unbezahlter Sorgearbeit.
Das Bündnis Sorgearbeit fair teilen appelliert an die Parteien, die faktische Gleichstellung von Frauen und Männern endlich mit oberster Priorität umzusetzen. Geschlechtergerechtigkeit beginnt mit der fairen Verteilung unbezahlter Sorgearbeit.



