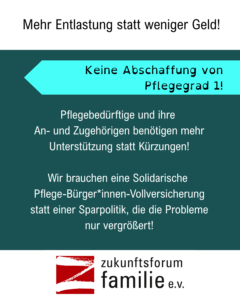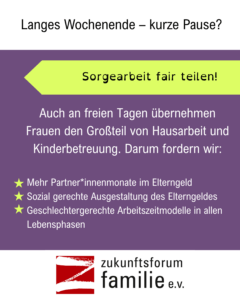AUS DEM ZFF
SCHWERPUNKT: Reform Bürgergeld
Bündnis 90/Die Grünen: Ricarda Lang und Timon Dzienus: Fraktion der Grünen stärkt sozialen Dialog mit Gewerkschaften und Verbänden
Zur Einsetzung des Gewerkschafts- und Sozialbeirats zur neuen Wahlperiode erklären Ricarda Lang, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, und Timon Dzienus, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales:
Ricarda Lang:
„Wir brauchen jetzt eine breite gesellschaftliche Bewegung gegen die soziale Kälte der Regierung. Die angekündigten Kürzungen im Bürgergeld sind Teil eines groß angelegten Angriffs auf den Sozialstaat und auf die Rechte von Beschäftigten. Die Koalition aus Union und SPD lässt arbeitende Menschen im Regen stehen, wir wollen ihr Leben verbessern – mit besseren Löhnen, mehr Mitbestimmung und guten Tarifverträgen.“
Timon Dzienus:
„Der Sozialstaat ist das Bollwerk gegen den Faschismus und eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Während die Regierung ihren Kürzungswahnsinn beim Bürgergeld fortsetzt und vom Ende des 8-Stunden-Tages spricht, suchen wir den Schulterschluss mit Gewerkschaften und Sozialverbänden. Wir wollen ein klares Signal an alle Beschäftigten in diesem Land senden: Mit uns Grünen werden eure Jobs sicherer und euer Leben bezahlbarer. Wir wollen, dass Wohnen endlich wieder bezahlbar und zum Ort von Gemeinschaft wird. Dafür braucht es eine funktionierende Regulierung der Mieten, die dem Mietwucher den Riegel vorschiebt. Für nachhaltige Lösungen suchen wir den Austausch mit den Gewerkschaften und Sozialverbänden.”
Hintergrund: Die Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzt in der neuen Wahlperiode den Gewerkschafts- und Sozialbeirat erneut ein. Das Gremium intensiviert den Austausch mit dem DGB, sieben Einzelgewerkschaften und 15 Wohlfahrtsverbänden, um sich mit kritischen sozialpolitischen Fragen zu befassen und gemeinsam an vorausschauenden Impulsen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu arbeiten. Federführend verantworten die Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang und Timon Dzienus die Neuaufstellung.
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 09.10.2025
AWO warnt vor Angriff auf den Sozialstaat
Nach der Ankündigung der Bundesregierung zur Reform der Grundsicherung zeigt sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO) alarmiert: Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses seien nicht weniger als die Abschaffung des Bürgergelds und ein Angriff auf den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Schärfere Sanktionen bis hin zum kompletten Leistungsentzug, absoluter Vermittlungsvorrang und sogar mögliche Kürzungen bei den Kosten der Unterkunft – die Eckpunkte zur Reform der Grundsicherung bedeuten massive Eingriffe in die soziale Sicherheit von Millionen von Menschen und gehen hinter Hartz IV zurück. Dazu erklärt Michael Groß, Präsident der Arbeiterwohlfahrt:
„Es kann nicht wahr sein, dass der Bundesregierung angesichts all der Krisen, die wir erleben, nichts Besseres einfällt, als schon wieder am Sozialstaat zu sägen. Nicht einmal ein Prozent der Bürgergeld-Empfänger*innen verweigert die Aufnahme von Arbeit. Unter dem Vorwand dieser sogenannten ‚Totalverweigerer‘ nun Millionen von Familien zu bestrafen, geht völlig an der Realität vorbei. Klar ist: In krisenhaften Zeiten muss Zusammenhalt organisiert werden – dafür wären Investitionen in Arbeitsmarktintegration, gute Betreuung und Pflege der richtige Weg. Wenn die Bundesregierung nach Finanzierungsquellen dafür sucht, dann wäre die Bekämpfung von Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, für die sich auch Ministerin Bas einsetzt, ein klügerer Weg als Einsparungen zulasten der Ärmsten.“
Die Einschätzung der Bundesregierung, wonach der vollständige Entzug der Leistungen und sogar die Kürzung der Kosten der Unterkunft verfassungskonform seien, bezeichnet die AWO als irrwitzig. „Man darf sich schon wundern, dass die Bundesregierung so hart an der Grenze der Verfassung operiert und sehenden Auges mit Verfassungsklagen rechnen muss. Doch auch jenseits der Verfassungskonformität: Es ist absurd, Menschen aufgrund verpasster Termine die Existenzgrundlage zu nehmen. Die Bundesregierung muss sich ernsthaft fragen, ob sie es verantworten möchte, dass Familien ihre Wohnung verlieren, nur weil sie nicht rechtzeitig beim Jobcenter waren. Das Existenzminimum ist die allerletzte Haltelinie und es ist auch heute nicht armutsfest. Was die Regierung nun plant, wird Menschen in die Obdachlosigkeit treiben.“
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 09.10.2025
Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch zur Koalitionseinigung über die Bürgergeld-Reform
Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf eine Bürgergeld-Reform geeinigt.
Dazu erklärt Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland: „Der Koalitionsausschuss setzt wichtige Impulse für eine bessere individuelle Förderung und Unterstützung bei der Integration in Arbeit. Wir begrüßen ausdrücklich, dass künftig jede Person gleich zu Beginn ein persönliches Angebot erhält und Eltern mit sehr kleinen Kindern frühzeitig beraten werden sollen. Besonders positiv ist, dass auf Qualifizierung gesetzt wird, wo sie eine nachhaltige Integration in Beschäftigung ermöglicht – und dass dabei junge Menschen besonders im Blick sind.
Es ist richtig, die Mitwirkung von Menschen einzufordern, die Grundsicherung beziehen. Pflichtverletzungen müssen Konsequenzen haben – dafür reichen jedoch die bestehenden Regelungen aus. Kritisch sehen wir, wenn das Verhalten Einzelner negative Folgen für die gesamte Bedarfsgemeinschaft hat. Die existenzsichernden Leistungen für Kinder dürfen unter keinen Umständen gekürzt werden.
Mit der Vereinbarung, dass die Kosten der Unterkunft künftig direkt an Vermieter überwiesen werden, erkennt die Koalition das reale Risiko von Wohnungslosigkeit an. Dennoch bleibt das Risiko bestehen, wenn Leistungsberechtigte den Fehlbetrag zwischen den anerkannten und den tatsächlichen Wohnkosten weiterhin aus dem Regelsatz ausgleichen müssen – das sind im Schnitt rund 116 Euro pro Monat.“
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung e.V. Diakonie Deutschland vom 10.10.2025
DKSB: Bundesregierung droht, Kinder in die Obdachlosigkeit zu sanktionieren
Zur aktuellen Einigung der Bundesregierung auf eine Grundsicherung erklärt Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes:
„Rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche leben nach aktuellem Stand im Bürgergeld. Sie können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn ihre Eltern Jobangebote nicht annehmen oder Termine beim Jobcenter nicht wahrnehmen. Die Pläne der Bundesregierung, Sanktionen bis zur Streichung der Unterstützung zur Unterkunft, möglich zu machen, sind eine Katastrophe für diese Kinder und Jugendlichen.
Kinder und Jugendliche haben ein gesondertes Schutzrecht. Sie sind als Teil von Bedarfsgemeinschaften von Sanktionen immer mitbetroffen, das muss ausgeschlossen werden. Ihnen bei Kürzung aller Bezüge die Existenzgrundlage bis hin zum Verlust der Wohnung zu nehmen, ist ethisch fragwürdig und dürfte wohl auch nicht verfassungskonform sein.“
Quelle: Pressemitteilung Der Kinderschutzbund Bundesverband e.V. vom 09.10.2025
Paritätischer kritisiert Bürgergeld-Pläne der Regierung scharf: Bürokratie-Monster statt Arbeitsmarktintegration
Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Dr. Joachim Rock, verurteilt die Vorschläge der Bundesregierung als ungerechtfertigtes und unsoziales Misstrauensvotum gegen Arbeitsuchende.
Statement von Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes:
„Statt dem versprochenen Rückenwind für Arbeitsmarktintegration schafft die Bundesregierung ein Bürokratie-Monster. Die Pläne der Bundesregierung sind ein ungerechtfertigtes und unsoziales Misstrauensvotum gegen Arbeitsuchende. Zudem widersprechen sie den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Wo Menschen auf individuelle Unterstützung bei der Jobsuche hoffen, setzt die Bundesregierung auf Strafen statt auf Hilfe. Damit riskiert sie, Haushalte und Familien in verfestigte Armut und Existenznot zu treiben.
Millionen Arbeitsuchende aufgrund von wenigen tausend Leistungsminderungsfällen unter Generalverdacht zu stellen ist maßlos und kontraproduktiv. Die geplante vollständige Streichung von Geldleistungen nach dem dritten Meldeversäumnis sowie die Möglichkeit, in weiteren Schritten sämtliche Leistungen einzustellen, ist zudem sozialpolitisch gefährlich und integrationshemmend. Der Verlust von Nahrung, Wohnung und Krankenversicherung zerstört Lebensgrundlagen. So bringt man niemanden in Arbeit, sondern treibt Betroffene in existenzielle Not.
Wenn selbst die Kosten der Unterkunft gestrichen werden können, droht die Zunahme von Wohnungslosigkeit.
Auch die geplante Abschaffung der Karenzzeiten bei der Vermögensanrechnung ist ein Rückschritt. Schon bei kurzfristigem Hilfebedarf werden dadurch aufwendige Verwaltungsverfahren ausgelöst, die weder effizient noch gerecht seien. Besonders befremdlich ist es zudem, Eltern bereits ab dem ersten Lebensjahr ihres Kindes mit Sanktionen zu drohen.
Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses führen in die falsche Richtung – und das mit erhöhter Geschwindigkeit.“
Der Paritätische fordert stattdessen, arbeitsuchende Menschen mit Respekt zu behandeln und ihnen echte Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration zu bieten. Dazu gehörten passgenaue Fördermaßnahmen, individuelle Beratung und die konsequente Ausrichtung der Jobcenter auf nachhaltige Hilfe.
Quelle: Pressemitteilung Der Paritätische Gesamtverband vom 09.10.2025
NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT
BMBFSFJ: Fortschritte bei Gleichstellung in Führungspositionen
Die Bundesregierung hat heute die von der Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz gemeinsam vorgelegte Neunte Jährliche Information der Bundesregierung über die Entwicklung des Frauenanteils in Führungsebenen und in Gremien der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes sowie der Unternehmen mit unmittelbarer Mehrheitsbeteiligung des Bundes beschlossen. Danach ist der Frauenanteil in Führungspositionen in der Privatwirtschaft, im öffentlichen Dienst, bei Bundesunternehmen sowie in den Gremien des Bundes insgesamt kontinuierlich gestiegen.
Bundesfrauenministerin Karin Prien: „Die gesetzlichen Regelungen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen zeigen Wirkung – in der Privatwirtschaft ebenso wie im öffentlichen Dienst des Bundes, in Bundesunternehmen und in den Gremien des Bundes. In allen Bereichen steigt der Anteil von Frauen in Führung weiter.
Der Bund nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Mit einem Frauenanteil von 47 Prozent in Führungspositionen innerhalb der Bundesverwaltung setzen wir ein deutliches Zeichen für Gleichstellung. Unser Ziel bleibt die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern.
Es ist ermutigend, dass auch in der Privatwirtschaft Fortschritte sichtbar werden – denn vielfältig besetzte Führungsteams sind nachweislich erfolgreicher. Eine chancengerechte Beteiligung von Frauen ist deshalb nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit.“
Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig: „Gleichberechtigung und eine tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau sind für mich überragend wichtige Ziele. Viele Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, werden aktuell wieder in Frage gestellt. Die 9. Jährliche Information der Bundesregierung zeigt aber auch, dass die Führungspositionengesetze eine Erfolgsgeschichte sind. Es hat sich ausgezahlt, dass der Gesetzgeber großen Unternehmen klare Vorgaben gemacht hat. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass der Anteil an Frauen in Führungspositionen noch schneller ansteigt. Jetzt, mehr denn je, müssen wir dranbleiben und dürfen uns nicht auf bisherigen Erfolgen ausruhen.“
Die Zahlen der 9. Jährlichen Information im Überblick:
Der Bericht wertet – je nach betrachteter Kategorie – Zahlen aus den Jahren 2022 bis 2024 aus.
In der Privatwirtschaft hat sich der Frauenanteil im Geschäftsjahr 2022 für die 1.915 betrachteten Unternehmen weiter erhöht. In den Aufsichtsräten erhöhte sich der Frauenanteil von 2015 bis 2022 von 18,6 Prozent auf 27,4 Prozent. In den Unternehmen, die unter die feste Quote für den Aufsichtsrat fallen, ist der Frauenanteil seit 2015 um mehr als 10 Prozentpunkte gestiegen. Bei den börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen wurde die gesetzlich vorgegebene Mindestquote von 30 Prozent im Geschäftsjahr 2022 um 7,1 Prozentpunkte übertroffen. Im Geschäftsjahr 2023 steigerte sich der Anteil auf 37,7 Prozent. In den Unternehmensvorständen waren Frauen im selben Zeitraum unterrepräsentiert: Ihr Anteil lag 2022 trotz einer Steigerung um 1,5 Prozentpunkte bei lediglich 13 Prozent. In Vorständen werden die strategischen Entscheidungen für Unternehmen getroffen, deswegen ist weibliche Repräsentation hier besonders wichtig. Bei Unternehmen, die einer festen Quote für den Aufsichtsrat unterliegen ist der Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte gestiegen und liegt nunmehr bei 17,9 Prozent.
Auffällig ist der hohe Anteil an Unternehmen, die für den Frauenanteil auf Vorstandsebene die Zielgröße Null festgelegt und veröffentlicht haben. 73,4 Prozent der betrachteten Unternehmen haben Zielgrößen für den Vorstand veröffentlicht. Von diesen haben 48,6 Prozent die Zielgröße Null festgelegt.
Das Ziel im öffentlichen Dienst des Bundes lautet: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen bis Ende 2025. Im Jahr 2024 liegt der Frauenanteil in Führungspositionen bereits bei 47 Prozent.
Bei einer Gesamtbetrachtung aller vom Bund bestimmten Gremienmitglieder wurde ein nahezu paritätisches Verhältnis erreicht. Der Blick auf die einzelnen Gremien des Bundes zeigt, dass nach wie vor erst zwei Drittel der Gremien einer paritätischen Besetzung unterliegen. Deshalb dürfen die Anstrengungen hier nicht reduziert werden.
Bei den 55 Bundesunternehmen in unmittelbarer Mehrheitsbeteiligung lag der Anteil von Frauen in den Überwachungsgremien bei 45,8 Prozent. Die Geschäftsführungspositionen wurden zu 31,9 Prozent durch Frauen besetzt.
Erneut wurden Daten zum Frauenanteil in den obersten Leitungsorganen bei landes- und bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträgern erfasst. Dort gibt es nach wie vor deutlich weniger Frauen als Männer – auch wenn die vorgeschriebene Mindestbeteiligungsquote weitgehend erfüllt wird. So ist beispielsweise bei den landesunmittelbaren Sozialversicherungsträgern der Frauenanteil an den Beschäftigten mit 74 Prozent wesentlich höher als der Frauenanteil an den Führungspositionen mit 27 Prozent. Beides ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Über das Führungspositionen-Gesetz
Das Führungspositionen-Gesetz (FüPoG) gibt seit 2015 eine Quote von 30 Prozent vor, mit der Frauen in den Aufsichtsräten börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen beteiligt werden müssen. Für rund 2000 Unternehmen wurde die Verpflichtung zur Festlegung von Zielgrößen eingeführt. 2021 trat das Folgegesetz (FüPoG II) in Kraft. Die Regelungen des FüPoG in den Bereichen Privatwirtschaft, im öffentlichen Sektor und in den Gremien im Einflussbereich des Bundes wurden fortentwickelt und neue Vorgaben für Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes und die Körperschaften im Bereich der Sozialversicherung gemacht.
Weiterführende Informationen und aktuelle Daten aus allen Teilbereichen sowie den vollständigen Bericht der Bundesregierung finden Sie hier: https://www.bmbfsfj.bund.de/frauen-in-fuehrungspositionen
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 15.10.2025
BMBFSFJ: 75 Jahre Kinder- und Jugendplan des Bundes – Zukunft seit 1950
Am 18. Dezember 1950 verkündete die Bundesregierung den ersten Bundesjugendplan. In den Trümmern der Nachkriegszeit sollte er mehr sein als ein Finanzierungsinstrument: Er gab jungen Menschen Unterkunft, Ausbildung, Möglichkeiten zur Selbstorganisation – und damit Hoffnung und Perspektive.
Seither hat sich der Kinder- und Jugendplan stetig weiterentwickelt. Immer ging es darum, verlässliche Strukturen der außerschulischen Bildung und Jugendarbeit aufzubauen und weiterzuführen. Nach der Deutschen Einheit wurde er zum Motor einer gesamtdeutschen Kinder- und Jugendhilfe, die große Transformationsprozesse bewältigen musste. Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG, heute SGB VIII) erhielt er eine feste rechtliche Grundlage, die bis heute trägt.
Heute ist der Kinder- und Jugendplan ein Garant für stabile, plurale Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene.
Bundesjugendministerin Karin Prien: „Heute, 75 Jahre später, ist der Kinder- und Jugendplan ein bundesweit einmaliges und unverzichtbares Förderinstrument, das jungen Menschen Teilhabe ermöglicht und ihre Rechte schützt. Unverändert blieb das Ziel des Kinder- und Jugendplans: verlässliche Strukturen der außerschulischen Bildung auf Bundesebene zu schaffen und stetig weiterzuentwickeln. Zugleich wollen wir als Bundesregierung das Förderinstrument KJP mit einem strukturellen Blick auf Wirksamkeit und Effizienz prüfen. Der Bund fördert die Infrastruktur und Projekte von bundesweiter Bedeutung, während Länder und Kommunen den größten Anteil an der Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe schultern. Wichtig ist, dass Bund, Länder und Kommunen Hand in Hand arbeiten. Für die Zukunft der Kinder- und Jugendpolitik haben wir uns drei Kernpunkte vorgenommen: Kinder und Jugendliche sollen ihr Leben selbstbestimmt und voller Zuversicht gestalten, sicher aufwachsen und eine gute frühe, schulische und außerschulische Bildung erhalten. Diese Ziele sind und bleiben unser gemeinsamer Kompass.“
75 Jahre KJP bedeuten deshalb auch: 75 Jahre Investition in das, was die Zukunft trägt – die Jugend.
Der Regierungsentwurf für den Haushalt 2026 sieht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 einen Aufwuchs um 7,5 Mio. Euro vor und damit ein Finanzvolumen von über 251 Mio. Euro.
Der Kinder- und Jugendplan des Bundes stärkt seit Jahrzehnten die bundeszentralen Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe in all ihren Handlungsfeldern. Damit ergänzt er die wertvolle Arbeit, die in den Ländern und Kommunen geleistet wird. Diese Verantwortung liegt bewusst bei Ländern und Kommunen – und sie erfüllen sie mit großem Engagement.
Warum der KJP heute unverzichtbar bleibt
Der Kinder- und Jugendplan des Bundes ist weit mehr als eine Förderrichtlinie. Er ist Garant für stabile und vielfältige Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe. Er schafft bundesweit Räume für Beteiligung, Bildung und Engagement junger Menschen – unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. In einer Zeit, in der Demokratie, Zusammenhalt und Teilhabe unter Druck stehen, ist er ein unverzichtbares Instrument, um die junge Generation zu stärken und die Gesellschaft zukunftsfähig zu halten.
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 06.10.2025
Bündnis 90/Die Grünen: Queere Rechte sind Menschenrechte - Art. 3 GG ergänzen
Zum heute von unserer Fraktion eingebrachten Gesetzesentwurf zur Ergänzung von Art. 3 GG erklärt Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende:
„Es ist notwendig, den Artikel 3 des Grundgesetzes endlich um das Merkmal „sexuelle Identität“ zu ergänzen. Und es war gut und wichtig, dass der Bundesrat auch mit Stimmen von CDU-geführten Bundesländern beschlossen hat, eine solche Änderung des Grundgesetzes vornehmen zu wollen.
Wir Grünen hätten uns gefreut, wenn CDU/CSU und SPD dazu bereit gewesen wären, gemeinsam mit uns Grünen diesen parteiübergreifenden Beschluss des Bundesrats auch in den Bundestag einzubringen. Wir bedauern, dass es hierfür bislang keine Bereitschaft der Koalitionsfraktionen gibt.
Wir Grünen bleiben dabei: Wir wollen gemeinsam mit allen demokratischen Fraktionen diese wichtige Änderung des Grundgesetzes vornehmen.
Angesichts zunehmender queerfeindlicher Hetze und Gewalt ist diese Ergänzung überfällig. Queere Menschen stehen derzeit unter massivem Druck. Die Zahl der Angriffe steigt, und Errungenschaften der letzten Jahre werden wieder infrage gestellt. Dieses Jahr wurde fast jeder dritte CSD von Rechtsextremen gestört. Häufig kam es dabei auch zu Gewalttaten gegen queere Menschen. Gerade jetzt ist es entscheidend, Haltung zu zeigen und sich klar zu positionieren.
Wir brauchen einen rechtlichen Rahmen, der unmissverständlich deutlich macht: Queere Rechte sind Menschenrechte. Wir Grünen fordern bereits seit langem, Art. 3 Abs. 3 GG um das Merkmal „sexuelle Identität“ zu ergänzen. Queere Menschen warten seit 76 Jahren darauf, endlich ausdrücklich im Grundgesetz geschützt zu werden – jetzt ist die Chance da.“
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 09.10.2025
Bündnis 90/Die Grünen: Koalition verhindert öffentliches Fachgespräch zu Schwangerschaftsabbrüchen im Gesundheitsausschuss
Zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Gesundheit erklären Ulle Schauws, Sprecherin für Frauenpolitik, und Kirsten Kappert-Gonther, Obfrau im Ausschuss für Gesundheit:
Die derzeitige gesetzliche Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland funktioniert nicht – weder im Interesse der Frauen noch der Ärzt*innen. Das belegt deutlich die erste große wissenschaftliche Studie zu Schwangerschaftsabbrüchen, die sogenannte ELSA-Studie. Unsere Bundestagsfraktion hatte dazu Anfang September ein öffentliches Fachgespräch im Gesundheitsausschuss für heute beantragt. In dem Fachgespräch sollten die Ergebnisse der ELSA-Studie diskutiert werden, die größte Verbundstudie zu Schwangerschaftsabbrüchen, die noch unter Jens Spahn vom unionsgeführten Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben wurde.
Die Koalition wollte das Fachgespräch zu Schwangerschaftsabbrüchen im Gesundheitsausschuss allerdings nur hinter verschlossenen Türen durchführen. Da sie dafür in der heutigen Ausschusssitzung keine Mehrheit herbeiführen konnte, wurde schließlich das Fachgespräch verschoben, was für die interessierte Öffentlichkeit, die hochkarätigen Sachverständigen, die sich Zeit genommen haben, und eine kritische Oppositionsarbeit sehr bedauerlich ist. Wir setzen uns für eine zeitnahe geordnete Neuaufsetzung für ein öffentliches Fachgespräch ein.
Transparenz und öffentliche Auseinandersetzung gehören zur gelebten Demokratie dazu. Die gesundheitliche Versorgung von Frauen ist ein Thema, das uns alle betrifft. Eine offene und öffentliche Diskussion ist dringend notwendig, damit wir als Gesellschaft gemeinsam Lösungen finden können, um die schlechte Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen zu verbessern. Durch den Versuch der Koalition, das Fachgespräch nicht öffentlich zu machen, trägt sie nur zur weiteren Tabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bei.
Wir fordern einen bundesweit sicheren und barrierefreien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und eine Gesetzgebung, die Ärzt*innen dabei unterstützt, diese Versorgung anzubieten, statt sie daran zu hindern. Es ist höchste Zeit, Schwangerschaftsabbrüche aus der Stigmatisierung zu befreien und die veraltete Gesetzgebung zu überwinden. Wir brauchen eine Enttabuisierung und eine Gesundheitsversorgung, die den Frauen die Unterstützung bietet, die sie benötigen. Der Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche muss endlich legalisiert werden. Der veraltete § 218 schadet und verhindert den Zugang zu notwendiger Gesundheitsversorgung.
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 08.10.2025
Bundestag: Linke fordert Verzicht auf Leistungskürzungen in der Pflege
Die Linksfraktion fordert den Verzicht auf Leistungskürzungen in der Pflege. Der aktuelle Koalitionsvertrag sei der erste seit Bestehen der Pflegeversicherung, der Leistungskürzungen für die Menschen mit Pflegebedarf beinhalte, heißt es in einem Antrag (21/2216) der Fraktion.
Insbesondere gebe es einen Prüfauftrag für die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, wonach Nachhaltigkeitsfaktoren wie die Einführung einer Karenzzeit geprüft werden sollen. Karenzzeit bedeute, dass in einem gewissen Zeitraum nach Feststellung der Pflegebedarfs keine Leistungen gewährt werden sollen.
Auch hinter Formulierungen wie „Leistungsumfang“, „Ausdifferenzierung der Leistungsarten“, „Bündelung und Fokussierung der Leistungen“ oder „Anreize für eigenverantwortliche Vorsorge“ könne der Auftrag an die Arbeitsgruppe verstanden werden, Leistungskürzungen zu empfehlen.
Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, keine Leistungskürzungen in der Pflegeversicherung auf den Weg zu bringen, wie etwa eine (Teil-)Karenzzeit, Leistungsverschlechterungen im Pflegegrad 1 oder höhere Schwellenwerte bei der Zuordnung zu den Pflegegraden.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 553 vom 15.10.2025
Bundestag: Linke fordert Erhöhung des Elterngeldes
Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag (21/2038) eine Erhöhung des Elterngeldes. Zur Begründung führt sie an, dass der Mindestbetrag, den Eltern mit geringem oder keinem Einkommen erhalten, 300 Euro für das Basiselterngeld und 150 Euro für das ElterngeldPlus betrage, und diese Beträge seit Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 nicht angepasst worden seien, obwohl die Verbraucherpreise zwischen 2007 und Juli 2025 um 46,3 Prozent gestiegen seien. „Um diese Teuerung auszugleichen, müsste der Mindestbetrag auf 438,90 Euro für das Basiselterngeld und auf 219,45 Euro für das ElterngeldPlus erhöht werden“, schreiben die Abgeordneten. Sie kritisieren außerdem, dass seit der Reform von 2011 das Elterngeld auf Transferleistungen angerechnet werde und es dadurch viele Familien, insbesondere solche mit geringem oder keinem Einkommen, nicht mehr erreiche. „Besonders betroffen sind hier Alleinerziehende.“
Die Linke fordert von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf, der die Anhebung des Mindestbetrags beim Elterngeld auf 440 Euro sowie des ElterngeldPlus auf 220 Euro festlegen soll sowie die Einführung einer Dynamisierung des Mindest- und Höchstbetrags von Elterngeld und ElterngeldPlus, die an die Entwicklung des allgemeinen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist. Ferner soll die Anrechnung von Elterngeld auf Leistungen der Grundsicherung so reformiert werden, dass das Elterngeld in Höhe der jeweiligen maximalen Freibeträge für Erwerbseinkommen anrechnungsfrei wird.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 487 vom 08.10.2025
Bundestag: Veränderte Armutsstatistik des Statistischen Bundesamtes
Die Bundesregierung weist Kritik an der Entscheidung des Statistischen Bundesamtes wegen dessen veränderter Armutsstatistik zurück. In einer Antwort (21/1915) auf eine Kleine Anfrage (21/1632) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schreibt sie unter anderem, die Entscheidung des Bundesamtes, Armutsgefährdungsquoten aus dem Mikrozensus-Kernprogramm auf Basis des Bundesmedians nicht mehr zu veröffentlichen, habe fachliche Gründe. Zum einen erfasse die europäische Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) das Einkommen von Haushalten (und daraus abgeleitet auch das bundesweite Medianeinkommen) sehr viel differenzierter als die Einkommensabfrage im Kernprogramm des Mikrozensus. „Zum anderen lässt die deutliche Erhöhung des Stichprobenumfangs einkommensbasierte Indikatoren wie die Armutsgefährdungsquote nun auch in tiefer fachlicher und regionaler Gliederung auf Basis von EU-SILC zu. Damit wird zudem eine EU-weite Vergleichbarkeit von Armutsgefährdung ermöglicht“, argumentiert die Regierung. Sie sei aber nicht in die Entscheidung des Bundesamtes involviert gewesen, heißt es in der Antwort weiter.
Außerdem veröffentliche die Sozialberichterstattung der amtlichen Statistik auch weiterhin die Armutsrisikoquote für das Bundesgebiet, wie auch für die Bundesländer, mit einem bundesweit einheitlichen Referenzwert auf Grundlage von EU-SILC, so die Regierung.
Die Grünen hatten kritisiert, dass es nicht dem Standard der Armutsforschung entspreche, wenn die Ergebnisse aus dem Mikrozensus-Kern künftig nicht mehr auf Bundesebene zur Armutsquote ausgewiesen würden, weil so ein bundesweiter Armutsvergleich unmöglich gemacht würde.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 471 vom 07.10.2025
Bundestag: Linke fragt nach der Situation armer Senioren
Die Fraktion Die Linke hat eine Kleine Anfrage (21/1968) zur Nutzung von Lebensmittelausgabestellen durch Seniorinnen und Senioren gestellt. Darin fragt sie die Bundesregierung unter anderem nach den Gründen für die verstärkte Nutzung von Lebensmittelausgabestellen oder Suppenküchen durch Senioren und nach der Zahl der Senioren, die Leistungen nach dem SGB II (Zweites Buch Sozialgesetzbuch, Bürgergeld) beziehen.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 471 vom 07.10.2025
DIW: Armutsrisiko stagniert, ist aber bei Geflüchteten und Erwerbslosen sehr hoch
Hohe Inflation hat den Anstieg der Bruttostundenlöhne und Haushaltsnettoeinkommen gebremst – Einkommensungleichheit und Armutsrisikoquote stagnieren seit 2020 – Unter Geflüchteten und Erwerbslosen ist Armutsrisiko weit überdurchschnittlich hoch und deutlich gestiegen
Die hohe Inflation der Jahre 2021/22 hat die Reallöhne und verfügbaren Einkommen in Deutschland erstmals seit 2013 wieder sinken lassen. Gleichzeitig ist aber bei den Bruttostundenlöhnen die Ungleichheit weiter zurückgegangen, was vor allem an den positiven Entwicklungen am unteren Ende der Lohnverteilung liegt. Bei den verfügbaren Einkommen auf Haushaltsebene stagniert hingegen seit 2020 die Ungleichheit ebenso wie die Armutsrisikoquote. Das Armutsrisiko hat vor allem für Erwerbslose und Geflüchtete stark zugenommen. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Erhebung zur Einkommensverteilung in Deutschland auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).
Die hohe Inflation hat den langfristigen Trend bei der Entwicklung der Bruttostundenlöhne und Haushaltsnettoeinkommen nicht umkehren können: Beide haben inflationsbereinigt seit 1995 deutlich zugelegt, insbesondere seit 2013. Seitdem ist auch die Ungleichheit der Stundenlöhne stark gesunken, und die Niedriglohnquote liegt wieder auf den Stand des Jahres 2000. „Die verschiedenen Arbeitsmarktreformen wie die Einführung des Mindestlohns scheinen Wirkung zu zeigen – insbesondere in Ostdeutschland“, resümiert Markus M. Grabka, der die Lohn- und Einkommensentwicklung jährlich auswertet. „Die Differenz der Niedriglohnquote zwischen Ost und West hat sich von 19 Prozentpunkten im Jahr 1995 auf nun knapp fünf Prozentpunkte reduziert.“
Armutsrisiko für Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hoch
Anders sieht es bei den Haushaltseinkommen aus: Dort ist die Ungleichheit seit 1995 gestiegen. Dies liegt zum einen an der steigenden Anzahl der Teilzeitbeschäftigten, die häufig im unteren Lohnsegment arbeiten. Zum anderen sind in den Jahreseinkommen anders als bei den Stundenlöhnen auch die Sonderzahlungen erfasst, die am oberen Ende der Verteilung im Schnitt höher ausfallen. Seit 2020 stagniert die Einkommensungleichheit aber.
„Die gute Nachricht ist: Seit 2020 sinkt die Armutsrisikoquote bei Geflüchteten wieder etwas, was der zunehmenden Arbeitsmarktintegration zu verdanken sein dürfte“ Markus M. Grabka
Ähnliches gilt für die Niedrigeinkommensquote oder auch Armutsrisikoquote, die seit 2019 bei rund 17 Prozent liegt. Während sie bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund seit mehr als zehn Jahren bei knapp 13 Prozent liegt, ist sie unter Personen mit Migrationshintergrund mit rund 25 Prozent überdurchschnittlich hoch. Insbesondere Geflüchtete haben ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko, das seit 2010 zudem stark zugenommen hat: Die Quote stieg von 42 auf knapp 64 Prozent. „Die gute Nachricht ist: Seit 2020 sinkt die Armutsrisikoquote bei Geflüchteten wieder etwas, was der zunehmenden Arbeitsmarktintegration zu verdanken sein dürfte“, sagt DIW-Ökonom Grabka.
Ebenfalls stark zugenommen hat die Armutsrisikoquote für Haushalte ohne Erwerbstätige. „Es zeigt sich deutlich, dass Arbeit vor Armut schützt“, stellt Grabka fest. „Um die Einkommensungleichheit und das Armutsrisiko zu senken, sollte die Integration bestimmter Gruppen in den Arbeitsmarkt stärker gefördert werden. Auch das Transfersystem müsste reformiert werden, da sich eine Ausweitung der Arbeitszeit gerade im unteren Einkommensbereich kaum im Geldbeutel bemerkbar macht“, empfiehlt Grabka.
LINKS:
- Studie im DIW Wochenbericht 42/2025
- Infografik in hoher Auflösung (JPG, 1.74 MB)
- Interview mit Studienautor Markus M. Grabka
- Audio-Interview mit Markus M. Grabka (MP3, 13.49 MB)
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) vom 15.10.2025
INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN
BVT* und LSVD+: Keine „Lebensakte Trans*“ im Melderegister
BVT* und LSVD⁺ kritisieren geplante Änderungen des Meldewesens
Mit dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) wurde das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein menschenrechtskonformer Zugang zu Vornamens- und Personenstandsänderungen für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen geschaffen. Doch die jetzt geplanten Änderungen im Meldewesen (BR-Drucksache 419/25) drohen, diesen Erfolg wieder auszuhöhlen.
Bereits im Juli hat das Bundesinnenministerium Verordnungsentwürfe für verschiedene Änderungen des Meldewesens vorgelegt, die unverhältnismäßig in Grundrechte von trans*, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen eingreifen. Mit der Einführung neuer Datenblätter (0702–0704 und 0304–0305) würden die Angaben über den ehemaligen Geschlechtseintrag und die Änderung künftig zum persönlichen Datensatz einer Person gehören. Wer Einsicht ins Melderegister hat, sieht sofort, dass eine Person trans*, intergeschlechtlich oder nicht-binär ist – auch wenn dies für den konkreten Verwaltungszweck keinerlei Relevanz hat. Nach Bekanntwerden kam in den Communities die Angst auf, dass damit sogenannte „rosa Listen“ angelegt werden könnten. Diese wurden in der Weimarer Republik geführt und haben die die Verfolgung von LSBTIQ*-Personen im Nationalsozialismus vereinfacht.
Anfang September hat das Bundesinnenministerium eine überarbeitete Version der Verordnungen zur Zustimmung an den Bundesrat übersandt, über die am 17.10. abgestimmt wird. Die Grundrechtseingriffe sind nach wie vor unverändert geplant. Neu ist einzig ein Zusatz, der festschreibt, dass eine gezielte Suche nach trans*, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen im System ausgeschlossen sein soll. Wie dies sichergestellt werden soll, bleibt unklar. Der Bundesratsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat dem Bundesrat empfohlen, die melderechtlichen Änderungen abzulehnen.
Robin Ivy Osterkamp aus dem Vorstand des Bundesverband Trans* sagt dazu: „Statt Selbstbestimmung konsequent umzusetzen, sieht der Entwurf vor, dass trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen zwangsgeoutet werden. Statt – wie zu Zeiten des sogenannten “Transsexuellengesetzes” (TSG) – die ehemaligen Daten mit einer Meldesperre vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, sollen der abgelegte Vorname und der abgelegte Personenstand nun auf den ersten Blick in den Meldedaten sichtbar sein. Und das ohne Erfordernis; bleibt doch die Nachvollziehbarkeit durch das Geburtenregister bestehen. Damit entsteht faktisch eine ‚Lebensakte Trans*‘. Selbstbestimmung bedeutet, dass die Gegenwart zählt. Die geplante Verordnung aber macht unsere Vergangenheit dauerhaft sichtbar. Statt Sicherheit zu schaffen, produziert die geplante Verordnung neue Risiken für Diskriminierung. Sie befeuert zudem die trans*feindliche Erzählung, dass Menschenrechte für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen gefährlich wären. Das ist ein klarer Rückschritt. Besonders in einem politischen Klima, in dem trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen als Feindbild stilisiert werden.“
Dazu erklärt Julia Monro aus dem Bundesvorstand des LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt: “Trans*feindlichkeit nimmt weltweit zu. Die Communitys haben die berechtigte Sorge, dass generell eine systematische Erfassung von geschlechtlicher Vielfalt erfolgt. Dass der persönliche Datensatz um die besonders sensiblen Informationen zum früheren Geschlechtseintrag erweitert wurde und diese Daten umfangreicher weitergegeben werden, höhlt das Recht auf geschlechtliche und informationelle Selbstbestimmung aus. Diese dauerhafte ‘Markierung’ ist absolut unverhältnismäßig und war in mehr als 40 Jahren TSG nie erforderlich. Das SBGG hat kein neues Ergebnis im Vergleich zum TSG. Am Ende stehen jeweils neue Vornamen und/oder ein neuer Geschlechtseintrag. Daher ist die geplante Änderung nicht nachvollziehbar und die Argumente des BMI lediglich vorgeschoben. Zudem kritisieren wir, dass derart sensible Fragestellungen überhaupt in Form einer Verordnung geregelt werden und nicht per Gesetzesentwurf, der dann im Bundestag diskutiert werden würde. Die Landesregierungen müssen jetzt die Kritik der Community und des Familienausschusses ernst nehmen und dieses Zwangsouting verhindern.”
Unsere Kritikpunkte:
- Dauerhafte Sichtbarkeit: Die Transgeschlechtlichkeit einer Person ist unmittelbar aus dem Datensatz erkennbar.
- Sondermarkierungen: Spezielle Datenfelder für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen stigmatisieren, statt Gleichbehandlung zu sichern.
- Offenbarungsverbot wird unterlaufen: Das SBGG garantiert Schutz – die Verordnung schwächt ihn ab.
- Zwangs-Outings: Zugriff auf die Daten gefährdet Privatsphäre und Sicherheit von trans*, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen.
- Unverhältnismäßigkeit: Der Eingriff in das Recht auf informationelle und geschlechtliche Selbstbestimmung ist nicht notwendig! Die Nachvollziehbarkeit einer Person ist bereits jetzt gewährleistet.
Robin Ivy Osterkamp sagt dazu weiter: „Das TSG hat Menschenrechte verletzt. Viele Personen haben das Gesetz daher nicht genutzt – und mussten sich in Folge dessen alltäglich Diskriminierung aussetzen. Das Ziel des Selbstbestimmungsgesetzes war es, Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen abzubauen. Wenn die geplanten Änderungen im Meldewesen umgesetzt werden, verletzen diese jedoch erneut die Grundrechte von trans*, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen. Warum müssen trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen immer wieder Menschenrechtsverletzungen hinnehmen, wenn sie in Deutschland ihren Vornamen und Personenstand ändern wollen?“
Der Bundesverband Trans* und der LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt fordern daher den Bundesrat dazu auf, die Verordnung in der vorliegenden Fassung abzulehnen.
Hintergrund:
Die Entwürfe für eine neue Bundesdatenmeldeverordnung sehen vor, dass der frühere Geschlechtseintrag und der vorherige Vorname wie auch das Datum der Änderung der Daten nach Selbstbestimmungsgesetz sichtbar im persönlichen Datensatz einer Person erfasst werden. Begründet wird dies mit Nachvollziehbarkeit und dem Wunsch, Personen identifizieren zu können. Zudem soll die Weitergabe dieser Daten bei einem Umzug und an die Datenstelle der Rentenversicherung und für das Bundeszentralamt für Steuern ermöglicht werden.
Deutschland führt jedoch seit 1981 Vornamens- und Personenstandsänderungen durch.Die Identitfizierbarkeit einer Person ist stets gewährleistet. Aus Sicht des BVT* und des LSVD⁺ ist der massive Eingriff in das Recht auf informationelle und geschlechtliche Selbstbestimmung daher nicht erforderlich und somit unverhältnismäßig.
Die Sitzung des Bundesrats, bei der voraussichtlich über die Meldedatenverordnung abgestimmt werden wird, ist für den 17.10. angesetzt.
Weiterführende Links:
- Aktueller Entwurf der Meldedatenverordnung wie auch Empfehlung des Bundesratsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
- Stellungnahme des BVT*
- Stellungnahme des LSVD⁺
Quelle: Pressemitteilung Bundesverband Trans* und LSVD+ – Verband Queere Vielfalt vom 15.10.2025
DGB: Arbeitszeitdebatte: Schutz der Beschäftigten nicht aufs Spiel setzen
Der vom BMAS einberufene Sozialpartnerdialog zum Arbeitszeitgesetz ist beendet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen die geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes und eine Abschaffung des Achtstundentags weiterhin entschieden ab.
Der Dialog hat gezeigt, dass das Arbeitszeitgesetz in seiner jetzigen Form funktioniert. Die geplanten Änderungen würden nur Chaos stiften und zu Rechtsunsicherheit führen. Flexible Arbeitszeitmodelle sind längst Realität – durch Tarifverträge, die Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam aushandeln. Ein Aufweichen des Arbeitszeitgesetzes bringt hingegen mehr Belastung statt mehr Flexibilität: Arbeitgeber erhalten erweiterte Befugnisse, während der Schutz für Beschäftigte – insbesondere für jene ohne Tarifbindung – eingeschränkt wird. Das ist ein Bruch mit der sozialpartnerschaftlichen Tradition und ein Rückschritt in der Arbeitswelt.
Wer mehr Beschäftigung ermöglichen und dem Fachkräftemangel begegnen will, muss die tatsächlichen Hürden für mehr Beschäftigung abbauen. Eine aktuelle DGB-Umfrage zeigt: Wenn Beschäftigte mehr arbeiten wollen, scheitert das nicht am Arbeitszeitgesetz, sondern an starren betrieblichen Abläufen und der Ablehnung durch Vorgesetzte. Die Arbeitgeber sind somit selbst das größte Hindernis für flexible Arbeit. Weitere wichtige Faktoren sind verlässliche Kinderbetreuung und eine bessere Pflegeinfrastruktur. Statt die tägliche Höchstarbeitszeit auszuweiten, brauchen Beschäftigte mehr Arbeitszeitsouveränität. Dies gilt besonders für Frauen, die oft in Teilzeit arbeiten. Viele von ihnen sind bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, brauchen dafür aber die richtigen Rahmenbedingungen.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die Bundesregierung auf, dem Druck von Arbeitgeberverbänden nicht nachzugeben. Die Gesundheit der Beschäftigten und der Schutz vor Überlastung haben oberste Priorität.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 15.10.2025
Diakonie und DEVAP: Zwischenbericht der Bund-Länder-Kommission: Pflegereform ohne Finanzierungsbasis läuft ins Leere
Die Bund-Länder-Kommission zur Reform der Pflegeversicherung will diese Woche ihren Zwischenbericht vorlegen. Die Diakonie Deutschland und der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) warnen im Vorfeld vor einer Reformdiskussion ohne gesicherte Finanzierung.
„Eine Pflegereform ohne eine langfristige Finanzierung läuft ins Leere“, sagt Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. „Die coronabedingten Mehrausgaben von rund sechs Milliarden Euro müssen endlich an die Pflegekassen erstattet werden. Es kann nicht sein, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler für staatlich veranlasste Kosten aufkommen. Langfristig braucht es zudem einen verlässlichen Bundeszuschuss aus Steuermitteln für die sogenannten versicherungsfremden Leistungen – etwa die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige und die Kosten der Pflegeausbildung. Diese Aufgaben sind im gesamtgesellschaftlichen Interesse und dürfen nicht länger allein den Pflegeversicherten aufgebürdet werden.“
Anna Leonhardi, Vorständin des DEVAP e.V., betont die besondere Chance der Bund-Länder-AG in Bezug auf eine umfassende Strukturreform: „Die Finanzierungsfrage in der Pflegeversicherung ist momentan am dringendsten. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Frage nach der tatsächlichen Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung durch Strukturreformen dahinter zurücksteht. Die Erosion des Solidarsystems gefährdet mittelfristig die gesellschaftliche Akzeptanz und Legitimität der Pflegeversicherung. Zudem droht das Versprechen, im Alter vor Armut und sozialer Not geschützt zu sein, zur Worthülse zu werden. Angesichts des demografischen Wandels muss die Politik hier groß denken. Kommunen haben eine Verantwortung für eine Altenhilfe und Pflegeplanung, aber hierfür müssen diese auch entsprechend befähigt werden. Sie dürfen nicht länger als ‚letzte Rettung‘ der Pflegekrise ohne entsprechende Unterstützung dienen: Ohne finanziellen und strukturellen Beitrag von den Ländern und vom Bund drohen eine Überforderung und ein ‚Regularienwildwuchs‘ in den Regionen.“ Die diakonischen Träger der Altenhilfe sind bereits jetzt vielerorts aktiv, um mit Kommunen Konzepte zu entwickeln und diese umzusetzen.
Besonders kritisch sieht Ronneberger aktuelle Überlegungen, die Leistungen für Menschen mit Pflegegrad 1 zu streichen, um Geld einzusparen. „Dass freihändig über die Abschaffung der Leistungen bei Pflegegrad 1 diskutiert wird, zeigt die Hilflosigkeit der Politik“, sagt sie. „Es besteht das Risiko, am falschen Ende zu sparen. Hier sollte die Bund-Länder-Kommission gegensteuern.“ Es sei wichtig, Menschen schon ganz am Anfang der Pflegebedürftigkeit zu erreichen. „Aus der Praxis wissen wir, dass es für viele ältere Menschen schwierig ist, Unterstützung zu bekommen. Die Antragstellung ist kompliziert, viele Menschen fühlen sich nicht gut beraten und die Suche nach einem passenden Pflegedienst oder einer Tagespflege ist in vielen Regionen ein großes Problem“, so Ronneberger. Viele Betroffene versuchten dann, allein zurechtzukommen. „Das ist für pflegebedürftige Menschen wie auch für pflegende Angehörige oft der falsche Weg. Er führt in eine belastende Situation für alle Beteiligten – und das Pflegegeld ändert an dieser Situation wenig.“
Quelle: Pressemitteilung Diakonie Deutschland und Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit
und Pflege e.V. vom 13.10.2025
DKHW: UN-Kinderrechtskonvention muss Grundlage bei Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) sein
Das Deutsche Kinderhilfswerk mahnt bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in Deutschland die konsequente Ausrichtung an der UN-Kinderrechtskonvention an. Die heute dazu im Bundestag diskutierten Gesetzentwürfe werden aus Sicht der Kinderrechtsorganisation diesem Anspruch nicht gerecht. Vielmehr sieht das Deutsche Kinderhilfswerk in den Entwürfen gravierende kinderrechtliche Defizite.
„Kinderrechte gelten immer und überall, auch deshalb ist es die Aufgabe des Gesetzgebers, alle Kinder adäquat zu schützen. Die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerte Vorrangstellung des Kindeswohls bei allen Entscheidungen des Staates gilt auch für die Gesetzgebung zur GEAS-Reform. Geflüchtete Kinder stellen eine besonders vulnerable Gruppe dar. Auch deshalb sind beispielsweise die Verlängerung der Verweildauer in Erstaufnahmeeinrichtungen und die Möglichkeiten der Bewegungsbeschränkungen in den Unterkünften nicht akzeptabel“, betont Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes.
Gemeinsam mit acht weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen hatte das Deutsche Kinderhilfswerk ein Gutachten in Auftrag gegeben, das untersucht, welche Handlungsoptionen der Gesetzgeber hat, um die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems in Deutschland kinderrechtskonform umzusetzen. Die Gutachter und Experten für Migrationsrecht, Prof. Dr. Constantin Hruschka und Robert Nestler kommen zu dem eindeutigen Schluss, dass ohne klare rechtlich verankerte Kinderschutz-Maßnahmen schwerwiegende Kinderrechtverletzungen in Deutschland drohen.
Deshalb sollten kinderrechtliche Schutzgarantien möglichst konkret in den deutschen Gesetzestexten verankert werden, um ihre Wirksamkeit zu sichern, so die Gutachter. Doch stattdessen schlage die Bundesregierung Verschärfungen vor – etwa Möglichkeiten für Haft und haftähnliche Unterbringung, sogar von Kindern. Diese Verschärfungen seien nicht nur unverhältnismäßig, sondern verstießen gegen die Kinderrechte. Die Zielsetzung des Gesetzgebers müsse es sein, Freiheitsbeschränkungen von Kindern zu vermeiden und sie bestmöglich zu schützen.
Basierend auf dem Gutachten haben die Organisationen ein Positionspapier verfasst, in dem unter anderem ein gesetzlicher Ausschluss von Minderjährigen aus Haft und Unterbringungsformen, in denen die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, und verbindliche Standards für die kindgerechte Unterbringung sowie der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung für alle Kinder gefordert werden. Wichtig sind außerdem eine systematische und kindgerechte Prüfung besonderer Schutzbedarfe von Kindern, kindgerechte Verfahren statt Grenz- und Schnellverfahren für Kinder, sowie die Beibehaltung des Familienasyls zur Wahrung der Familieneinheit.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. vom 09.10.2025
Familienbund der Katholiken: Die gesetzliche Rente braucht umfassende Reformen – katholische Verbände fordern zukunftsorientierte Rentenpolitik
Von heute an wird das Rentenpaket der schwarz-roten Koalition im Bundestag beraten. Die vorgesehenen Maßnahmen tragen aus Sicht des Familienbundes der Katholiken, des Kolpingwerkes Deutschland und der Katholischen Landvolkbewegung Deutschland kaum dazu bei, die gesetzliche Rentenversicherung zukunftsfest aufzustellen. Es fehlt offensichtlich die politische Handlungsbereitschaft für eine grundlegende und generationengerechtere Reform der Alterssicherung. Beitragszahler:innen und zukünftige Rentner:innen müssen stärker in den Blick genommen werden.
„Ohne Mut zur Entscheidung werden wir nicht weiterkommen, jetzt müssen die Segel wirklich neu ausgerichtet werden. Das Finanzierungsproblem der Rente können wir nicht länger leugnen. Es reicht nicht, immer nur zu debattieren – es müssen endlich Taten folgen. Dazu gibt es bereits eine Reihe von Vorschlägen, jetzt geht es darum, sie auch umzusetzen. Wir brauchen eine gerechte und zukunftsfeste Rente – mit einer fairen Verteilung der Lasten, die niemanden überfordert und allen Generationen Perspektiven eröffnet“, sagt Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes der Katholiken.
Die Fixierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent– ein Kernanliegen des aktuellen Rentenpakets – garantiert für die kommenden Jahre ein stabiles Wachstum der gesetzlichen Renten. Zwar ist die Aufrechterhaltung eines gesetzlichen Sicherungsniveaus grundsätzlich zu begrüßen. Faktisch geschieht dies allerdings einseitig zu Lasten jüngerer Generationen. Zudem trägt der aktuelle Ansatz weder dazu bei, Armutsgefährdung im Alter ausreichend zu bekämpfen, noch sichert er eine stabile Leistungshöhe für künftige Generationen von Rentner*innen.
Die Neuregelung der Mütterrente, durch die Kindererziehung unabhängig vom Zeitpunkt der Geburt eines Kindes für alle Generationen anerkannt wird, schließt eine Gerechtigkeitslücke. Aus Sicht der katholischen Verbände handelt es sich dabei nicht um ein Wahlgeschenk, wie zum Teil kritisiert wird. Denn die damit erreichten Eltern, überwiegend Frauen, haben mit der Erziehung von Kindern eine zentrale Leistung für das umlagefinanzierte Rentensystem erbracht. Dass die Mittel dafür anders als bei früheren Angleichungen der Mütterrente aus Steuereinnahmen finanziert werden, ist folgerichtig, da es sich bei Kindererziehung um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt.
Insgesamt nimmt das Rentenpaket mit den vorgesehenen Einzelmaßnahmen dennoch keine zukunftsweisenden Weichenstellungen vor. Die Verringerung von Altersarmut – ein wesentliches Ziel für die katholischen Verbände – wird nicht erreicht. Stattdessen werden die finanziellen Herausforderungen des Rentensystems verschärft. Dies wird auch daran deutlich, dass der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor außer Kraft gesetzt bleibt. Dieser sollte ursprünglich dazu beitragen, Rentensteigerungen angesichts einer alternden Bevölkerung moderat zu dämpfen. Nach Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung erheblich steigen und in zehn Jahren bei mehr als 21 Prozent liegen.
Dabei sind die Herausforderungen des Rentensystems seit langem bekannt. Das Verhältnis von Beitragszahlenden zu Rentner:innen entwickelt sich seit den späten 1960er Jahren kontinuierlich zu Ungunsten der heutigen Beitragszahlenden. Gleichzeitig hat sich die durchschnittliche Rentenbezugsdauer aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung verdoppelt: Sie liegt derzeit bei mehr als 20 Jahren. Kurzfristige Entlastungen sowie ein Denken in Wahlperioden verhindern Reformoptionen, die auf lange Sicht stabilisierend wirken. Mit der Berufung einer Rentenkommission, die erst in zwei Jahren Reformvorschläge liefern soll, wird die Lösung drängender Probleme in die Zukunft verschoben. Mitglieder der aktuellen Bundesregierung haben schon vor Start der Kommission geäußert, in dieser Legislaturperiode nicht mehr an etwaige Vorschläge anknüpfen zu wollen. Bereits in der Legislaturperiode von 2017 bis 2021 arbeitete eine Kommission zur Reform der Alterssicherung, deren Ideen bis heute auf eine Umsetzung warten.
Die katholischen Verbände fordern eine echte Reform des deutschen Rentensystems. Hierzu gehören unter anderem die Einführung einer solidarischen, steuerfinanzierten Mindestrente im Alter und eine stärkere Berücksichtigung der gesellschaftlich gewünschten Sorgearbeit. Zusätzlich sollte die Rente zu einer allgemeinen Erwerbstätigenversicherung weiterentwickelt werden. Jedes weitere Abwarten erschwert die Problemlösung und beschädigt die Zukunft des Rentensystems. Die gesetzliche Rentenversicherung muss dingend Verlässlichkeit und Stabilität zurückgewinnen, nicht nur für bestehende und baldige Rentner:innen.
Quelle: Pressemitteilung Familienbund der Katholiken – Bundesverband vom 16.10.2025
Familienbund der Katholiken: Ein überfälliger Schritt zur Anerkennung von Familienleistung
Der Familienbund der Katholiken fordert die Bundesregierung auf, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung des Mindestbetrags beim Elterngeld zeitnah umzusetzen. Es handelt sich um einen längst überfälligen Schritt zur besseren Anerkennung der Erziehungsleistung von Müttern und Vätern. Seit 2007 stagnieren die Eckwerte des Elterngeldes. Eine Anpassung würde ein wichtiges Zeichen für Familien setzen, die in den ersten Lebensmonaten ihrer Kinder finanzielle Sicherheit und Zeit für Familie brauchen.
Morgen berät der Deutsche Bundestag über einen Antrag der Fraktion Die Linke zum Elterngeld. Dazu äußert der Präsident des Familienbundes, Ulrich Hoffmann: „Familien tragen Tag für Tag enorme Verantwortung – emotional, organisatorisch und finanziell. Dass der Mindestbetrag des Elterngeldes angehoben wird, wäre ein wichtiger Schritt. Gerade Familien mit geringem Einkommen spüren die steigenden Lebenshaltungskosten besonders stark. Für sie kann eine spürbare Erhöhung des Mindestelterngeldes einen echten Unterschied machen“.
Das Elterngeld ist die zentrale Anerkennungsleistung für die Erziehungsarbeit von Müttern und Vätern. Seit seiner Einführung im Jahr 2007 hat sich die wirtschaftliche Realität grundlegend verändert: Mieten, Energie- und Lebensmittelpreise sind deutlich gestiegen, während das Elterngeld immer mehr an Kaufkraft verloren hat. Das Elterngeld wurde als Rahmen konzipiert, um Einkommensrisiken abzufedern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.
„Alle Eckwerte des Elterngeldes gehören dringend auf den Prüfstand. Denn seit der Einführung sind die Beträge unverändert geblieben – trotz steigender Preise und wachsender gesellschaftlicher Erwartungen an Familien. Wenn die Politik die im Koalitionsvertrag gemachten Versprechen ernst nimmt, dann ist jetzt der Moment, sie einzulösen“ erklärt Hoffmann.
Bei Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 deckte der Mindestbetrag noch das gesamte sächliche Existenzminimum eines Kindes ab. Seither wurde er jedoch nie erhöht und hat damit erheblich an Wert verloren. Diesen Umstand beklagt bereits der neunte Familienbericht 2021. Sachgerecht wäre, das Mindestelterngeld am sächlichen Kinderexistenzminimum zu orientieren. Konkret bedeutet dies, den Betrag auf mindestens 500 Euro pro Monat zu erhöhen.
Um das Elterngeld an die wirtschaftliche Realität anzupassen, müssen jedoch alle Eckwerte, aus denen sich die Lohnersatzrate berechnet, angehoben werden. Dies betrifft neben dem Mindestbetrag von 300 Euro den Maximalbetrag von 1.800 Euro und die Einkommensgrenzen, aus denen sich die Lohnersatzrate ergibt. Die Anhebung des Elterngeldes würde nicht nur eine finanzielle Entlastung bedeuten, sondern wäre vor allem auch ein gesellschaftliches Signal der Wertschätzung.
„Wenn Politik wirklich Familien fördern will, muss sie die finanzielle Absicherung in der frühen Familienphase regelmäßig an die Inflation anpassen“, so Hoffmann weiter. „Eltern, die Zeit mit ihrem Kind verbringen, leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Diese Zeit darf nicht zum finanziellen Risiko werden. Das Elterngeld ist nicht nur eine Sozialleistung, sondern eine Anerkennungs- und Förderleistung für elterliche Fürsorge und Verantwortung.“
Bei einer Reform des Elterngeldes hält es der Familienbund außerdem für wichtig, die Beteiligung von Vätern an der Kindererziehung durch zusätzliche Partnermonate zu fördern und das komplexe Antragsverfahren für Familien zu erleichtern. Denn dieses stellt für Familien eine große Belastung dar.
Quelle: Pressemitteilung Familienbund der Katholiken – Bundesverband vom 09.10.2025
LSVD+: Bundestag debattiert über Grundgesetzergänzung für LSBTIQ*
LSVD⁺: Chance ergreifen!
Heute hat der Bundestag über die Ergänzung von Art. 3 Abs. 3 GG zum Schutz von LSBTIQ* beraten. Dazu kommentiert Bundesvorstandsmitglied Alexander Vogt für den LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt:
“Die explizite Nennung von LSBTIQ* im Grundgesetz ist eine jahrzehntealte Forderung der Community. In der heutigen Bundestagsdebatte wurde deutlich, wie dringend geboten eine Ergänzung von Art. 3 Abs. 3 GG ist: Die Zahl der Straftaten im Bereich „sexuelle Orientierung“ und „geschlechtsbezogene Diversität“ hat sich seit 2010 nahezu verzehnfacht. Angriffe gegen queere Menschen, queere Orte – unsere Community – sind mittlerweile alltäglich. Wir begrüßen, dass Vertreter*innen aller demokratischen Parteien den Bedarf nach einem besseren Schutz vor Diskriminierung und Gewalt für LSBTIQ* heute so klar benannt haben.
Angriffe auf queeres Leben gehen nicht nur von Privatpersonen aus, sondern auch von Parteien und Regierungen – weltweit. In Ungarn, den USA oder kürzlich in der Slowakei werden die Rechte von LSBTIQ* beschnitten. Eine explizite Nennung von LSBTIQ* im Grundgesetz hat einen wichtigen symbolischen Wert, der in diesen politischen Zeiten nicht zu unterschätzen ist. Das haben auch die verbalen Entgleisungen der AfD in der heutigen Debatte verdeutlicht. Und auch materiell-rechtlich macht die Einführung einer expliziten Kategorie einen Unterschied: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz sexueller Identität ist zwar mittlerweile gefestigt, aber kann sich dennoch wieder ändern. Art. 3 Abs. 1 GG hat schwule und bisexuelle Männer im unrühmlichen „Homosexuellenurteil“ des Bundesverfassungsgerichts von 1957 nicht geschützt.
Die Bundesratsinitiative vom 26.09. und die heutige Debatte zeigen große Einigkeit in der Sache. Wir fordern jetzt alle Abgeordneten auf, konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch wir stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Diese Gelegenheit muss genutzt werden: Historische Schutzlücke schließen, Grundgesetz sturmfest für die Zukunft machen!”
Weiterlesen:
- Jetzt Kampagne unterstützen und Abgeordnete anschreiben
- Queerfeindliche Gewalt: Angriffe auf Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen (LSBTIQ*)
- Bundesratsinitiative zu Artikel 3 verabschiedet
Quelle: Pressemitteilung LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 09.10.2025
Paritätischer: "Sprengstoff für die Demokratie" - Neuer Regierungsbericht: Vermögensverteilung in Deutschland extrem ungleich
Jeder 6. Mensch in Deutschland lebt in Armut. Das belegt auch der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Gleichzeitig besitzt das reichste Zehntel über 54% des Vermögens, während die untere Hälfte der Bevölkerung nur 3% des Vermögens besitzt. „Diese soziale Spaltung ist Sprengstoff für unsere Demokratie”, fasst Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverband, den 683-seitigen Bericht zusammen.
Der Paritätische Gesamtverband bewertet den Entwurf des Siebten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung als ernüchterndes Dokument der sozialen Schieflage in Deutschland. „Der Bericht zeigt glasklar: Armut bleibt in Deutschland ein Massenphänomen, das sich zunehmend verfestigt. Gleichzeitig wird das Thema Reichtum weitgehend ausgeblendet – das ist ein fatales politisches Signal“, erklärt Joachim Rock.
Laut Bericht liegt die Armutsquote seit Jahren stabil auf viel zu hohem Niveau zwischen 14 und 18 Prozent. Besonders betroffen sind Arbeitslose, Alleinerziehende, Kinder, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen. Selbst Erwerbstätigkeit schützt längst nicht zuverlässig vor Armut: Jeder sechste Job ist ein Niedriglohnjob. Hinzu kommt, dass die Reallöhne in den Krisenjahren trotz Mindestlohnerhöhungen gesunken sind.
Der Verband sieht sich dabei in seinen eigenen Analysen bestätigt: Die Befunde zeigen, dass Wohnen zu einem Schlüsselfaktor sozialer Ungleichheit geworden ist. Fast jeder achte Haushalt muss mehr als 40 Prozent seines Einkommens fürs Wohnen aufwenden. Bei Menschen in Armut ist es sogar mehr als jeder dritte Haushalt. „Ohne Erbschaften bleibt der Immobilienerwerb für junge Menschen außer Reichweite. Sozialer Aufstieg wird aussichtslos, wenn nicht einmal der Ausstieg aus Armut ermöglicht wird“, erklärt Rock. „Wir brauchen endlich ernsthafte Maßnahmen zur Umverteilung und Reduzierung von Ungleichheit“. Das reichste Zehntel der Bevölkerung verfügt über 54 Prozent des Nettovermögens, während die untere Hälfte der Bevölkerung nur 3 Prozent des Nettovermögens besitzt.
Der Bericht dokumentiere nicht nur eine extreme Vermögensungleichheit, sondern zeige auch, dass soziale Ungleichheit in ungleicher politischer Teilhabe münde und so Demokratie und Zusammenhalt gefährde. Schon jetzt schwinde gerade bei Armutsbetroffenen das Vertrauen in Institutionen. „Diese Kluft gefährdet den sozialen Zusammenhalt und die Demokratie. Wer über Armut spricht, darf über Reichtum und Privilegien nicht schweigen“, mahnt Rock. „Es reicht nicht, nur Armut zu bilanzieren. Was fehlt, ist der politische Wille zu einer Umverteilung von oben nach unten. Armut ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. Der Bericht liefert die Daten – nun ist es Aufgabe der Politik, endlich entschlossen zu handeln.“
Der Paritätische fordert deshalb die stärkere Beteiligung von Superreichen an der Finanzierung des Gemeinwesens, die solidarische Finanzierung der Sozialversicherungen durch ihren Ausbau zu einer sozialen Bürgerversicherung, eine gerechtere Erbschafts- und Einkommensteuer, eine armutsfeste Grundsicherung und massive Investitionen in sozialen Wohnungsbau, Bildung, Inklusion und Gesundheit.
Quelle: Pressemitteilung Der Paritätische Gesamtverband vom 02.10.2025
Paritätischer: Paritätischer kritisiert Bildungspaket: “Viel Bürokratie, viel zu wenig Teilhabe”
Vier von fünf berechtigten Kindern ohne Teilhabeansprüche.
Nach einer Studie der Paritätischen Forschungsstelle erreicht die Teilhabeleistung im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) im Bundeschnitt mindestens 81 Prozent der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen nicht. Für vier von fünf anspruchsberechtigten Kindern läuft diese Leistung ins Leere. Damit schreibt diese Säule des BuT auch 14 Jahre nach seiner Einführung eine Misserfolgsgeschichte fort.
Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung soll Kindern und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Familien eigentlich helfen, Freizeit- und Sportangebote wahrnehmen zu können, die ihre Eltern ihnen sonst nicht finanzieren können. Die Bundesregierung plant laut Koalitionsvertrag, die Teilhabeleistung von bisher 15 Euro pro Kind auf 20 Euro im Monat zu erhöhen.
Nach aktuellen Erkenntnissen des Paritätischen Gesamtverbandes verfehlt jedoch gerade diese Teilhabeleistung des Pakets die beabsichtigte Wirkung fast vollständig. Der Wohlfahrtsverband schlägt deshalb vor, die geplanten 20 Euro Teilhabeleistung pauschal an alle leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche auszuzahlen. Zudem gilt es einen Rechtsanspruch auf Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zu schaffen, damit das Paket seine Wirkung entfalten kann.
Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Verbandes erklärte dazu: “Die von der Regierung beabsichtigte Entbürokratisierung kann ganz praktisch damit beginnen, dass die geplanten 20 Euro pro Kind monatlich pauschal ausgezahlt werden, ohne aufwändige Nachweise und Prüfungen.
Die bisherige Teilhabeleistung reiche nicht aus: “Die Teilhabeleistung ist gut gedacht, die Umsetzung oftmals schlecht gemacht. Die regional massiv ungleichen Teilhabequoten zeigen, dass Teilhabechancen häufig von der Postleitzahl abhängen. Damit dürfen wir uns niemals abfinden”, so Rock. Er unterstreicht, dass bei einer Kinderarmutsquote von über 15 Prozent hier die Rede von Millionen Kindern in Deutschland ist: “In einem derart reichen Land wie Deutschland ist es ein Ärgernis, wenn Kinder nicht zum Fußball- oder Ballettunterricht gehen können. Das muss dringend geändert werden, zumal jegliche Bemühungen hin zu einer Kindergrundsicherung eingestellt scheinen.” Darüber hinaus betonte Rock, dass dieses Problem bereits seit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes 2011 bestünde und man von der Bundesregierung endlich eine Lernkurve erwarten könne.
Als einen Grund für die geringe Nutzung des Angebotes vermutet der Paritätische Gesamtverband die bürokratischen Hürden für die Inanspruchnahme. Hier schlägt der Paritätische eine starke Vereinfachung der Vorgänge vor. Die Leistungen sollten pauschal an alle Kinder und Jugendlichen, die Ansprüche auf sie haben, ausgezahlt werden. Diese pauschale Auszahlung ist auch ein Beitrag zur Entbürokratisierung. Außerdem sei es wichtig, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für junge Menschen vor Ort durch Rechtsansprüche auszubauen und abzusichern.
Die Expertise können Sie hier herunterladen.
Dokumente zum Download
Teilhabequoten im Fokus. (2 MB)
Quelle: Pressemitteilung Der Paritätische Gesamtverband vom 30.09.2025
VdK: Angehörige leisten unbezahlte Pflege im Wert von 206 Milliarden Euro
- VdK kritisiert aktuelle Debatte um Sparpläne in der Pflege
- Bentele fordert stärkere Anerkennung und Unterstützung pflegender Angehöriger
Pflegende Angehörige in Deutschland leisten weit mehr als nur private Fürsorge. Laut einer Studie der Hochschule Zittau/Görlitz hätten die informellen Pflegeleistungen im Jahr 2023 – wären sie von angelernten Pflegehilfskräften erbracht worden – einen Wert von rund 206 Milliarden Euro gehabt. „Angesichts dieser enormen Summe unentgeltlich erbrachter Pflegeleistungen sind aktuelle Debatten um Einsparungen in der Pflege ein Schlag ins Gesicht der pflegenden Angehörigen“, kritisiert VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Sparpläne sind kein Ersatz für politische Fantasielosigkeit, und vor allem nicht für fehlende Strategien. Wenn sich nichts ändert, werden es auch in Zukunft die pflegenden Angehörigen sein, die den Laden am Laufen halten.“
Laut Statistischem Bundesamt wurden im Dezember 2023 etwa 86 Prozent (4,9 Millionen Menschen) der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt, überwiegend durch Angehörige. Wer die Abschaffung des Pflegegrads 1 befürwortet, übersieht nicht nur den aktuellen gesellschaftlichen Wert und das Engagement der pflegenden Angehörigen, sondern ignoriert auch die zukünftigen Herausforderungen, so Bentele: „Mit dem demografischen Wandel, insbesondere dem Eintritt der Babyboomer-Generation ins Pflegealter, und dem anhaltenden Fachkräftemangel in der professionellen Pflege wird der Bedarf an pflegenden Angehörigen massiv steigen.“
Der Sozialverband VdK fordert eine deutliche Stärkung und Anerkennung pflegender Angehöriger ebenso wie verbindliche und nachhaltige Lösungen zur Absicherung der Pflegeversicherung. Dazu gehört, dass Angehörige entlastet werden — finanziell, institutionell und durch bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Der Verband setzt sich zudem für eine einheitliche Pflegeversicherung ein, in die alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen und die alle Einkommensarten berücksichtigt.
Erwartungen an Einsparungen in der Pflege zu hoch
Das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat ein theoretisches Einsparpotenzial von rund 1,8 Milliarden Euro jährlich errechnet, sollten alle Pflegebedürftigen im Pflegegrad 1 sämtliche ihnen zustehenden Leistungen in Anspruch nehmen. In der Realität lagen die Ausgaben 2024 laut GKV-Spitzenverband jedoch bei nur 640 Millionen Euro, da viele Pflegebedürftige die ihnen zustehenden Leistungen nicht oder nicht vollständig in Anspruch nahmen. Diese Zahlen belegen, dass die Erwartungen an Einsparungen bei einer Abschaffung des Pflegegrads 1 zu hoch gegriffen sind. Gleichzeitig verunsichert die Diskussion Pflegebedürftige und pflegende Angehörige.
Weitere Informationen
Die Studie „Der monetäre Wert der Pflegeleistungen von An- und Zugehörigen in Deutschland“ von Prof. Dr. Andreas Hoff, Prof. Dr. Steffi Höse, Prof. Dr. Martin Knoll und Prof. Dr. Notburga Ott steht auf der Website des GAT Institut für Gesundheit, Altern, Arbeit und Technik an der Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG) zum Download bereit.
Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 11.10.2025
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
iaf: Fachtagung: Migrationsdebatten versus Familienrealitäten
Termin: 24. Oktober 2025
Veranstalter: verband binationaler familien und partnerschaften
Ort: Frankfurt
Die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Migrationsdebatten konzentrieren sich derzeit vor allem auf die Abwehr von Migration. Das ist kein neues Phänomen. Familien mit Migrationsgeschichte gehören jedoch schon lange zur Mitte unserer Gesellschaft, sie sind ein wesentlicher Bestandteil. Ihre Stimmen müssen daher gehört, ihre Anliegen ernst genommen und ihre Beiträge sichtbar gemacht werden – in der Politik ebenso wie im alltäglichen Zusammenleben.
Die Fachtagung stellt daher diese Familien und ihre Rolle in unserer Gesellschaft ins Zentrum. Auch angesichts zunehmender Diskriminierung, Ausgrenzung und Angriffen auf Vielfalt. Wir möchten den Fokus umkehren und die Lebensrealitäten dieser Familien sichtbar machen. Mit einem Rückblick auf frühere Migrationsdebatten, einer aktuellen Analyse, mit Beiträgen aus der Beratungspraxis, im Gespräch mit Politik und einer Gesprächsrunde über die Perspektiven binationaler Menschen.
Anmeldung: https://eveeno.com/ft2025
Mehr Infos hier.
ehs: Fachveranstaltung „Niedrigschwellige Familienbildung“
Termin: 10. November 2025
Veranstalter: Evangelische Hochschule Dresden (ehs)
Ort: Online
es wird herzlich eingeladen zur Fachveranstaltung „Niedrigschwellige Familienbildung von und mit Familien in kritischen Lebenskonstellationen“, die zugleich den Abschluss des gleichnamigen Forschungs- und Praxisentwicklungsprojektes bildet.
Geplantes Programm:
- Fachimpuls der Projektleitung Prof. Dr. Christiane Solf
- Vorstellung von Projektergebnissen und -publikation
- Einblicke in die Praxisentwicklung mit Praxispartner:innen
- Fachgespräch mit den Kooperationspartner:innen Ulrike Stephan (Referentin für Familienbildung, Ev. Arbeitsgemeinschaft Familie e.V.) und Dr. Verena Wittke (Referentin für Familienbildung, AWO Bundesverband e.V.)
- Zwischendurch: Raum für Ihre Fragen und Gedanken
Die Veranstaltung wird am Montag, den 10. November 2025 von 12:00 bis 16:30 online stattfinden.
Um am Zoom-Meeting teilzunehmen, klicken Sie bitte auf diesen Link: https://ehs-dresden-de.zoom-x.de/j/67057412294 oder geben Sie die Meeting-ID 670 5741 2294 ein.
Für unsere Planung danken wir Ihnen, wenn Sie uns vorab per E-Mail über Ihre Teilnahme informieren.
Paritätischer: Inforeihe Kinder, Jugend und Familie 2025: Kinder online – mögliche Risiken und Maßnahmen zum Schutz ihrer Daten
Termin: 11. November 2025
Veranstalter: Der Paritätische Gesamtverband
Ort: Online
Die Daten von Kindern gelten als besonders schützenswert. Gleichwohl finden sie sich in großen Mengen auf digitalen Plattformen und in sozialen Netzwerken wieder – oftmals freiwillig von Kindern selbst oder ihren Eltern und Verwandten preisgegeben.
Über mögliche Risiken und Maßnahmen zum Schutz der Daten von Kindern im digitalen Raum informiert Torsten Krause an den Beispielen Sharenting und Influencing. Anschließend laden wir zu einer intensiven Diskussion über das Thema ein.
Torsten Krause arbeitet als Kooperative Projektleitung „Kinderschutz und Kinderrechte in der digitalen Welt“ bei der Stiftung Digitale Chancen. Von 2020 bis 2023 leitete er den Expert*innenkreis für Kinderrechte in der digitalen Welt beim Deutschen Kinderhilfswerk. Seit 2025 vertritt er die National Coalition zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Deutschland im Beirat der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz.
Für die Teilnahme an der Fachveranstaltung werden keine Beiträge erhoben.
Verantwortlich für inhaltliche Fragen
Borris Diederichs, Referent Kinder- und Jugendhilfe, jugendhilfe(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 328
Verantwortlich für organisatorische Fragen
Sabine Haseloff, Sachbearbeitung Kinder- und Jugendhilfe, jugendhilfe(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 327
DV: FREIE PLÄTZE bei der Einladung zur digitalen Fachveranstaltung "Alles bleibt anders? Familie nach Trennung und Scheidung, Empfehlungen des Zehnten Familienberichts in der Diskussion"
Termin: 12. November 2025, 13:00–16:00 Uhr
14. November 2025, 09:30–12:30 Uhr
17. November 2025, 09:30–12:30 Uhr
Veranstalter: Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
Ort: Online
Trennung und Scheidung verändern Familien grundlegend. Allein- und getrennt erziehende Familien stehen oft vor der Herausforderung, Erwerbsarbeit, Sorgearbeit und das Wohl ihrer Kinder gleichzeitig zu bewältigen. Der Zehnte Familienbericht der Bundesregierung nimmt diese Lebenslagen in den Blick und formuliert Handlungsempfehlungen zu rechtlichen Rahmenbedingungen, Vereinbarkeit, ökonomischer Eigenständigkeit sowie Unterstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche.
Mit Expert*innen aus Wissenschaft, Politik, Justiz, Verwaltung und Verbänden diskutieren wir zentrale Empfehlungen des Zehnten Familienberichts und ihre Umsetzungsperspektiven für Praxis und Politik.
Anmeldeschluss ist der 20. Oktober 2025.
Den Link zur Onlineanmeldung sowie zum Veranstaltungsprogramm finden Sie unter:
Paritätischer: Inforeihe Kinder, Jugend und Familie: Psychische Gesundheit stärken: Junge Menschen am Übergang Schule-Beruf
Termin: 18. November 2025
Veranstalter: Der Paritätische Gesamtverband
Ort: Online
Der Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf ist für junge Menschen vielerorts eine Zeit mit besonderen Herausforderungen – die auch mit psychischen Belastungen und Erkrankungen einhergeht. Wie können die jungen Menschen sowie Fachkräfte im Umgang mit psychischen Krisen unterstützt werden?
In der Online-Veranstaltung werden folgende Fragen und Themen behandelt: Welche Bedeutung hat psychische Gesundheit beim Übergang von der Schule in den Beruf – und welche Folgen haben Belastungen in dieser Phase? Wie können junge Menschen in dieser Zeit bestmöglich unterstützt werden? Welche Netzwerke und Kooperationspartner braucht es, um einen gelingenden Start ins Berufsleben zu ermöglichen?
Das Präventionsprogramm „Aufmachen! Psychisch fit in Berufsschule und Beruf“ wird vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, psychische Krisen anzusprechen, das Hilfesuchverhalten zu stärken, gesundheitsförderliche Prozesse anzustoßen und das Stigma von psychischen Erkrankungen zu reduzieren.
Mit:
Wiebke Nonne, Programmleitung »Aufmachen! Psychisch fit in Berufsschule und Beruf«, Irrsinnig Menschlich e. V., Leipzig
Für die Teilnahme an der Fachveranstaltung werden keine Beiträge erhoben.
Verantwortlich für inhaltliche Fragen
Jennifer Puls, jsa(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 325
Gabriele Sauermann, juvo(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 317
Verantwortlich für organisatorische Fragen
Mandy Gänsel, mandy.gaensel(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 476
FES: Tagung "Die 4-Tage-Woche im Lichte von gesellschaftlichem Wandel, Erschöpfung und psychischer Bedürfnisse"
Termin: 28. November 2025
Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung
Ort: Berlin
Burn-out und psychische Erschöpfung nehmen seit Jahren drastisch zu – ein deutliches Zeichen für die strukturelle Überforderung unserer Arbeitswelt. Gleichzeitig zeigen Studien, dass Arbeitszeitverkürzungen bei Lohnausgleich, wie etwa die 4-Tage-Woche, positive Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden haben. Dennoch setzt die aktuelle Bundesregierung auf Flexibilisierung und steuerliche Anreize für Mehrarbeit – ein Kurs, der Fragen aufwirft.
Gemeinsam mit u.a. Prof. Dr. Brigitta Danuser, Universität Lausanne, Stefan Boes, Autor und Journalist und Jan Dieren MdB, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales möchten wir diskutieren, wie die 4-Tage-Woche einen Beitrag zu einer gesünderen Gesellschaft leisten kann – und welche politischen sowie praktischen Rahmenbedingungen dafür notwendig wären. Moderiert wird die Diskussion von Salwa Houmsi.
Die Tagung findet am Freitag, den 28. November 2025 von 14:00 – 20:15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Stiftung, Haus 1, Saal 1, Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin statt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und die Diskussion.
Alle aktuellen Infos zur Veranstaltung finden Sie auch auf unserer Webseite.
WEITERE INFORMATIONEN
"Wegbereiterinnen XXIV" Präsentation des Wandkalenders 2026
Montag, 13.10.2025 | Beginn 19:30 Uhr | wieder im RegenbogenKino, Lausitzer Str. 22, 10999 Berlin-Kreuzberg

Zur Präsentation des neuen Kalenders Wegbereiterinnen laden ein: Gisela Notz (Herausgeberin und Autorin), Heike Notz (Moderatorin), Bernd F. Gruschwitz, Annika Klanke und alle AutorInnen des Kalenders 2026.
Christa Weber und Jutta Kausch – beide Schauspielerin und Sängerin, begleitet vom Gitarristen Olaf Schäfer würdigen für uns die vorgestellten Frauen mit ihren Liedern.
Von den im Kalender vorgestellten Frauen werden präsentiert:
Pauline Roland/Edith Jacobson/ Phillis Wheatley
Im Jahr 2026 erscheint der Wandkalender „Wegbereiterinnen“ in der 24. Ausgabe. Seit er 2003 zum ersten Mal erschienen ist, haben wir 276 Frauenbiografien angesammelt. Mehr als 100 HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, NaturwissenschaftlerInnen, HandwerkerInnen, LehrerInnen und viele andere haben in den Kalendern über Frauen geschrieben, die für eine friedliche Welt gekämpft haben.
Die Einladung kann gerne weitergegeben werden.
Dies ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Geschichtssalon des Beginenhof Kreuzberg und der Regenbogenfabrik
Eintritt frei, Spenden für die KünstlerInnen sind willkommen.