AUS DEM ZFF
Augen auf bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025: Geben Sie guter Familienpolitik Ihre Stimme – gehen Sie wählen!
Es ist soweit: Am kommenden Sonntag, den 23. Februar 2025, steht die Bundestagswahl an. Das ZFF hat in den letzten Wochen mit einer Kampagne darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, Kinder, Jugendliche und Familien wieder in den politischen Fokus zu rücken. Denn Familienpolitik betrifft uns alle! Auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Bluesky wurden die Themen Kinder- & Familienarmut, Vereinbarkeit & Zeitpolitik, Pflege in Familien sowie Gleichstellung & Vielfalt beleuchtet und damit die ZFF-Wahlforderungen veröffentlicht.
Britta Altenkamp, Vorsitzende des ZFF, erklärt dazu: „In diesem kurzen Bundestagswahlkampf wurde Familienpolitik kaum beachtet – ein alarmierendes Signal. Denn sie ist kein Nebenschauplatz, sondern ein zentraler Pfeiler sozialer Gerechtigkeit: Sie stärkt die wirtschaftliche Stabilität, sichert Fachkräfte und entlastet die Sozialsysteme. Familienpolitik ist Gesellschaftspolitik. Eine zukunftsorientierte Politik muss die vielfältigen Bedürfnisse von Familien endlich wieder in den Mittelpunkt rücken – für starken gesellschaftlichen Zusammenhalt, eine wehrhafte Demokratie und eine offene, vielfältige Gesellschaft, die entschieden gegen Rassismus, Intoleranz und Diskriminierung einsteht.
Für uns bedeutet eine gute Politik für Familien: Vielfalt anerkennen, reproduktive Rechte und Selbstbestimmung stärken, Generationenzusammenhalt festigen, Chancengerechtigkeit sichern, echte Gleichstellung und Inklusion durchsetzen sowie finanzielle Sicherheit garantieren. Darüber hinaus ist die Schaffung einer verlässlichen Betreuungsinfrastruktur und bezahlbaren Wohnraums für alle unabdingbar. Doch nicht alle Parteien teilen diese Ziele. Deshalb: Am Sonntag genau hinsehen und mit Ihrer Stimme ein Zeichen für eine starke, solidarische Familienpolitik setzen!“
Die Wahlforderungen des Zukunftsforum Familie e. V., die wir an alle demokratischen Parteien verschickt haben, finden Sie hier: https://www.zukunftsforum-familie.de/wp-content/uploads/ZFF_unsere_Wahlforderungen.pdf
Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 20.02.2025
Über 130 Organisationen – darunter auch das ZFF – fordern: Bessere Gesundheitsversorgung statt Ausgrenzung
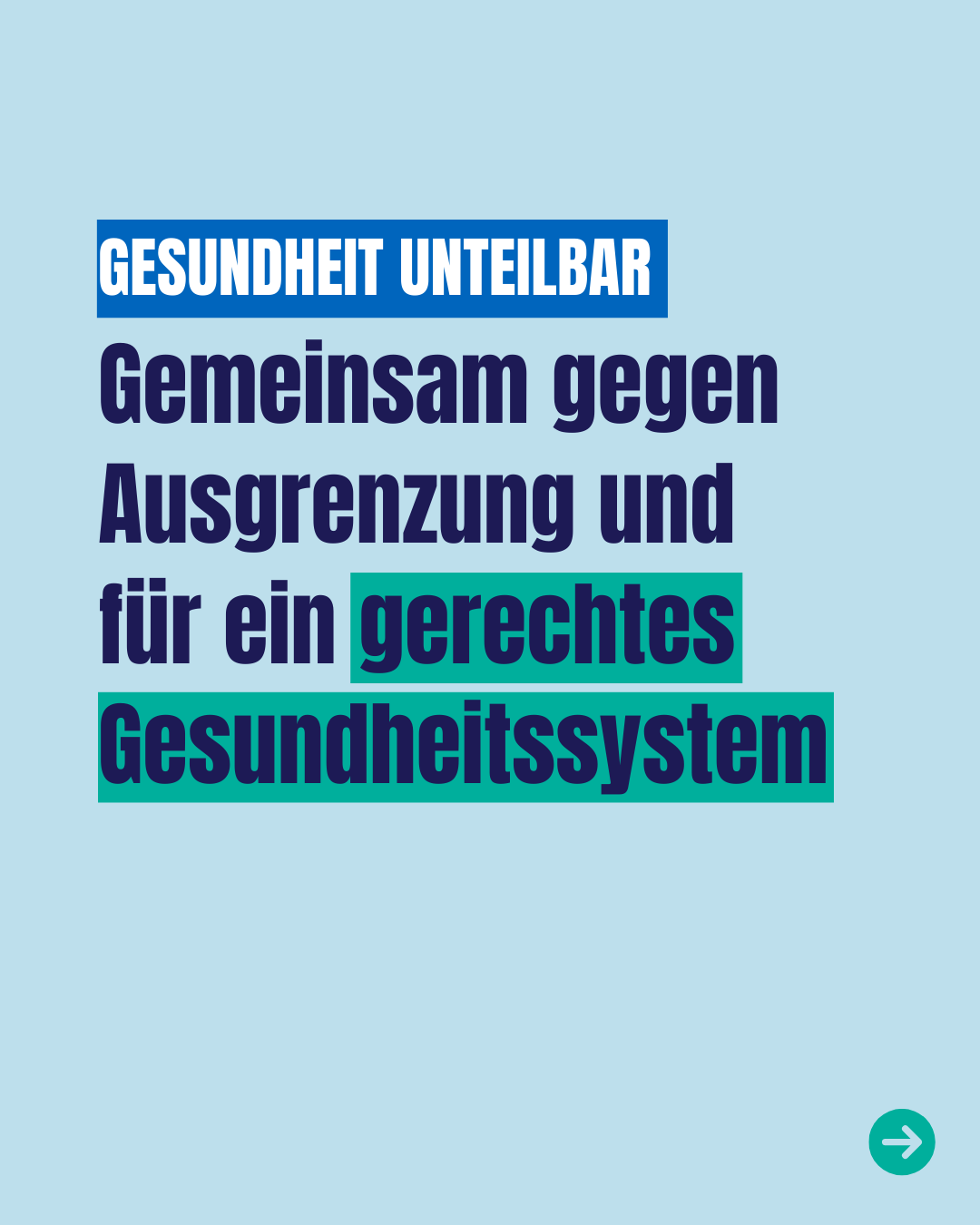 Für einen verbesserten Zugang zu Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Deutschland und gegen die Ausgrenzung von Migrant*innen und sozial benachteiligten Gruppen – dazu ruft Ärzte der Welt gemeinsam mit 136 Verbänden, Gewerkschaften und Organisationen auf. Unter anderem haben das Zukunftsforum Familie, die Sozialverbände Vdk und SoVD, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Verbraucherzentrale Bundesverband, die Bundesvereinigung Lebenshilfe sowie die Wohlfahrtverbände Diakonie, AWO und der Paritätische Gesamtverband den Appell „Gesundheit unteilbar – Gemeinsam gegen Ausgrenzung und für ein gerechtes Gesundheitssystem“ unterzeichnet.
Für einen verbesserten Zugang zu Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Deutschland und gegen die Ausgrenzung von Migrant*innen und sozial benachteiligten Gruppen – dazu ruft Ärzte der Welt gemeinsam mit 136 Verbänden, Gewerkschaften und Organisationen auf. Unter anderem haben das Zukunftsforum Familie, die Sozialverbände Vdk und SoVD, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Verbraucherzentrale Bundesverband, die Bundesvereinigung Lebenshilfe sowie die Wohlfahrtverbände Diakonie, AWO und der Paritätische Gesamtverband den Appell „Gesundheit unteilbar – Gemeinsam gegen Ausgrenzung und für ein gerechtes Gesundheitssystem“ unterzeichnet.
Die Organisationen zeigen sich besorgt über populistische und menschenverachtende Aussagen bis weit in die politische Mitte hinein. Diese würden die berechtigte Unzufriedenheit vieler Menschen mit dem Gesundheitssystem ausnutzen, um gegen Migrant*innen, Geflüchtete und andere marginalisierte Gruppen zu hetzen. Anstatt strukturelle Probleme in der Gesundheitsversorgung anzugehen, würden so Gruppen gegeneinander ausgespielt.
Eine Politik, die Grenzen schließen, Migration verhindern und Sozialleistungen für ohnehin benachteiligte Personengruppen streichen wolle, so der Appell, trüge nicht zu Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung bei, sondern würde diese im Gegenteil für große Teile der Bevölkerung weiter verschlechtern. Sollten rechtextreme Kräfte weiter erstarken, sei damit zu rechnen, dass dringend benötigte medizinische Fachkräfte und Pflegepersonal mit Migrationsgeschichte oder aus dem Ausland Deutschland verlassen beziehungsweise in Zukunft meiden werden.
Neben einem Aufruf zur Solidarität und für eine bedarfsgerechte, diskriminierungsfreie gesundheitliche Versorgung aller Menschen in Deutschland formulieren die Organisationen auch konkrete Forderungen – darunter die Schaffung eines einheitlichen, sozial gerechten und nachhaltig finanzierten Krankenversicherungssystems.
Lesen Sie den Appell hier: http://aerztederwelt.org/unteilbar
SCHWERPUNKT I: Bundestagswahl
AWO fordert konsequente Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit
Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat gleichstellungspolitische Forderungen an die künftige Bundesregierung formuliert. Dazu erklärt Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt:
„Die Bundestagswahl 2025 wird auch für die Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft eine Richtungsentscheidung sein. Die neue Bundesregierung muss Frauen- und gleichstellungspolitische Themen zur Priorität machen und sich für eine gleichberechtigte und gerechte Gesellschaft einsetzen. Dazu gehören vor allem die konsequente Umsetzung menschenrechtlicher Verpflichtungen im Bereich sexueller und reproduktiver Rechte und der schnelle bedarfsgerechte Ausbau des Schutzes vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt.“
Eine zentrale Forderung der AWO ist die vollständige Streichung des §218 StGB. Noch immer macht er das selbstbestimmte Beenden einer Schwangerschaft zu einer Straftat – mit weitreichenden Folgen.
„§218 kriminalisiert und stigmatisiert ungewollt Schwangere und Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen, gleichermaßen. Die Streichung würde nicht nur die Kriminalisierung und Diskriminierung beenden, sondern auch die medizinische Versorgung verbessern: Schwangerschaftsabbrüche könnten als reguläre Gesundheitsleistung anerkannt und von den Krankenkassen übernommen werden. Die nächste Bundesregierung muss sicherstellen, dass alle Schwangeren angemessen versorgt und unterstützt werden“, so Sonnenholzner.
Auch beim Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt gibt es dringenden Handlungsbedarf, so der Wohlfahrtsverband. Zwar wurde am Ende dieser Legislatur mit dem Gewalthilfegesetz ein Meilenstein erreicht, doch das reiche nicht aus: „Das verabschiedete Gewalthilfegesetz bleibt hinter den Forderungen zurück, die für eine bedarfsgerechte Unterstützung von Betroffenen von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt notwendig wären. Wir brauchen ein Hilfesystem, das alle Betroffenen schützt – Frauen ebenso wie trans, inter und nicht-binäre Personen“, so Sonnenholzner.
Die Arbeiterwohlfahrt hat zur Bundestagswahl 15 Kernforderungen an die nächste Bundesregierung formuliert, darunter die Streichung des §218 StGB sowie ein bedarfsgerechtes Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Mehr dazu hier: awowaehltdemokratie.awo.org.
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 17.02.2025
DGB: Gemeinsamer Wahlaufruf von Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger und Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Gehen Sie zur Wahl. Nutzen Sie Ihre Stimme als Bürgerin und Bürger dieses Landes.
Die Herausforderungen für die künftige Bundesregierung könnten nicht größer sein. Die deutsche Wirtschaft muss wieder wachsen, damit wir Beschäftigung und Wohlstand sichern. Die Deindustrialisierung Deutschlands muss gestoppt werden. Und wir brauchen Antworten auf die sich mit Präsident Donald Trump tiefgreifend ändernden transatlantischen Beziehungen.
Auf diese Herausforderungen gibt es keine schnellen Lösungen. Deutschland auf den richtigen Kurs zu bringen, wird viel Kraft kosten. Deshalb brauchen wir eine stabile Regierung, die eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet und die die Probleme unseres Landes als gemeinschaftliches Projekt anpackt.
Wir erwarten von der neuen Regierung, dass sie unsere Wirtschaft stärkt, unsere Arbeitswelt zukunftsfähig gestaltet und dabei den Beschäftigten eine sichere Perspektive schafft. Sie muss in der Lage sein, dringende Aufgaben wie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, Energiekosten, Digitalisierung und Sicherung des Fachkräftebedarfes zu stemmen. Und sie muss eine starke und zusammenführende Rolle in Europa übernehmen.
Für die anstehende Bundestagswahl geben wir Ihnen keine Wahlempfehlung. Es ist allein Ihre Entscheidung, wen Sie wählen.
Wir bitten Sie jedoch um drei Dinge:
- Gehen Sie zur Wahl. Nutzen Sie Ihre Stimme als Bürgerin und Bürger dieses Landes.
- Setzen Sie sich mit den Programmen der Parteien auseinander. Hinterfragen Sie die Konzepte. Überlegen Sie, was in der jetzigen Situation das Beste für Sie und unser Land ist.
Achten Sie bitte darauf, dass die Partei, für die Sie sich entscheiden, zu den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 20.02.2025
djb: Für Gleichberechtigung und Demokratie! Der djb veröffentlicht Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2025
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) hat seine Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2025 veröffentlicht. Darin analysiert der djb die Wahlprogramme der Parteien SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, Linke und BSW umfassend mit Blick auf Themen der Geschlechtergerechtigkeit.
„Mit unseren Wahlprüfsteinen zeigen wir auf, welche Parteien sich wirklich für Gleichstellung, etwa im Bereich Gewaltschutz oder bei Fragen der reproduktiven Gerechtigkeit, einsetzen – und welche nicht“, erklärt Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb.
Der djb rückt die Wahlprüfsteine ab heute durch eine Social-Media-Kampagne in den Fokus der Öffentlichkeit. Zudem erscheint in Kürze eine Folge des djb-Podcasts Justitias Töchter, in der die Analysen und Forderungen ausführlich besprochen werden.
Bereits im November 2024 hat der djb seine zentralen Wahlforderungen für die kommende Legislaturperiode formuliert und sie seither kontinuierlich aktualisiert. Nun können Interessierte in den Wahlprüfsteinen des djb gezielt nachlesen, inwieweit die Parteien diese Forderungen in ihren Wahlprogrammen aufgreifen. In der Gesamtschau werden enorme Unterschiede zwischen den Parteien deutlich: Von Fragen der sozialen Sicherung und des Familienlastenausgleichs, ökonomischer Gleichberechtigung und sozialer Teilhabe bis hin zu einer geschlechtergerechten Daten- und Digitalpolitik zeigen sich in den Parteiprogrammen nicht nur verschiedene Schwerpunktsetzungen. Vielmehr offenbart sich auch, dass einige Parteien bestrebt sind, Geschlechtergerechtigkeit zu verhindern – und damit bereits erreichte Fortschritte gefährden und zurückdrehen wollen.
Der djb ruft alle Wahlberechtigten auf, sich vor der Bundestagswahl umfassend zu informieren und für eine Politik der Gleichstellung einzutreten. „Wir sehen, wie inzwischen auch die etablierten Parteien immer weiter nach rechts rücken. Als Wahlberechtigte können wir dem am 23. Februar 2025 etwas entgegensetzen. Alle, die die Chance haben, sich mit ihrer Stimme für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen, sollten sie jetzt nutzen, bevor es zu spät ist“, betont Lucy Chebout, Vizepräsidentin des djb. „Demokratie und Gleichstellung sind keine Selbstverständlichkeit. Gerade jetzt ist es entscheidend, sich aktiv über die Wahlprogramme der Parteien zu informieren, und konsequent diejenigen zu wählen, die sich für unsere Werte einsetzen“, betont auch Verena Haisch, Vizepräsidentin des djb.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 11.02.2025
Familienbund der Katholiken: 10 zentrale Forderungen zur Bundestagswahl

„Der Familienbund der Katholiken legt zur Bundestagswahl 2025 zehn zentrale familienpolitische Forderungen vor. Er fordert eine nachhaltige Familienpolitik, die Familien stärkt, Wahlfreiheit sichert und soziale Gerechtigkeit fördert. Zentral dafür sind ausreichend Zeit für Erziehung und Pflege, finanzielle Unterstützung, verlässliche Kinderbetreuung sowie gerechte Beiträge in den Sozialversicherungen. Nachhaltige Familienpolitik stärkt die Generationensolidarität und verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein Blick auf die zehn zentralen Forderungen des Familienbunds zeigt, wie eine gerechte und zukunftsorientierte Familienpolitik aussehen kann. Der Familienbund ruft alle Wahlberechtigten dazu auf, bewusst wählen zu gehen – für eine Politik, die Familien in den Mittelpunkt stellt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der freiheitlichen Demokratie stärkt!“ Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes der Katholiken
Weitere familienpolitische Positionen des Familienbundes finden Sie – thematisch geordnet und den aktuellen Plänen der Parteien gegenübergestellt – auf unserer Website zur Bundestagswahl: https://familienbund.org/bundestagswahl-2025
Quelle: Pressemitteilung Familienbund der Katholiken – Bundesverband vom 14.02.2025
FidH: Stellungnahme mit Eckpunkten zur Bundestagswahl 2025
Das Netzwerk Familie in der Hochschule e.V. (FidH) mit mehr als 150 Mitgliedsinstitutionen verfolgt das Ziel, die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Wissenschaft mit Familienaufgaben im deutschsprachigen Hochschulraum fest zu verankern und weiter zu entwickeln.
Zur Bundestagswahl 2025 haben wir eine Stellungnahme mit Eckpunkten verfasst.
Wir richten uns damit an alle, die sich in der Familien- und Gleichstellungspolitik engagieren und dafür einsetzen, dass Eltern und pflegende Angehörige gleichermaßen Ausbildung und Karriere verfolgen können, als Fachkräfte auch zukünftig zur Verfügung stehen und zugleich die unerlässliche gesellschaftliche Aufgabe der Care-Arbeit leisten können.
Quelle: Pressemitteilung Familie in der Hochschule e.V. vom 13.02.2025
VdK: Bentele appelliert: „Im Wahlkampf-Endspurt müssen endlich soziale Themen auf den Tisch“
- Civey-Umfrage: 72 Prozent sind der Meinung, dass soziale Themen zu wenig behandelt werden
- VdK fordert Diskussionen um die besten politischen Konzepte, die den Sozialstaat leistungsfähig und zukunftssicher machen
Der Sozialverband VdK kritisiert, dass soziale Themen in diesem Wahlkampf nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das sieht auch eine sehr große Mehrheit der Menschen in Deutschland so, wie eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt, die der VdK in Auftrag gegeben hat. Präsidentin Verena Bentele sagt:
„Es wird in diesem Wahlkampf viel zu wenig über die Themen gesprochen, die die Menschen wirklich bewegen. Ich vermisse Diskussionen um die besten politischen Konzepte, die den Sozialstaat leistungsfähig und zukunftssicher machen. Es geht viel zu selten um ausreichend hohe Renten, ein funktionierendes und bezahlbares Gesundheits- und Pflegesystem. Ich höre von den Wahlkämpfern kaum etwas darüber, wie Armut bekämpft und eine Teilhabe aller Menschen an unserer Gesellschaft erreicht werden kann.
Dabei brauchen wir dringend gute Lösungen für eine gerechte Finanzierung unserer Sozialversicherungen, um den Sozialstaat auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Und es gibt auch vom VdK konkrete Vorschläge, wie die Sozialversicherungen zum Beispiel von der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben entlastet werden können. Doch die Wahlkämpfer konzentrieren sich bislang leider eher auf andere Themen.
Im Wahlkampf-Endspurt müssen die Parteien endlich Farbe bekennen und den Wählerinnen und Wählern klipp und klar sagen, was sie mit der Rente oder der Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung vorhaben. Für uns ist klar: Ein guter Sozialstaat hilft allen Menschen, schützt unsere Demokratie und ist finanzierbar.“
Auch die Menschen in Deutschland vermissen soziale Themen im Wahlkampf. Eine vom Sozialverband VdK in Auftrag gegebene repräsentative Civey-Umfrage zeigt: 70 Prozent der Befragten finden, dass soziale Themen in diesem Wahlkampf zu wenig behandelt werden. Sogar mehr als die Hälfte ist der Auffassung, dass sie eindeutig zu wenig stattfinden. Nicht mal 15 Prozent geben an, dass soziale Themen genau richtig häufig behandelt werden. Nur zehn Prozent sagen, dass soziale Themen zu viel diskutiert werden.
Bentele: „Die Zustimmung zu unserer Beobachtung, dass soziale Themen zu wenig behandelt werden, zieht sich durch alle Bundesländer, Parteipräferenzen, Berufs- und Altersgruppen. Im Osten Deutschlands geben sogar fast 80 Prozent der Menschen an, dass soziale Themen nicht ausreichend behandelt werden.“
Die Umfrage belegt: Insbesondere die ganz normalen Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Menschen in herausfordernden Lebenslagen, also zum Beispiel Geschiedene oder aktuell nicht erwerbstätige Menschen, vermissen soziale Themen im Wahlkampf.
Bentele appelliert an die politischen Parteien: „In der letzten Woche dieses Wahlkampfes müssen endlich soziale Themen auf den Tisch. Wir hoffen bei der nächsten Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten auf mehr Fragen zur Sozialpolitik. Das fast vollständige Fehlen der Sozialpolitik im Duell Merz gegen Scholz war ein Negativbeispiel.“
|
Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 16.02.2025
VPK-Forderungen und Ergebnisse einer Umfrage unter jungen Menschen in Jugendhilfeeinrichtungen
Am 23. Februar 2025 findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. In welcher Konstellation auch immer die neuen Regierungsparteien zusammenarbeiten werden – die anstehenden Themen sind vielfältig und die Dringlichkeit hinsichtlich der Präsentation überzeugender und kurzfristiger Lösungskonzepte hoch. Auch die Kinder- und Jugendhilfe steht vor großen Herausforderungen, welche nur unter gemeinsamer Anstrengung und durch das Zusammenwirken aller am Hilfeprozess Beteiligten erfolgreich bewältigt werden können. Die mit der Reform des SGB VIII einhergehenden Veränderungen sind zum großen Teil begrüßenswert. Aber um auch in Zukunft erfolgreich im Sinne junger Menschen wirken zu können, müssen die zukünftigen Regierungsparteien mit innovativen Ansätzen und einer angemessenen Finanzierung die Weichen für eine echte Verbesserung der Lebenssituation von jungen Menschen stellen. Die Bedarfe der in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen lebenden jungen Menschen müssen fokussiert und ihre Anliegen in den Mittelpunkt gestellt werden. Gerade die geplante Umsetzung der Inklusion in all ihren Facetten, aber auch die Bekämpfung des vielerorts bestehenden Fachkräftemangels sowie der Umgang mit der stetigen Zunahme komplexer Fallverläufe stellen die Kinder- und Jugendhilfe vor Herausforderungen, denen nur durch das konstruktive und ergebnisorientierte Handeln von Bund, Ländern, Kommunen und freien Trägern unter Partizipation der jungen Menschen begegnet werden kann.
Als Verband, der die Interessen und Bedarfe junger Menschen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vertritt, hat der VPK-Bundesverband im Vorfeld der anstehenden Bundestagswahlen eine Umfrage gestartet. Wir wollten herausfinden, welche Themen junge Menschen besonders beschäftigen und mit dieser Initiative zudem auch die Demokratiebildung unterstützen: Welche Ängste und Wünsche haben junge Menschen? Was erwarten sie von der kommenden Regierung? Wie stellen sie sich ihre Zukunft vor? Die Ergebnisse der nicht repräsentativen Umfrage haben klare Tendenzen gezeigt: Junge Menschen wünschen sich ein bezahlbares Leben, soziale Gerechtigkeit und eine sichere Zukunft. In einer Zeit voller Krisen – von Inflation und innerpolitischen Spannungen über den Klimawandel bis hin zu Kriegen – zeigt sich, dass junge Menschen sehr genau wahrnehmen, was um sie herum geschieht.
Sie finden Sie die Forderungen des VPK sowie die Ergebnisse unserer Umfrage unter jungen Menschen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unter https://www.vpk.de/de/
Quelle: Pressemitteilung
VPK – Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e. V. vom 17.02.2025
SCHWERPUNKT II: Gewalthilfegesetz
BVT*: Das Gewalthilfegesetz kommt – aber schützt explizit nur Frauen
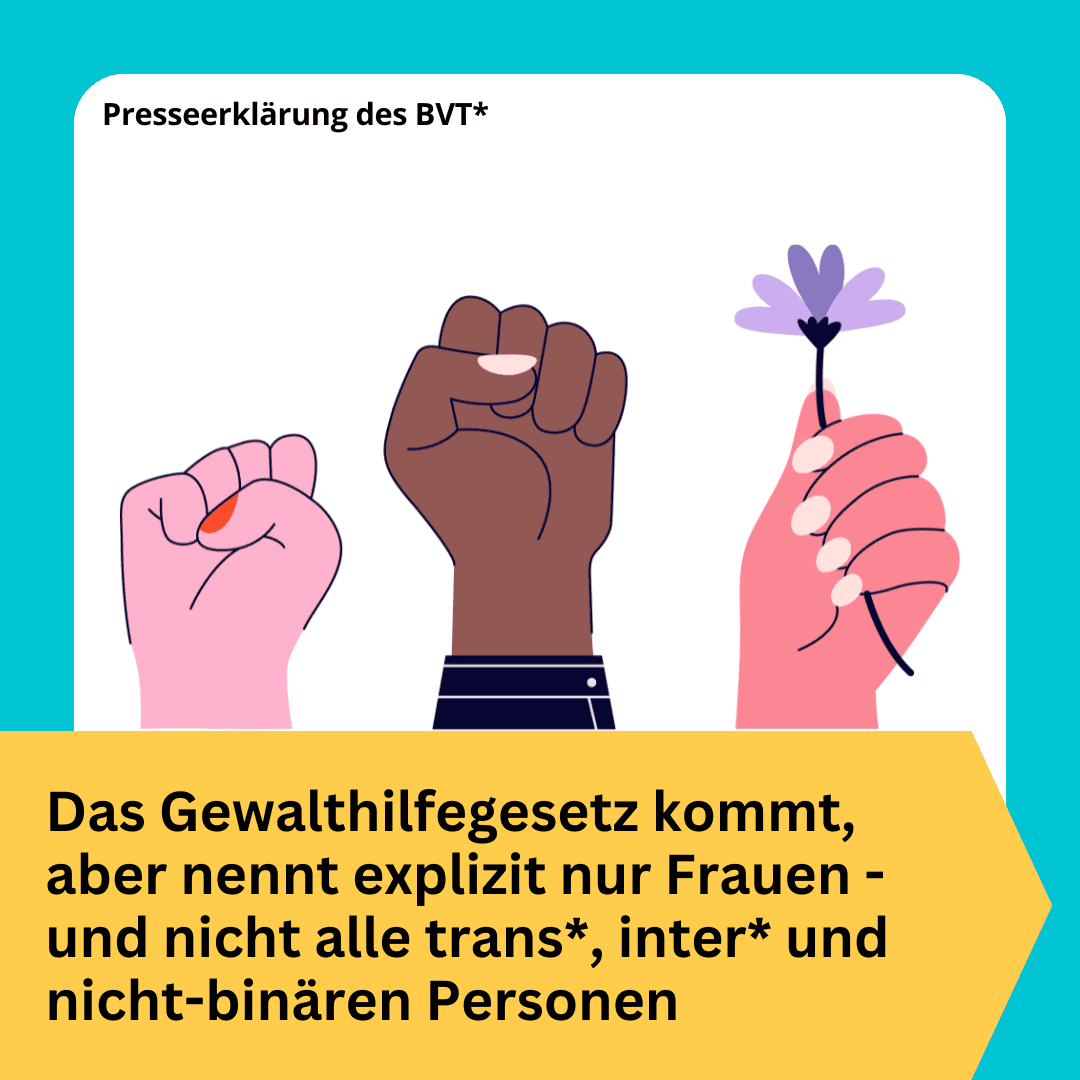 Das Gewalthilfegesetz kommt – aber schützt explizit nur Frauen. Die Politik platziert Hilfseinrichtungen damit in einem Widerspruch zwischen Theorie und Praxis und stellt trans*, inter* und nicht-binäre Personen als nicht schutzwürdig dar. Trans*feminine Personen und trans* Frauen wurden in den Diskussionen um das Gesetz wieder einmal als Gefährdung dargestellt.
Das Gewalthilfegesetz kommt – aber schützt explizit nur Frauen. Die Politik platziert Hilfseinrichtungen damit in einem Widerspruch zwischen Theorie und Praxis und stellt trans*, inter* und nicht-binäre Personen als nicht schutzwürdig dar. Trans*feminine Personen und trans* Frauen wurden in den Diskussionen um das Gesetz wieder einmal als Gefährdung dargestellt.
Wie von vielen Verbänden und der Zivilgesellschaft gefordert, hat die Politik den Weg für das Gewalthilfegesetz frei gemacht: SPD, Union und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einigten sich früher diese Woche im Familienausschuss. Läuft alles nach Plan, wird das Gesetz am heutigen Freitag im Bundestag und im Februar im Bundesrat diskutiert.
Tritt das Gesetz in Kraft, werden Frauenhäuser und Beratungsstellen in Zukunft besser finanziert: Die Länder und Kommunen müssen die Einrichtungen nicht mehr alleine tragen, sondern der Bund stellt bis 2036 rund 2,6 Milliarden Euro zusätzlich bereit.
Das Gesetz führt einen Rechtsanspruch auf Beratung und Schutz bei Gewalt ein. Das Gesetz nennt aber explizit nur Frauen und ihre Kinder als Personen, die Zugang haben sollen. Ob trans* Frauen hier mitgemeint sind oder nicht, lässt das Gesetz an dieser Stelle offen. Das Gesetz hatte in früheren Versionen explizit alle trans*, inter* und nicht-binären Personen in seinen Schutzbereich aufgenommen, u.a. auch weil Artikel 4 der Instanbul-Konvention diese Personengruppe als schutzwürdig definiert.
Ursache des nun erfolgten Ausschlusses ist die Position der CDU. Die Union wollte sogar noch einen Schritt weiter gehen und in den Gesetzestext aufnehmen lassen, dass das Gesetz Frauen und Kinder schütze, trans* Frauen hier aber explizit nicht mit gemeint seien.
Mari Günther vom Bundesverband Trans* sagt dazu: „Mit dieser Strategie hat die CDU nicht nur den Schutz von trans*, inter* und nicht-binären Personen verhindert, sondern auch die Rechte aller Frauen in diesem Land angegriffen. Sie hat die gewaltbetroffenen cis Frauen in diesem Land als Geisel gehalten – denn wenn SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am Schutz für alle trans*, inter* und nicht-binäre Personen festgehalten hätten, wäre das Gesetz aufgrund der fehlenden Unterstützung der CDU geplatzt. All die Frauen, die zum jetzigen Zeitpunkt keine Hilfe finden, die getötet werden, hätten in diesem Fall weiter keine Hilfe gefunden – und die CDU hätte das billigend in Kauf genommen. Die Rechte von Frauen und die Rechte von trans*, inter* und nicht-binären Personen werden hier gegeneinander ausgespielt. Die Trans*bewegung ist eine zutiefst feministische Bewegung. Daher sehen wir nicht nur den Ausschluss von trans*, inter* und nicht-binären Personen als Skandal, sondern auch wie er erreicht wurde.“
Die Strategie der Union basiert auf trans*feindlichen und vor allem trans*misogynen Narrativen. Es werden Falschinformationen über trans*feminine Personen und trans* Frauen verbreitet. Sie werden als potenzielle Gefährdung dargestellt. Diese Panikmache ist realitätsfern, die vermeintliche ‚Gefahr‘ erfunden und von keinerlei Daten untermauert – während gleichzeitig belastbare Zahlen vorliegen, die einen Anstieg der Gewalt gegen eben die Gruppe von Menschen demonstrieren, die selbst unbegründet als Gefahr konstruiert wird.
In der Praxis entscheiden Frauenhäuser nach hausinternen Richtlinien selbst, ob sie eine schutzsuchende Person aufnehmen. Die Beratung und Unterbringung von trans*, inter* und nicht-binären Personen ist in vielen Einrichtungen – teilweise seit Jahrzehnten – eine Selbstverständlichkeit.
Die fehlende klare Inklusion von trans* Frauen und allen trans*, inter* und nicht-binären Personen im Gesetzestext bringt trans* Frauen in eine prekäre Lage: Frauenhäuser, die ausschließlich cis Frauen aufnehmen, werden dies weiterhin tun. Frauenhäuser, die offen für trans*, inter* und nicht-binäre Personen sind, werden es bleiben – da trans*misogyne und trans*feindliche Narrative aber immer mehr Verbreitung finden, muss die Zukunft zeigen, wie lange das noch so sein wird. Durch die Formulierung des Gesetzes wird die Diskussion darüber, wer geschützt wird und wer nicht, in die Einrichtungen verlagert.
Mari Günther dazu weiter: „In der Praxis wird die Exklusionsforderung der CDU erst mal nicht viel ändern. Der Versuch, Fachkräfte, die gewaltbetroffenen Personen helfen, zwischen das Gesetz und ihre etablierte Praxis zu stellen, zwischen das Gesetz und ihren Auftrag, Menschen zu schützen, ist untragbar. Dies geschieht in der Hoffnung, dass sie dazwischen zerrieben werden und künftig nicht nur trans* Männer, inter* Personen und nicht-binäre Personen ausschließen, sondern auch trans* Frauen. Das ist ein Angriff auf das bestehende Hilfesystem. Auch wenn der BVT* die bessere Finanzierung und die zusätzlichen Ressourcen begrüßt, die durch das Gesetz ermöglicht werden, kritisieren wir den Ausschluss scharf. Gleich mehrere Gruppen, die oft von Gewalt betroffen sind, explizit auszuschließen und damit laut und deutlich zu sagen, dass diese Gruppen nicht schutzwürdig sind, zeigt uns, wie wenig Solidarität und wie viel soziale Kälte in diesem Land herrschen.“
In Anbetracht des gesellschaftlichen Rechtsrucks wäre Gewaltschutz für trans*, inter* und nicht-binäre Personen dringender denn je. Die im November 2023 erschienene Studie Antifeminismus als autoritäre Krisenreaktion? zeigt: Je autoritärer eine Gesellschaft wird, desto stärker können sich Personen dazu legitimiert sehen, menschenfeindliche Einstellungen durch Gewalt auszuagieren. Dies geschieht bewusst und unbewusst. Besonders trans*, inter* und nicht-binäre Personen sind von diesen Gewaltformen betroffen.
Durch den gesellschaftlichen Rechtsruck ist bereits jetzt ein deutlicher Anstieg trans*feindlicher Gewalt in Deutschland zu beobachten: Das Bundesinnenministerium verzeichnet für 2023 besorgniserregende Fallzahlen für Hasskriminalität mit Bezug zu den Merkmalen „sexuelle Orientierung“ (1499 Straftaten) und „geschlechtsbezogene Diversität“ (854 Straftaten). Das ist ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr (insgesamt 1422 Straftaten in beiden Kategorien).
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen ist damit zu rechnen, dass Gewalt gegen trans* und nicht-binäre Personen weiter zunehmen wird. Das Gewalthilfegesetz lässt trans*, inter* und nicht-binäre Personen hier bewusst schutzlos zurück.
Hintergrund:
Gewalt gegen trans* und nicht-binäre Personen ist und war lange gesellschaftlich normalisiert. Dies findet auch Ausdruck darin, dass es nicht sehr viele Erhebungen gibt, die belastbare Zahlen über Gewalt an trans* und nicht-binären Personen liefern. Erhebungen zu häuslicher Gewalt gegen trans*, inter* und nicht-binäre Personen sind uns nicht bekannt. Wenn sich Erhebungen mit dem Thema Gewalt beschäftigen, wird meist allgemein nach körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt gefragt und selten der Kontext erhoben. Die Zahlen der existierenden Erhebungen sind jedoch eher hoch:
– In der EU-weiten Vergleichsstudie der Grundrechteagentur der Europäischen Union FRA (2014), geben 34 % aller befragten trans* Personen an, in den vergangenen fünf Jahren körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt zu haben: : Trans* Frauen sind mit 38 % am häufigsten Gewalt ausgesetzt. 32 % der trans* Männer und 27 % der nicht-binärenPersonen sind gewaltbetroffen..
– In der von LesMigras durchgeführten Studie mit dem Titel „..nicht so greifbar und doch real“ aus dem Jahr 2012 stimmten 74,5 % der 216 befragten trans* Personen der Aussage zu, dass ihnen unverschämte, sexualisierte Fragen zu ihrem Körper gestellt wurden. 30,9 % gaben an, sexualisierte Übergriffe erlebt zu haben.
– An der U.S. Transgender Survey aus dem Jahr 2016 nahmen 27.715 trans* und nicht-binäre Personen teil. Unter ihnen beantworteten 47 % die Frage, ob sie sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen sind, mit Ja.
– Im Rahmen der Australian Trans and Gender Diverse Sexual Health Survey aus dem Jahr 2018 stimmten 53,2 % der teilnehmenden1613 trans und nicht-binären Personen der Frage „Wurden Sie jemals gezwungen oder eingeschüchtert, etwas Sexuelles zu tun, was Sie nicht tun wollten?“ zu.
– In der Partner 5-Studie aus dem Jahr 2021, die im deutschsprachigen Raum erhoben wurde, ordneten sich 42 Personen (5 %) der 861 Befragten der Kategorie „divers“ zu. Von diesen Personen stimmten 21 % der Aussage zu, eine Vergewaltigung überlebt zu haben.
Dieses Statement kann als PDF heruntergeladen werden. Hier klicken.
Weiterführende Links:
Zahlen aus Australien:
Callander, D., Wiggins, J., Rosenberg & S., Cornelisse et al. (2019). The 2018 Australian Trans and Gender Diverse Sexual Health Survey: Report of Findings (S. 10). UNSW Sydney.
Zahlen aus den USA:
James, S. E., Herman, J. L. & Rankin, S. et al. (2016). The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey (S. 205). National Center for Transgender Equality.
Quelle: Pressemitteilung Familie in der Hochschule e.V. vom 13.02.2025
eaf: Gute Nachrichten: Gewalthilfegesetz kommt noch in der aktuellen Legislaturperiode
eaf begrüßt Schutzanspruch für Frauen und Kinder
Der von der evangelischen arbeitsgemeinschaft familie (eaf) schon seit Längerem geforderte Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei häuslicher Gewalt wird durch das am Freitag im Bundesrat verabschiedete Gewalthilfegesetz Wirklichkeit, allerdings erst ab 2032.
„Endlich bekommen gewaltbetroffene Frauen besseren Schutz und mehr Hilfe! Gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl hat das Gewalthilfegesetz nun auch im Bundesrat grünes Licht bekommen“, zeigt sich eaf-Präsident Prof. Dr. Martin Bujard erleichtert. „Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der Istanbul-Konvention.“ Der Ausbau der viel zu wenigen Schutzplätze in Frauenhäusern ist zwingend notwendig. Eine zentrale Neuerung des Gesetzes ist zudem, dass betroffene Frauen künftig nicht mehr für ihre Unterbringung und Beratung zahlen müssen. „Dass Schutz vor Gewalt bisher oft auch eine finanzielle Frage war, ist kaum zu fassen – umso wichtiger, dass sich das nun ändert“, so Bujard.
Gewalt in der Familie verursacht großes Leid, wirkt sich negativ auf die Entwicklung von Kindern aus und verhindert die Gleichstellung von Frauen. Die eaf setzt sich für eine politische Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Partnerschaftsgewalt und häuslicher Gewalt ein. Dazu sind weitere Gesetzesvorhaben notwendig.
„Wir brauchen zeitnah die gesetzliche Verankerung von Gewaltschutz im Umgangs- und Sorgerecht“, betont Bujard. „Umgangsrechte müssen hinter dem Gewaltschutz zurücktreten, solange keine Gefährdungsanalyse vorliegt. Das muss sich auch im Familienverfahrensrecht widerspiegeln. Bei Anhaltspunkten für Partnerschaftsgewalt müssen andere Verfahrensregeln gelten. Das sind dringliche Aufgaben für eine neue Bundesregierung.“
Quelle: Pressemitteilung evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) vom 17.02.2025
VAMV: Gewalthilfegesetz verabschiedet – ein Meilenstein für den Gewaltschutz!
Der Bundesrat hat am letzten Freitag mit seiner Zustimmung den Weg für ein Gewalthilfegesetz frei gemacht. Hierzu erklärt Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV):
„Die Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes ist ein Meilenstein für den Gewaltschutz und für die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Der VAMV hat sich zusammen mit anderen Organisationen für das Zustandekommen des Gesetzes eingesetzt – wir sind sehr froh, dass es nun tatsächlich beschlossen ist! Aktuell fehlen über 14.000 Frauenhausplätze. Das bedeutet: tagtäglich müssen Schutzunterkünfte gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder abweisen – Frauen werden unter Umständen in lebensbedrohliche Situationen zurückgeschickt.“
„Es ist ein ermutigendes Zeichen für den Gewaltschutz, dass das Gesetz durch den Konsens demokratischer Parteien in Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden konnte“, erklärt Jaspers. „Das Gewalthilfegesetz schafft nun endlich einen Anspruch auf Schutz und Beratung. Ein Wermutstropfen ist, dass der Anspruch erst ab 2032 besteht. Es ist die Grundlage für den Ausbau eines flächendecken-den und bedarfsgerechten Hilfesystems für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Nun kommt es darauf an, diesen Ausbau zügig um-zusetzen.“
Jaspers ergänzt: „Allerdings braucht es für einen effektiven Schutz vor Gewalt und für die vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention dringend weitere Schritte: An der Schnittstelle zwischen Gewaltschutz und Umgangs- und Sorgerecht bestehen weiterhin erhebliche Schutzlücken. Umgangsrechte werden oft auf Kosten des Gewaltschutzes umgesetzt. Auch das familiengerichtliche Verfahren schützt gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder nicht in ausreichendem Maß. Hier braucht es eine Neujustierung: der Schutz gewaltbetroffener Elternteile und ihrer Kinder muss an erster Stelle stehen, um die Istanbul-Konvention umzusetzen. Eine neue Bundesregierung muss daher unverzüglich eine Reform des Umgangs- und Sorgerechts sowie eine Reform des familiengerichtlichen Verfahrens in Angriff nehmen, um diese Lücken zu schließen.“
VAMV_PM_Gewalthilfegesetz_18022025.pdf
Quelle: Pressemitteilung VAMV Bundesverband e.V. vom 18.02.2025
NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT
Bundesrat gibt Weg frei für Mutterschutz bei Fehlgeburten
Eine Änderung des Mutterschutzgesetzes hat am 14. Februar 2025 den Bundesrat passiert. Mutterschutzfristen gelten nun auch bei Fehlgeburten.
Fehlgeburten ab der 13. Woche
Nach der Entbindung gilt für Mütter eine achtwöchige Schutzfrist, in der sie nicht arbeiten dürfen. Frauen, die ihr Kind vor der 24. Schwangerschaftswoche durch eine Fehlgeburt verloren haben, stand dieser Mutterschutz nach bisheriger Rechtslage nicht zu.
Die Neuregelung sieht bei Fehlgeburten einen Mutterschutz ab der 13. Schwangerschaftswoche vor. Dieser ist hinsichtlich der Dauer der Schutzfrist gestaffelt. Ab der 13. Schwangerschaftswoche beträgt sie bis zu zwei Wochen, ab der 17. bis zu sechs Wochen und ab der 20. bis zu acht Wochen. Das Beschäftigungsverbot gilt jedoch nur, wenn sich die Betroffene nicht ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit erklärt.
Bundesrat hatte Ausweitung des Mutterschutzes gefordert
Der Bundesrat hatte am 5. Juli 2024 in einer Entschließung an die Bundesregierung das Eingreifen des Mutterschutzes deutlich vor der 20. Woche gefordert. Dadurch könne verhindert werden, dass sich Frauen nach einer Fehlgeburt unnötigen Belastungen am Arbeitsplatz aussetzten. Bei Mutterschutz, der zeitlich über eine Krankschreibung hinausginge, entfiele so das Abrutschen in den Krankengeldbezug, hatten die Länder argumentiert.
Wie es weitergeht
Da im Bundesrat kein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses gestellt wurde und die Länder das Gesetz somit gebilligt haben, kann es nun ausgefertigt und verkündet werden. Es tritt am 1. Juni 2025 in Kraft.
Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates am 14.02.2025
DIW: Einkommen in Deutschland: Niedriglohnsektor schrumpft, Armutsrisikoquote sinkt
Löhne sind mit Inflation 2022 insgesamt real gefallen, nicht aber in der untersten Lohngruppe – Niedriglohnsektor schrumpft weiterhin, insbesondere in Ostdeutschland – Haushaltseinkommen steigen in der langen Frist deutlich, stagnieren aber in untersten Einkommensgruppen – Armutsrisikoquote sinkt dennoch, insbesondere in Ostdeutschland, bei Kindern und Jugendlichen sowie Alleinerziehenden
Mit der rasant steigenden Inflation sind die Bruttostundenlöhne im Jahr 2022 im Schnitt zwar gefallen, das unterste Lohndezil holte aber aufgrund der starken Anhebung des Mindestlohns im Jahr 2022 gegenüber allen anderen Dezilen auf. Der Niedriglohnsektor schrumpfte dadurch, insbesondere in den ostdeutschen Ländern. Auch deutet sich eine Trendumkehr bei der seit Jahren steigenden Armutsrisikoquote an. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Einkommenserhebung des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), für die jährlich rund 30.000 Personen in Deutschland befragt werden.
„Insbesondere in Ostdeutschland sehen wir eine erfreuliche Entwicklung. Sowohl der Niedriglohnsektor als auch die Armutsrisikoquote, die sich nach den Haushaltsnettoeinkommen bemisst, sinken dort deutlich, liegen aber weiterhin über den Werten in Westdeutschland“, resümiert SOEP-Studienautor Markus M. Grabka. Deutschlandweit schrumpfte der Niedriglohnsektor seit seinem Höchststand 2007 von 23,4 Prozent auf nunmehr 18,5 Prozent der abhängig Beschäftigten, in Ostdeutschland sank er sogar um 14 Prozentpunkte – von 38 auf zuletzt 24 Prozent.
Armutsrisikoquote bei Jugendlichen und Alleinerziehenden sinkt beträchtlich
Von den steigenden Haushaltsnettoeinkommen, die seit 1995 inflationsbereinigt um im Schnitt 35 Prozent zunahmen, konnten die einkommensschwächsten Haushalte allerdings wenig profitieren. Ihre Einkommen stagnierten, während die Einkommen der reichsten Haushalte um 58 Prozent stiegen. Die hohe Inflation nach dem russischen Angriff auf die Ukraine schlägt sich hier allerdings noch nicht nieder, da bei den Jahreseinkommen bisher nur das Jahr 2021 erfasst wurde.
Schaut man aber auf die Monatsnettoeinkommen der Haushalte, die 2022 abgefragt wurden, deutet sich ein Trendbruch bei den Niedrigeinkommen an. Nach einer langen Phase des Anstiegs sinkt erstmals die Armutsrisikoquote derjenigen, die über weniger als 60 Prozent des Medians des Haushaltsnettoeinkommens verfügen. Insbesondere in Ostdeutschland und unter ostdeutschen Kindern und Jugendlichen zeigt sich ein starker Rückgang bei der Armutsgefährdung. Auch die Quote der Alleinerziehendenhaushalte, die von Armut bedroht sind, ist von einem Höchststand bei 37 Prozent im Jahr 2018 auf 31 Prozent im Jahr 2022 gefallen, in den ostdeutschen Ländern im gleichen Zeitraum sogar von 43 auf 32 Prozent. „Die in den letzten Jahren eingeleiteten Maßnahmen für Alleinerziehende wie Änderungen rund um den Unterhaltsvorschuss oder der erhöhte steuerliche Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende haben sichtbar gewirkt“, konstatiert Studienautor Grabka und führt aus: „Die sinkenden Werte bei der Armutsrisikoquote sind ein erfreulicher Befund, der sich aber verstetigen muss, um von einer Trendumkehr zu sprechen.“
Wolle man das weiterhin hohe Armutsrisiko reduzieren, sollten Kinder und Jugendliche in den Blick genommen werden, da der Anteil der frühen Schulabgänger*innen zuletzt gewachsen ist. „Ohne qualifizierten Bildungsabschluss sind Armutskarrieren sehr wahrscheinlich. Gezielte Bildungsausgaben, die zum Beispiel über höhere Steuern auf Vermögen finanziert werden könnten, sind auch aus diesem Grund dringend erforderlich“, empfiehlt Grabka.
LINKS
- Studie im DIW Wochenbericht 8/2025
- Studie in englischer Sprache im DIW Weekly Report 7+8/2025
- Infografik in hoher Auflösung (JPG, 3.31 MB)
- Interaktive Grafik zur Einkommensverteilung
- Interview mit Studienautor Markus M. Grabka
- Audio-Interview mit Markus M. Grabka (MP3, 13.79 MB)
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) vom 19.02.2025
DIW: Steuerreformvorschläge der Parteien: Ambitionierte Entlastungen für arbeitende Mitte und Unternehmen treiben Defizite
Union, FDP und AfD versprechen umfangreiche Steuerentlastungen, die das Staatsdefizit um bis zu vier Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hochtreiben und vor allem Besser- und Hochverdienende entlasten. SPD und Grüne wollen Steuerentlastungen auf die unteren und mittleren Einkommen konzentrieren und die Steuern bei Hochverdienenden und Vermögenden erhöhen. Wachstumseffekte reduzieren die Mindereinnahmen nur zum geringeren Teil. Daher sollten Steuerentlastungen vor allem auf Erwerbseinkommen und Unternehmen konzentriert werden. Steuererhöhungen für hohe Einkommen und Vermögen sollten nicht tabu sein, aber nicht übertrieben werden. Der steuerpolitische Elefant im Raum ist die Mehrwertsteuer.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) vom 10.02.2025
Hans-Böckler-Stiftung: Mindestlohn: Deutliche Zuwächse für Beschäftigte in den meisten EU-Ländern – Deutschland fällt mit Mini-Anhebung zurück
Fast überall in der Europäischen Union sind die Mindestlöhne zum Jahresanfang gestiegen. Für Mindestlohnbeziehende kamen dabei zwei günstige Entwicklungen zusammen: Zum einen fielen die Erhöhungen meist kräftig aus. Im Mittel (Median) betrug die nominale Steigerung gegenüber dem Vorjahr 6,2 Prozent. Zum anderen ist die Inflation gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im Verlauf des Jahres 2024 europaweit zurückgegangen. Anders als in den vergangenen Jahren bleibt damit auch nach Berücksichtigung der gestiegenen Lebenshaltungskosten mit 3,8 Prozent im Median ein deutliches reales Plus. Wermutstropfen bei der Entwicklung ist, dass die Zuwächse geographisch sehr ungleich verteilt sind. So stammen die neun Länder mit den größten realen Zuwächsen – jeweils oberhalb von 5 Prozent – allesamt aus Osteuropa. Im Rest der EU verzeichnen Irland (+4,9 %), Portugal (+3,3 %), Griechenland (+3,3 %) und die Niederlande (+2,7 %) vergleichsweise hohe reale Steigerungen. In Deutschland übertraf die Anpassung des Mindestlohns auf 12,82 Euro zum Jahresanfang die HVPI-Inflationsrate des Vorjahres nur geringfügig, sodass für Menschen, die hierzulande zum Mindestlohn arbeiten, lediglich ein reales Wachstum von 0,8 Prozent übrigbleibt. Das ergibt der neue internationale Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.*
Als einen Grund für die Erhöhungen macht der Bericht den Einfluss der Europäischen Mindestlohnrichtlinie aus. „Durch Referenzwerte für angemessene Mindestlöhne, die im Zuge der Umsetzung der Europäischen Mindestlohnrichtlinie in den nationalen Mindestlohngesetzen verankert wurden, entsteht in viele Ländern ein Sog hin zu strukturellen Mindestlohnerhöhungen, die über die normalen regelmäßigen Anpassungen hinausreichen“, bilanzieren die Studienautoren Dr. Malte Lübker und Prof. Dr. Thorsten Schulten. Um die Angemessenheit von Mindestlöhnen zu beurteilen, ist in der Richtlinie unter anderem der Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns verankert – also des Lohnes, der die Lohnverteilung in zwei gleichgroße Hälften teilt. Nach den aktuellsten verfügbaren Daten der OECD, die sich auf das Jahr 2023 beziehen, erreichten zuletzt nur Portugal (68,2 %), Slowenien (63,0 %) und Frankreich (62,2 %) diese Zielvorgabe. Deutschland verfehlte das Ziel mit 51,7 Prozent des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten deutlich. Bereits im laufenden Jahr wäre ein Mindestlohn von rund 15 Euro notwendig, um das 60-Prozent-Ziel zu erreichen, so die WSI-Forscher.
Viele Länder haben eine langfristige Zielgröße für den Mindestlohn gesetzlich verankert oder auf andere Weise festgelegt (siehe Übersicht 1 im Bericht). Die Bilanz der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass dies dem Mindestlohn einen deutlichen Schub gibt: In Westeuropa verzeichnen Spanien (+48,9 %), Portugal (+40,3 %) und Irland (+30,7 %) gegenüber dem Jahr 2015 ein deutliches Realwachstum, in Großbritannien stieg der Mindestlohn preisbereinigt in den letzten zehn Jahren sogar um 76,0 Prozent (siehe Tabelle 1 in der pdf-Version dieser PM; Link unten). Das Ex-EU-Mitglied Großbritannien verfolgt inzwischen das ambitionierte Ziel, ein Living Wage in Höhe 66 Prozent des Medianlohns zu erreichen. Auch Irland will sein derzeitiges Ziel von 60 Prozent des Medians überprüfen, um perspektivisch ein Living Wage von 66 Prozent des Medians einzuführen.
Verhaltene Zehn-Jahres-Bilanz für Deutschland
Demgegenüber fällt die Zehn-Jahres-Blanz in Deutschland deutlich bescheidener aus: Hierzulande stieg der Mindestlohn real um 16 Prozent gegenüber dem Einführungsniveau aus dem Jahr 2015. Dies entspricht in etwa der Erhöhung des Mindestlohns durch den Deutschen Bundestag von 10,45 Euro auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022. „Per Saldo haben die Anpassungen unter der Ägide der Mindestlohnkommission über die vergangenen zehn Jahre zu keiner nennenswerten realen Erhöhung geführt, sondern lediglich inflationsbedingte Kaufkraftverluste ausgeglichen – ähnlich wie dies in Frankreich und Belgien durch eine Indizierung des Mindestlohns erreicht wird“, so das Fazit der Studienautoren Lübker und Schulten. „Wenn der Mindestlohn auch in diesem Jahr wieder Thema im Wahlkampf ist, hat sich die Mindestlohnkommission das ein Stück weit selbst zuzuschreiben“, ergänzt Lübker. „Insbesondere die letzte Anpassungsentscheidung, die gegen die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter*innen gefällt wurde, hat den Ruf der Kommission in den Augen Vieler beschädigt.“
Inzwischen deute sich jedoch Grund zur Hoffnung auf eine Kurskorrektur der Kommission an: In ihrer neuen Geschäftsordnung hat sich diese darauf festgelegt, sich künftig unter anderem am Wert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns der Vollzeitbeschäftigten zu orientieren und wieder im Konsens zu entscheiden. Die nächste Entscheidung steht zum 30. Juni dieses Jahres an. „Um den Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns dauerhaft als Zielgröße zu etablieren, wäre auch in Deutschland eine Aufnahme in das Mindestlohngesetz sinnvoll“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des WSI.
Deutschland fällt in der Europäischen Union auf den 5. Platz zurück
Mit dem aktuellen Mindestlohnniveau lag Deutschland unter den 22 EU-Ländern mit gesetzlichem Mindestlohn zum Stichtag 1. Januar 2025 hinter Luxemburg (15,25 €), den Niederlanden (14,06 €) und Irland (13,50 €) auf dem 4. Platz. Da Belgien seinen Mindestlohn am 1. Februar von 12,57 Euro auf 12,83 Euro erhöht hat, ist diese Rangfolge allerdings inzwischen obsolet und Deutschland (12,82 €) ist mittlerweile auf den 5. Platz vor Frankreich (11,88 €) abgerutscht. Auch in Großbritannien liegt der Mindestlohn mit umgerechnet 13,51 € oberhalb des deutschen Niveaus und steigt dort zum 1. April 2025 auf umgerechnet 14,42 €.
In Süd- und Osteuropa gelten niedrigere Mindestlöhne, wie beispielsweise in Spanien (8,37 €), Slowenien (7,39 €) und Polen (7,08 €). Am Ende der Tabelle finden sich Lettland (4,38 €), Ungarn (4,23 €) sowie Bulgarien (3,32 €; siehe Abbildung 1 in der pdf-Version). Durch das kräftige Mindestlohnwachstum in den osteuropäischen Ländern hat sich das Gefälle innerhalb der EU in den letzten Jahren allerdings deutlich verringert. In Österreich, Italien und den nordischen Ländern existiert kein gesetzlicher Mindestlohn. In diesen Staaten besteht aber eine sehr hohe Tarifbindung, die auch vom Staat stark gestützt wird. Faktisch ziehen dort also Tarifverträge eine allgemeine Lohnuntergrenze.
Deutscher Mindestlohn kaufkraftbereinigt auf Position 6 in der EU
Die Unterschiede im Mindestlohnniveau werden durch unterschiedliche Lebenshaltungskosten innerhalb der EU teilweise relativiert. Der WSI-Mindestlohnbericht weist deswegen auf Basis von Daten des Internationalen Währungsfonds (IMF) auch kaufkraftbereinigte Mindestlöhne aus. Durch das vergleichsweise hohe Preisniveau in Westeuropa fallen hier die Mindestlöhne in Kaufkraftstandards auf Euro-Basis (KKS €) niedriger aus: Luxemburg (12,29 KKS €), die Niederlande (12,26 KKS €) und Irland (12,16 KKS €) liegen nach dieser Betrachtungsweise fast gleichauf, gefolgt von Frankreich und Belgien (beide 11,92 KKS €). Deutschland (11,81 KKS €) liegt mit geringem Abstand auf dem 6. Rang (Abbildung 2 im Bericht). In Ost- und Südeuropa kommt aufgrund von tendenziell niedrigeren Lebenshaltungskosten ein gegenläufiger Effekt zum Tragen: So schließen Polen (10,36 KKS €), Spanien (9,32 KKS €) und Slowenien (8,64 KKS €) zu Westeuropa auf und auch beim Schlusslicht Bulgarien (5,48 KKS €) fällt der Mindestlohn nach Berücksichtigung der geringeren Lebenshaltungskosten deutlich höher aus.
Mindestlöhne außerhalb der EU
Auch außerhalb der EU sind Mindestlöhne weit verbreitet. Exemplarisch betrachtet das WSI die Mindestlöhne in 16 Nicht-EU-Ländern mit ganz unterschiedlichen Mindestlohnhöhen. Sie reichen von, jeweils umgerechnet, 14,70 Euro in Australien, 12,95 Euro in Neuseeland oder 11,08 Euro in Kanada über 6,80 Euro in Korea oder 6,44 im japanischen Landesdurchschnitt bis zu 3,75 Euro in der Türkei, 1,45 Euro in Argentinien, 1,18 Euro in Brasilien und 1,10 Euro in der Ukraine. Auch außerhalb Europas fallen die Unterschiede in KKS häufig etwas weniger groß aus.
„Weitgehend obsolet“ ist der landesweite Mindestlohn nach Einschätzung der WSI-Experten in den USA, weil er seit 2009 nicht mehr erhöht wurde und mit umgerechnet 6,70 Euro oder gerade einmal 4,85 Euro in KKS nicht zum Überleben reicht. Daher gibt es daneben in rund 30 US Bundesstaaten und Washington DC höhere regionale Untergrenzen. Dazu gehören die Bundesstaaten Washington (15,39 €), Kalifornien (15,24 €), New York (14,32 €), New Jersey (14,31 €) sowie Illinois (13,86 €).
Quelle: Pressemitteilung Hans-Böckler-Stiftung vom 18.02.2025
IAB: Generation Z: Erwerbsbeteiligung der 20- bis 24-Jährigen klettert auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten
Die Erwerbsbeteiligung in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen ist seit 2015, als der erste Jahrgang der Generation Z in diese Altersgruppe vorrückte, um über 6 Prozentpunkte auf rund 76 Prozent überdurchschnittlich gestiegen. Der Anstieg ist vor allem auf eine zunehmende Erwerbsbeteiligung unter Studierenden zurückzuführen. Dies zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die am Montag veröffentlicht wurde.
Junge Leute beteiligen sich heute stärker am Arbeitsmarkt als noch in den vergangenen Jahrzehnten. „Dass die Generation Z viel fordert, aber wenig arbeitet, ist ein verbreitetes Vorurteil. Doch es ist falsch. Die jungen Leute sind fleißig wie lange nicht mehr“, erklärt IAB-Forschungsbereichsleiter Enzo Weber. Von 2015 bis 2023 ist zwar sowohl die Teilzeit- als auch die Vollzeitbeschäftigung unter den 20- bis 24-Jährigen gestiegen, die Teilzeitbeschäftigung aber wesentlich stärker.
Die höhere Erwerbsbeteiligung Jüngerer ist vor allem einem wachsenden Anteil von Studierenden mit Nebenjobs geschuldet: Die Erwerbsquote unter Studierenden im Alter von 20 bis 24 Jahren zwischen 2015 und 2023 hat um 19,3 Prozentpunkte auf 56 Prozent zugenommen. Gleichzeitig ist die Erwerbsquote unter allen Nichtstudierenden dieser Altersgruppe im genannten Zeitraum ebenso gestiegen – um 1,6 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent. „Der Anstieg der Erwerbsquoten ist zu großen Teilen, aber nicht ausschließlich, auf eine höhere Erwerbsbeteiligung unter Studierenden zurückzuführen“, so IAB-Forscher Timon Hellwagner. „Dieser Befund widerspricht gängigen Klischees zur mangelnden Arbeitsbereitschaft der Generation Z, passt aber zu weiteren generationsspezifischen Ergebnissen. So wechseln junge Leute heute nicht häufiger den Job als früher und auch die Entwicklung der gewünschten Arbeitsstunden bei den Jungen unterscheidet sich nicht von der Älterer“, schreiben Hellwagner und Weber.
Die Studie beruht auf Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit und des Mikrozensus für die Jahre 2015 bis 2023 und ist abrufbar unter: https://www.iab-forum.de/generation-z-noch-ein-klischee-weniger/
Quelle: Pressemitteilung Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) vom 17.02.2025
Statistisches Bundesamt: Gender Pay Gap sinkt 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 18 % auf 16 %
- Unbereinigter Gender Pay Gap geht so stark zurück wie noch nie seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2006
- Bereinigter Gender Pay Gap dagegen unverändert bei 6 %
Frauen haben im Jahr 2024 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 16 % weniger verdient als Männer. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhielten Frauen mit 22,24 Euro einen um 4,10 Euro geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdienst als Männer (26,34 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sank der unbereinigte Gender Pay Gap um 2 Prozentpunkte. Das war der stärkste Rückgang seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2006. Dabei ging der unbereinigte Gender Pay Gap in den westlichen und östlichen Bundesländern gleichermaßen um 2 Prozentpunkte zurück. Damit blieb der unbereinigte Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern im Osten weiterhin deutlich kleiner als im Westen: Im Osten lag er im Jahr 2024 bei 5 % und im Westen bei 17 %.
Bruttomonatsverdienste stiegen bei Frauen stärker als bei Männern
Der Rückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps ist vor allem auf die stärkere Entwicklung der Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) von Frauen zurückzuführen. Im Jahr 2024 stiegen die Bruttomonatsverdienste der Frauen gegenüber 2023 um rund 8 % von durchschnittlich 2 633 Euro auf 2 851 Euro. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Männern stieg schwächer um rund 5 % von 3 873 Euro auf 4 078 Euro. Die durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeiten von Frauen und Männern erhöhten sich nur geringfügig. Sowohl Frauen als auch Männer arbeiteten im Jahr 2024 mit 122 beziehungsweise 149 Stunden im Durchschnitt etwa eine Stunde mehr pro Monat als im Jahr 2023.
Bereinigter Gender Pay Gap: Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien wie Männer verdienten im Schnitt weiterhin 6 % weniger pro Stunde
Ausgehend vom unbereinigten Gender Pay Gap lassen sich rund 63 % der Verdienstlücke durch die für die Analyse zur Verfügung stehenden Merkmale erklären. In Eurobeträgen sind das 2,58 Euro des Verdienstunterschieds von 4,10 Euro. Im Jahr 2023 waren noch 24 % der Verdienstlücke (1,06 Euro) darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen und Branchen tätig sind. 2024 sank dieser Anteil auf 21 % (0,87 Euro). Das könnte darauf hindeuten, dass Frauen inzwischen verstärkt in besser bezahlten Berufen und Branchen arbeiten. Ein weiterer Faktor, um den Verdienstunterschied zu erklären, ist der Beschäftigungsumfang: Frauen sind häufiger in Teilzeit beschäftigt, was in der Regel mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht. Dies macht rund 19 % des Verdienstunterschieds (0,79 Euro) aus. Etwa 12 % der Verdienstlücke (0,48 Euro) lassen sich durch das Anforderungsniveau des Berufs erklären.
Die verbleibenden 37 % des Verdienstunterschieds (1,52 Euro von 4,10 Euro) können nicht durch die im Schätzmodell verfügbaren Merkmale erklärt werden. Dieser unerklärte Teil entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap von 6 %. Demnach verdienten Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie im Jahr 2024 pro Stunde 6 % weniger als ihre männlichen Kollegen (westliche Bundesländer: 6 %, östliche Bundesländer: 8 %). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Unterschiede geringer ausfallen würden, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren für die Analyse zur Verfügung stünden, etwa Angaben zu Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Schwangerschaft, der Geburt von Kindern oder der Pflege von Angehörigen. Der bereinigte Gender Pay Gap ist daher als „Obergrenze“ für eine mögliche Verdienstdiskriminierung von Frauen zu verstehen.
Methodische Hinweise:
Der unbereinigte und der bereinigte Gender Pay Gap haben eine unterschiedliche Aussagekraft. Der unbereinigte Wert stellt die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern ohne Anpassungen gegenüber. Damit spiegelt er auch strukturelle Unterschiede und Zugangshürden von Frauen auf dem Arbeitsmarkt wieder. Beim bereinigten Gender Pay Gap können die verschiedenen Ursachen für die unterschiedlichen Verdienste herausgestellt werden. Ein Erklärvideo im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verdeutlicht die Sinnhaftigkeit beider Indikatoren.
Untersuchungen der ursächlichen Faktoren des Gender Pay Gap sind seit 2022 jährlich auf Basis der Verdiensterhebung möglich. Bis zum Berichtsjahr 2021 wurden Ergebnisse zum Gender Pay Gap basierend auf der vierjährlichen Verdienststrukturerhebung berechnet, die letztmalig für das Berichtsjahr 2018 durchgeführt und anschließend fortgeschrieben wurde. Ab dem Berichtsjahr 2022 wurde die vierjährliche Verdienststrukturerhebung durch die monatliche Verdiensterhebung abgelöst. Zwischen den Berichtsjahren 2021 und 2022 ist daher ein Zeitreihenbruch entstanden.
Berechnungsweise:
Die Ergebnisse zum Gender Pay Gap basieren auf den Erhebungen eines repräsentativen Monats. Im Berichtsjahr 2024 handelt es sich dabei um den April. Die Berechnung orientiert sich an der einheitlichen Definition nach Eurostat. Demnach werden alle Wirtschaftszweigabschnitte von B bis S in die Berechnung einbezogen, ausgenommen der Wirtschaftszweig O („Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“). Zudem werden Unternehmen erst ab einer Größe von zehn Beschäftigten bei der Berechnung berücksichtigt. Weitere Hinweise zur Berechnungsweise des Gender Pay Gap sind in der Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ auf der Themenseite „Gender Pay Gap“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden, ausführlich informieren auch die Artikel „Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen nach Bundesländern“ und „Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen – eine Ursachenanalyse auf Grundlage der Verdienststrukturerhebung 2018“ in der Zeitschrift „WISTA – Wirtschaft und Statistik“ (Ausgaben 4/2018 und 4/2021).
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse zum unbereinigten Gender Pay Gap in Deutschland einschließlich der Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer bieten die Tabellen auf der Themenseite „Verdienste und Verdienstunterschiede„. Ergebnisse nach Mitgliedstaaten der Europäischen Union bieten die Grafik auf der Themenseite „Europa in Zahlen“ sowie die Eurostat-Datenbank. Weitere Kennzahlen zum Stand und zur Entwicklung der Gleichstellung von Frauen und Männern sind auf der Themenseite „Gleichstellungsindikatoren“ verfügbar. Dort sind auch Ergebnisse zum „Gender Pension Gap“ (geschlechterspezifischer Abstand bei Alterseinkünften) zu finden.
INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN
AWO: Bundesfreiwilligendienst gefährdet: Plätze im nächsten Jahrgang nicht gesichert
Gestern wurde bekannt, dass der Fortbestand des Bundesfreiwilligendienstes akut gefährdet ist. Anders als zunächst angekündigt, seien die Platzkontingente für das Haushaltsjahr 2026 nicht gesichert. Dazu erklärt Michael Groß, Präsident der Arbeiterwohlfahrt:
„Wieder einmal lässt die Bundesregierung junge Menschen im Regen stehen und hält sich nicht an die Zusagen, die Freiwilligendienste bedarfsgerecht auszustatten. Unsere Zahlen zeigen, dass wir schon in wenigen Wochen keine neuen Bundesfreiwilligendienst-Vereinbarungen mit Engagierten mehr abschließen können, weil im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung für 2026 nicht genügend Reserven zur Verfügung stehen. Damit werden Menschen enttäuscht, die sich ein Jahr lang als Freiwillige für die Gesellschaft engagieren wollen, aber keinen Platz bekommen. Diese Entwicklung bedroht aber auch grundsätzlich den Bundesfreiwilligendienst in seiner Existenz, denn das System bricht zusammen, wenn erst mit einem neuen Haushaltsbeschluss wieder Gelder bereitgestellt werden. Wann dieser Beschluss erfolgen wird, ist derzeit nämlich unklar. Das ist ein Offenbarungseid und vertieft die Verunsicherung und das Gefühl des Nicht-Gesehen-Werdens der jungen Generation. Wir werden daran erinnern, wenn die nächste populistische Debatte um einen sozialen Pflichtdienst aufgemacht wird.“
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 20.02.2025
AWO fordert „Sozialstaat für die Demokratie“
Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ruft die demokratischen Parteien dazu auf, die Bedeutung des Sozialstaats für die Demokratie im Wahlkampf zum Thema zu machen.
„Vor zwei Wochen konnten wir im Bundestag erleben, dass der politische Anstand verloren geht, wenn Konservative und Rechtsextreme gemeinsame Sache machen. Auch beim Sozialstaat scheint eine große Nähe dieser Parteien zu bestehen – und ein ebenso großes Risiko, Vertrauen in die Demokratie zu beschädigen“, mahnt AWO-Präsident Michael Groß.
Dabei sind fortschrittliche sozialpolitische Maßnahmen und Investitionen in unser Gemeinwesen aus Sicht der AWO das richtige Mittel gegen den Vertrauenslust in Politik und Demokratie: „Wer erlebt, dass der Staat in Notlagen da ist, Sicherheit gibt und Chancen schafft, erkennt auch die Funktionsfähigkeit und Wichtigkeit der Demokratie“, so Groß.
Zur Finanzierung der dafür notwendigen sozialen Infrastruktur brauche es größere Hebel, so Groß: „Wir müssen dringend die seit 1997 ausgesetzte Vermögensteuer wieder erheben und die höchsten Einkommen stärker besteuern. Dadurch sind dem Staat bis heute viele hundert Milliarden verloren gegangen. Nur mit einer Stärkung der Einnahmenseite schaffen wir den nötigen finanziellen Spielraum, um den Investitionsstau der sozialen Dienste und Einrichtungen zu beheben.“
Die AWO ruft die Parteien auf, ihre Ideen für einen „Sozialstaat für die Demokratie“ zu diskutieren. Vor allem Kinder und Jugendliche müssten heute eine funktionierende Demokratie erleben, um sich für sie einzusetzen und zu leben. Daher fordert die AWO eine Reform der Familienförderung, die durch eine Senkung des Kinderfreibetrages für Betreuung, Erziehung und Ausbildung mehr Mittel zur Unterstützung armutsbetroffener Kinder ermöglichen würde, wie eine Studie von AWO und DIW jüngst ergeben hat.
Die Arbeiterwohlfahrt hat zur Bundestagswahl 15 Kernforderungen an die nächste Bundesregierung formuliert, darunter die Forderung nach einer Vermögenssteuer und einer Reform der monetären Familienförderung. Mehr dazu hier: awowaehltdemokratie.awo.org.
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 10.02.2025
BKU, KSD und Familienbund der Katholiken stellen gemeinsame Forderungen an die Politik : Für eine familienfreundliche Baupolitik
Der Bund Katholischer Unternehmer (BKU), der Familienbund der Katholiken (FDK) und der Katholische Siedlungsdienst (KSD) fordern eine umfassende Reform der Bau- und Wohnungspolitik, um Familien den Zugang zu Wohnungen und Wohneigentum zu erleichtern. Die katholischen Verbände richten sich mit einem Forderungskatalog an die Politik, um im Vorfeld der kommenden Bundestagswahlen auf die Dringlichkeit einer familienfreundlichen Baupolitik hinzuweisen.
Wohnraum als Grundlage von Familienleben und Sorgearbeit sichern
„Eine familienfreundliche Baupolitik ist unverzichtbar für die demografische, soziale und wirtschaftliche und schließlich auch politische Zukunft unseres Landes“, erklären die Verbände in einer gemeinsamen Pressemitteilung.
„Die Familiengründung darf nicht dadurch erschwert werden, dass Wohnraum fehlt oder unerschwinglich ist. Wohnraum muss besonders für Familien wieder erschwinglich werden und dennoch nachhaltig und wirtschaftlich effizient bleiben. Darum fordern wir die Politik dazu auf, familienfreundliche Reformen des Wohnungsbaus anzugehen“, erklärt Dr. Martin Nebeling, Vorstand des BKU.
“Durch Reformen von Bau- und Sanierungsbestimmungen sowie gezielte Fördermaßnahmen für Familien muss sichergestellt werden, dass die nötige klimagerechte Ausgestaltung von Bau- und Sanierungsvorhaben mit einer Entlastung für Familien einhergehen, um sie vor übermäßigen finanziellen Belastungen zu schützen“, äußert Ulrich Hoffman, Präsident des Familienbundes der Katholiken.
„Zudem brauchen wir dringend eine ernsthafte Entbürokratisierung und Digitalisierung des Baurechts“, ergänzt Thomas Hummelsbeck, Vorstandsvorsitzender des KSD Katholischer Siedlungsdienst e.V. „Dies hilft der gesamten Bau- und Wohnungswirtschaft und damit auch Familien. Ebenso muss die Förderkulisse einfacher gestaltet werden, um einen besseren Zugang zu ermöglichen und Projekte schneller auf den Weg zu bringen.“
Zentrale Forderungen für eine nachhaltige und familienfreundliche Baupolitik
Der Bund Katholischer Unternehmer, der Katholische Siedlungsdienst und der Familienbund der Katholiken fordern, dass die Politik entschlossene Schritte unternimmt, um:
- Familien den Ersterwerb von Wohneigentum zu erleichtern: Der Verzicht auf die Grunderwerbsteuer oder ein nach Kinderzahl gestaffelter Freibetrag beim Ersterwerb einer eigengenutzten Immobilie, würde jungen Familien erhebliche finanzielle Erleichterung verschaffen und die Vermögensbildung fördern. Gerade in Bundesländern mit hohen Steuersätzen ist dies ein entscheidender Hebel, um Hürden beim Wohnungskauf abzubauen. In allen Bundesländern außer Bayern und Thüringen wurde die Grunderwerbsteuer seit 2006 stark erhöht.
- Familien durch innovative Darlehensmodelle zu unterstützen: Eigenkapitalersetzende Nachrangdarlehen würden Familien unterstützen, die zwar die monatlichen Zins- und Tilgungsbelastungen tragen können, aber nicht das notwendige Eigenkapital haben. Ein Teilrückzahlungsverzicht je Kind – auch bei künftigem Familienzuwachs – könnte jungen Familien den Zugang zu Wohneigentum und die Entscheidung für Kinder weiter erleichtern.
- Bezahlbaren, familiengerechten Wohnraum schaffen: Da Familien bei Investoren oft nicht im Blick sind, muss angemessener Wohnraum für Familien zielgenau in den angespannten Wohnungsmärkten geschaffen werden. Die Förderrichtlinien der Bundesländer sollten Quoten für familientaugliche Wohnungen und deren tatsächliche Vergabe an Familien verlangen. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau dürfen nicht gekürzt, sondern müssen erhöht werden.
- Klimagerechtes und bezahlbares Bauen zu fördern: Bestehende Baubestimmungen sollten überarbeitet werden, um gezielt ökologisches Bauen und Sanieren zu erleichtern. und bspw. den Holzbau aufzuwerten. Dabei müssen soziale Aspekte wie bezahlbarer Wohnraum für Familien und wirtschaftlich schwächere Haushalte berücksichtigt werden.
- Familien bei energetischen Vorgaben zu entlasten: Um die hohen Kosten von klimagerechtem Bauen und Sanieren tragbar zu machen, bedarf es einer angemessenen finanziellen Förderung für Privathaushalte mit geringen bis mittleren Einkommen. Ohne diese gezielte Entlastung würde die Umsetzung klimapolitischer Ziele das Ziel bezahlbaren Wohnraums konterkarieren.
- Die relative CO₂-Verbesserung zu fördern: Statt auf starre Vorgaben für energetische Sanierungen zu setzen, sollten gezielte Anreize geschaffen werden, um effektive CO₂-Einsparungen zu belohnen.
- Bauprojekte durch ernsthafte Entbürokratisierung beschleunigen: Das Baurecht muss umfassend und ernsthaft entbürokratisiert, (Genehmigungs-) Prozesse digitalisiert werden – dies hilft der gesamten Bau- und Wohnungswirtschaft. Dazu gehört auch eine einfachere, zugänglichere Gestaltung der Förderkulisse, die auskömmlich und verlässlich finanziert sein muss.
Weitere Informationen
„Acht Impulse für den Wohnungsbau“, www.bku.de/8impulse
Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit aus familienpolitischer Perspektive, https://familienbund.org/artikel/positionspapier-des-familienbunds-der-katholiken-zu-klimagerechtigkeit-und-nachhaltigkeit-aus-familienpolitischer-perspektive
Quelle: Pressemitteilung Bund Katholischer Unternehmer (BKU), Familienbund der Katholiken und KSD Katholischer Siedlungsdienst e.V. vom 17.02.2025
DGB: Breites Bündnis präsentiert Eckpunkte für eine echte BAföG-Reform
Für eine grundlegende BAföG-Reform nach der Bundestagswahl spricht sich ein breites Bündnis aus Deutschem Studierendenwerk, Gewerkschaften, kirchlichen Hochschulverbänden, dem freien Zusammenschluss von Student*innenschaften sowie der Initiative Arbeiterkind aus. „Noch immer bekommen zu wenige Studierende BAföG. Rund ein Drittel der Studierenden lebt in prekären Verhältnissen“, heißt es in dem heute veröffentlichten Papier. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack sagte am Montag in Berlin:
„Nach der Bundestagswahl muss das BAföG zügig an die veränderten Studien- und Ausbildungsbedingungen sowie die höheren Lebenshaltungskosten angepasst werden. Die Bundesregierung muss endlich die Fördersätze erhöhen, damit sie zum Leben und für ein Dach über dem Kopf ausreichen. Ebenso sollte sie einen automatischen Inflationsausgleich einführen. Für die große Mehrheit der BAföG-Geförderten ist diese Unterstützung entscheidend, um überhaupt studieren zu können. Die Politik hat die Verantwortung, durch ein verbessertes BAföG für Chancengleichheit beim Ausbildungszugang zu sorgen, damit das Fachkräftepotential in Deutschland optimal genutzt werden kann.“
Die Erklärung im Wortlaut:
Perspektiven eröffnen ‒ In die Zukunft investieren!
Breites Bündnis präsentiert Eckpunkte für eine echte BAföG-Reform
In einem breiten Bündnis fordern wir die kommende Bundesregierung und den Bundestag auf, nach den Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 eine umfassende BAföG-Reform schnell anzugehen.
Das BAföG ist das Herzstück der staatlichen Studienfinanzierung. Und ein zentrales Instrument, um Chancengleichheit beim Zugang zur Hochschule zu sichern. Doch noch immer ist es nicht auskömmlich, und noch immer bekommen zu wenige Studierende BAföG. Rund ein Drittel der Studierenden lebt in prekären Verhältnissen. Wir haben bei der Studienfinanzierung ein Umsetzungs- und kein Erkenntnisproblem.
Die aus unserer gemeinsamen Sicht wichtigsten Punkte für eine echte BAföG-Reform sind:
Das BAföG muss die Kosten für Lebenshaltung und Ausbildung decken: Das BAföG reicht noch immer nicht zum Leben aus. Die Bedarfssätze sind deshalb in einem ersten Schritt sofort auf ein existenzsicherndes Minimum anzuheben, durch höhere Freibeträge sind auch Familien mit mittlerem Einkommen zu erreichen.
Wohnkosten müssen angemessen berücksichtigt werden: Die Wohnkostenpauschale muss im Einklang mit der Düsseldorfer Tabelle auf mindestens 440 Euro im Monat erhöht werden. Auch die Wohnkostenpauschale für Geförderte, die bei den Eltern wohnen, muss deutlich erhöht werden.
Bedarfssätze und Freibeträge automatisch anpassen: Die Bedarfssätze und Freibeträge im BAföG müssen unbedingt jährlich und automatisch an die Entwicklung von Preisen und Einkommen angepasst werden, denn Studierende brauchen Finanzierungssicherheit. Die Freibeträge vom eigenen Einkommen der Schüler*innen und Studierenden aus Minijobs sind automatisiert an die Minijob- Obergrenze zu koppeln. Die Kranken- und Pflegeversicherungszuschläge sind automatisiert an die Höhe der Beiträge anzupassen.
BAföG-Darlehensanteil reduzieren: Verschuldungsängste schrecken vor allem diejenigen ab, die am meisten von einer Förderung profitieren würden. Der Darlehensanteil muss schrittweise reduziert werden, bis das BAföG wieder als Vollzuschuss ausgezahlt wird.
Die Bündnispartner:
Arbeiterkind.de
Bundesverband katholische Kirche an Hochschulen
Deutsches Studierendenwerk ‒ DSW
Deutscher Gewerkschaftsbund ‒ DGB
DGB-Jugend
freier zusammenschluss von student*innenschaften ‒ fzs e.V.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ‒ GEW
Verband der Evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 17.02.2025
DGB warnt vor weiterem Anstieg bei Menschen ohne Berufsabschluss – 8-Punkte-Programm für mehr Fachkräfte vorgelegt
Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels in Deutschland hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ein 8-Punkte-Programm vorgelegt, das sich an Menschen ohne Berufsabschluss richtet. Ziel des Programms ist es, allen Menschen gute Chancen auf eine Ausbildung zu bieten, die Fachkräftepotenziale besser zu erschließen und den Übergang von der Schule in den Beruf zu verbessern. Fast 2,9 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Insgesamt sind es in Deutschland mindestens 4,5 Millionen Beschäftigte – Tendenz steigend. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack warnte vor erheblichen Risiken sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft insgesamt, sollte sich diese Entwicklung nicht umkehren lassen. Die Gewerkschafterin sagte am Montag in Berlin:
„Wir fordern die kommende Bundesregierung auf, mehr Einsatz für Aus- und Weiterbildung zu zeigen und dringend ein umfassendes Aktionsprogramm für Menschen ohne Berufsabschluss aufzulegen. Die zunehmend hohe Zahl von Menschen ohne Berufsabschluss ist besorgniserregend. Es zerreißt unsere Gesellschaft, wenn immer mehr Menschen im Arbeitsleben abgehängt werden. Für die Betroffenen bedeutet es oft ein Leben in unsicheren Arbeitsverhältnissen, mit niedrigen Löhnen und kaum Perspektiven. Obendrein führt dieses ungenutzte Potenzial zu einer weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels: Während Betriebe immer öfter über fehlende Fachkräfte klagen, bleiben viele Menschen außen vor. Es reicht eben nicht, sich allein auf Zuwanderung oder kurzfristige Weiterbildungsmaßnahmen zu verlassen. Wir brauchen Priorität für unser Bildungssystem und mehr Geld für wirksame Instrumente, um Menschen zu einem Berufsabschluss zu führen.“
Mit seinem 8-Punkte-Plan hat der DGB klare Anforderungen für Aus- und Weiterbildung formuliert: Das Programm sieht vor, die Ausbildungsgarantie auszuweiten und das Nachholen von Berufsabschlüssen stärker zu fördern. Auch die Anerkennung ausländischer Qualifikationen soll verbessert und die Validierung von Berufserfahrungen gefördert werden. Zudem schlagen wir die Einführung einer Bildungs(teil)zeit vor, um Weiterbildung und den Erwerb eines Berufsabschlusses besser zu ermöglichen. Der DGB fordert zudem die Fortsetzung der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung, um Menschen die notwendige Grundbildung für eine umfassende gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu ermöglichen.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 17.02.2025
Der Paritätische: #DuEntscheidest: Eine Aktion des Bündnisses „Zusammen für Demokratie“
Ein breites gesellschaftliche Bündnis, zu dem auch der Paritätische Gesamtverband gehört, startet Kampagne.
In ganz Deutschland werden ab heute an Kirchen und Gewerkschaftshäusern, Vereinsgebäuden, sozialen Einrichtungen und vielen weiteren Orten Banner und Plakate aufgehängt. Mit der Kampagne #DuEntscheidest wirbt ein breites gesellschaftliches Bündnis aus 69 Organisationen mit vier klaren Botschaften für demokratische Werte und gesellschaftlichen Zusammenhalt:
- „Das Recht des Stärkeren schwächt alle anderen. Wir wollen solidarisch zusammenleben.“
- „Menschenrechte gelten für alle Menschen. Wir wollen ein Land, das niemanden im Stich lässt.“
- „Rassismus ist keine Meinung. Wir wollen Vielfalt leben.“
- „Eine gerechte Gesellschaft ist eine Aufgabe, kein Traum. Wir wollen Veränderungen gemeinsam gestalten.“
Zum Auftakt der Aktion fand heute in Berlin eine gemeinsame Banner-Aktion der Bündnispartner statt. Daran beteiligten sich: Anja Piel (Geschäftsführender Bundesvorstand Deutscher Gewerkschaftsbund), Gökay Sofuoğlu (Bundesvorsitzender Türkische Gemeinde Deutschland), Dr. Julia Duchrow (Generalsekretärin Amnesty International Deutschland), Achim Meyer auf der Heyde (Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes), Prälat Dr. Karl Jüsten (Leiter Kommissariat der deutschen Bischöfe), Marc Frings (Generalsekretär Zentralkomitee der deutschen Katholiken), Tareq Alaows (flüchtlingspolitischer Sprecher Pro Asyl), Dr. Christian Stäblein (Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) und Tobias Pforte-von Randow (stellv. Geschäftsführer Deutscher Naturschutz-Ring).
Auch in den Sozialen Medien zeigen unter dem Motto #DuEntscheidest zahlreiche Menschen Gesicht: Unsere Demokratie geht uns alle an! Das Engagement von jedem und jeder ist gefragt. Demokratie endet nicht am Wahltag. Sie lebt von der aktiven Beteiligung der Menschen – in der Politik, im Betrieb, in der Kirchengemeinde, in der Nachbarschaft oder im Ehrenamt. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, gleiche Chancen für alle und Klimagerechtigkeit gehören ebenso dazu wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und politische Teilhabe. Vor diesem Hintergrund versteht sich die Aktion #DuEntscheidest mit der Präsentation der Botschaften auf Bannern und in den Sozialen Medien über den Wahltag hinaus als sichtbares Zeichen gegen Spaltung und für Zusammenhalt. Das Bündnis will den vielen Engagierten den Rücken stärken und zugleich zu weiteren Initiativen ermutigen.
„Zusammen für Demokratie“ ist ein Bündnis, dem Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften, Organisationen aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Kultur, Bildung, Jugend, Menschenrechte, Migration und Klimaschutz angehören. Die Bündnispartner verbindet die Überzeugung, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat.
Zum Hintergrund der Kampagne: Weltweit steht die liberale Demokratie unter Druck, auch in Deutschland. Rechtsextreme Akteure bestreiten die fundamentale Gleichheit aller Menschen und negieren die Menschenrechte. Statt konkrete Lösungen für bestehende Probleme anzubieten, spielen sie mit Ressentiments, schüren Rassismus und andere menschenfeindliche Haltungen, schwächen demokratische Institutionen und verachten die rechtsstaatliche Kultur. Auch das Projekt eines vereinten Europas bekämpfen sie. Dieser Gefahr stellen sich die Bündnispartner gemeinsam entgegen: „Wir treten ein für die unteilbaren Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und eine klimagerechte Zukunft. Wir stehen für eine vielfältige, freie und offene Gesellschaft. Gemeinsam verteidigen wir unsere Demokratie und alle, die hier leben, gegen die Angriffe der extremen Rechten“, so das Bündnis (https://zusammen-fuer-demokratie.de/ueber-uns/).
Achim Meyer auf der Heyde, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes: „Demokratie wird in Vereinen und sozialen Initiativen vor Ort gelebt und verteidigt. Auf diesen Einsatz kommt es jetzt mehr denn je an, denn es ist etwas ins Kippen geraten in unserer Gesellschaft. Es ist Zeit solidarisch zu sein und zusammenzuführen, statt zu spalten!“
Gökay Sofuoğlu, Bundesvorsitzender Türkische Gemeinde Deutschland: „Dass wir gemeinsam vor der Geschäftsstelle der TGD mit vielen Organisationen Flagge zeigen für Demokratie und die Werte des Grundgesetzes, das gibt uns, den Menschen mit Migrationsgeschichte, die Kraft auszuhalten, dass die Brandmauer beschädigt wurde. Es gibt uns den Glauben zurück, dass dies auch unsere Heimat bleiben wird.”
Anja Piel, Geschäftsführender Bundesvorstand Deutscher Gewerkschaftsbund: „Freie Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechte sind fester Bestandteil einer jeden echten Demokratie. Ohne diese substanziellen Rechte gibt es keine Tarifverträge, keine Mitbestimmung und keine soziale Sicherheit. Wir machen uns als Gewerkschaften stark für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt ohne Unterscheidung von sozialer oder ethnischer Herkunft – in den Betrieben, auf der Straße und mit dieser Aktion auch sichtbar im ganzen Land.“
Dr. Julia Duchrow, Generalsekretärin Amnesty International Deutschland: „Menschenrechte müssen im Alltag verteidigt werden. Denn sie sind die Grundlage unseres täglichen Zusammenlebens. Wer die Rechte einiger verletzt, verletzt die Rechte aller. Wir lassen uns nicht gegeneinander in Stellung bringen!“
Marc Frings, Generalsekretär Zentralkomitee der deutschen Katholiken: „Demokratie braucht Haltung. Gemeinsam stehen wir ein für die unverfügbare Menschenwürde, den Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir wollen ein Land, das niemanden im Stich lässt.”
Tobias Pforte-von Randow, stellv. Geschäftsführer Deutscher Naturschutz-Ring: „Als deutsche Umweltbewegung sehen wir in dem weltweiten Rechtsruck eine direkte Gefahr für die Gesellschaft als Ganzes und uns als Teil der Zivilgesellschaft: Wer Demokratie und Menschenrechte infrage stellt, bedroht auch den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Denn Natur- und Klimaschutz braucht Kooperation. Dass nicht nur weltweit, sondern auch hier in Deutschland die fossile Lobby viel Geld aufbringt, um rechtsextreme Parteien zu stärken, zeigt: Eine lebenswerte Zukunft braucht eine offene, vielfältige demokratische Gesellschaft.”
Weitere Zitate der Bündnis-Partner: https://zusammen-fuer-demokratie.de/wp-content/uploads/2025/02/DuEntscheidest-Stimmen.pdf
Bündnis „Zusammen für Demokratie“: www.zusammen-fuer-demokratie.de
Die Materialien der Kampagne: https://shop.digitalcourage.de/buendnis-zusammen-fuer-demokratie-materialien/
Quelle: Pressemitteilung Der Paritätische Gesamtverband vom 10.02.2025
Diakonie: Studie: Vier von fünf Bundesbürgern empfinden Spaltung der Gesellschaft –Kampagne #VerständigungsOrte startet
80 Prozent der Menschen in Deutschland nehmen eine Spaltung der Gesellschaft wahr. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt die Studie „Verständigungsorte in polarisierenden Zeiten“ von midi, der Zukunftswerkstatt von Diakonie und evangelischer Kirche. Die gefühlte Spaltung verläuft nach Ansicht der meisten Befragten zwischen einer kleinen Minderheit und einer großen Mehrheit.
Nur knapp die Hälfte der Befragten ist mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. Zwei Drittel der Befragten sind über gesellschaftliche Entwicklungen oder Ereignisse verärgert, viele sogar wütend. Besonders gering ist das Vertrauen in politische Institutionen wie Parteien und die Bundesregierung.
Jeder dritte Befragte hat bereits erlebt, dass Diskussionen über polarisierende Themen unsachlich oder respektlos verlaufen, ein Drittel der Befragten hat schon einmal den Kontakt zu Menschen wegen kontroverser Themen eingeschränkt oder abgebrochen. Dies führt dazu, dass der Austausch über polarisierende Themen bewusst vermieden wird.
Hier setzt die Kampagne #VerständigungsOrte an, mit der Evangelische Kirche und Diakonie deutschlandweit Orte des Dialogs über gesellschaftliche Krisen und Konflikte schaffen.
Bischöfin Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland: „Die Ergebnisse der Studie kann man durchaus als alarmierend bezeichnen. Die meisten Menschen in unserem Land spüren eine Spaltung. Und viele ziehen sich in ihre Blasen zurück. Als Kirche und Diakonie leiten wir daraus – und auch aus unserer biblisch-geistlichen Tradition – einen Auftrag und eine Verpflichtung ab. Wir wollen uns für Verständigung, Dialog und ein respektvolles Miteinander stark machen. Mit der Kampagne #VerständigungsOrte wollen wir dafür Räume schaffen und sichtbar machen.“
Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland: „Es sind nicht nur äußere Faktoren wie der Krieg in der Ukraine, die vielen Menschen Angst machen. Auch rapide gesellschaftliche Veränderungen und eine zunehmende Einkommensungleichheit sorgen für Verunsicherung. Hier gilt es, genau hinzusehen und diese vielen Realitäten in den Blick zu nehmen, sie auszusprechen – und dann in einen Dialog zu kommen, auf Augenhöhe und mit Respekt. Wir brauchen weniger Konfliktarenen. Wir brauchen mehr Verständigungsorte!“
Dr. Klaus Douglass, Direktor der Zukunftswerkstatt von Diakonie und evangelischer Kirche (midi): „Die Herausforderungen sind groß. Mit der Kampagne #VerständigungsOrte wollen Kirche und Diakonie im Jahr nach der Bundestagswahl den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, der gefühlten Polarisierung entgegenwirken und tragfähige Antworten auf die Frage liefern: Wie wollen wir in Deutschland zukünftig gemeinsam leben?“
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Diakonie Deutschland vom 13.02.2025
Diakonie: Gutachten zum sozial-ökologischen Existenzminimum: Einkommensschwache Haushalte in der Klimapolitik nicht weiter abhängen
Ohne ein Umsteuern in der Sozial- und Klimapolitik drohen die einkommensschwächsten Haushalte in Deutschland weiter abgehängt zu werden. „In der Debatte um den Klimaschutz wird die Perspektive von Menschen mit wenig Geld viel zu oft vergessen,“ sagt Elke Ronneberger, Bundesvorständin der Diakonie Deutschland, anlässlich der Vorstellung eines Gutachtens der Diakonie Deutschland zum sozial-ökologischen Existenzminimum in Berlin.
Wegen der aktuellen Wirtschaftsentwicklung und der notwendigen Investitionen in dem Klimaschutz werden Menschen in den unteren Einkommensgruppen in absehbarer Zeit mit deutlich weniger verfügbarem Einkommen ihren Alltag bestreiten müssen. Zumindest dann, wenn sich die Verteilungsentwicklung der letzten 25 Jahre fortsetzen sollte. Das prognostizieren der Ökonom Dr. Benjamin Held und die Verteilungsforscherin Dr. Irene Becker in ihrem von der Diakonie Deutschland in Auftrag gegebenen Gutachten. Gründe dafür seien die wachsende Einkommensungleichheit, die Kosten für Investitionen zum Beispiel in die Infrastruktur und steigende Preise. „Unser Gutachten zeigt, dass die Folgen der Klimakrise auch in Deutschland das Existenzminimum gefährden könnten, wenn die Politik nicht gegensteuert. Wir müssen neu darüber nachdenken, wie wir auch in Zukunft für alle die Teilhabe an der Gesellschaft sichern. Dazu müssen wir bei der Bestimmung des Existenzminimums ökologische Kriterien berücksichtigen. In Zukunft muss ein ‚sozial-ökologisches Existenzminimum‘ sicherstellen, dass wir niemanden bei der Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft zurücklassen“, so Ronneberger.
Ein großes Problem sind die die gestiegenen Lohnunterschiede. Die Forscherinnen und Forscher zeigen, dass die Einkommensungleichheit in den vergangenen 25 Jahren deutlich zugenommen hat. So sind die verfügbaren Einkommen der obersten zehn Prozent der Haushalte zwischen 1995 und 2020 preisbereinigt um 51 Prozent gestiegen, die der untersten zehn Prozent dagegen nur um vier Prozent. Zugleich ist der Regelsatz für Menschen, die Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter erhalten, im gleichen Zeitraum preisbereinigt sogar um drei Prozent gesunken und erreicht erst jetzt wieder das Niveau von 1995. Parallel dazu führt die Klimakrise zu deutlichen Preissteigerungen, zum Beispiel durch die CO2-Bepreisung. Dies kann dazu führen, dass sich Menschen mit geringem Einkommen nicht ausreichend am Klimaschutz und am gesellschaftlichen Leben beteiligen können, weil ihnen schlicht das Geld dafür fehlt. „Die Folgen des Klimawandels wie Extremtemperaturen und Unwetter treffen soziale Einrichtungen sowie Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen besonders hart. Klimaschutz und der Schutz vor Armut gehören untrennbar zusammen. Die nächste Bundesregierung steht zudem in der Verantwortung, soziale Einrichtungen bei den Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung finanziell zu unterstützen“, sagt Katja Kipping, Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbands.
Die Abwärtsspirale kann durch einen Mix sozialpolitischer Maßnahmen durchbrochen werden. Dazu bedarf es unter anderem einer gezielten Stärkung von Geringverdienern, etwa durch eine Einkommensteuerreform, eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Reform der Grundsicherung. Dr. Brigitte Knopf, Direktorin und Gründerin von Zukunft KlimaSozial und stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen, betont die gesamtgesellschaftlichen Chancen, die das Zusammendenken von Klimaschutz und sozialen Fragen bietet: „Wenn die sozial gerechte Transformation zur Klimaneutralität erfolgreich sein soll, kommt es vor allem darauf an, dass wir auch Haushalten mit unterem und mittlerem Einkommen ermöglichen, aus einem CO2-intensiven Lebensstil auszusteigen. Das kann gelingen, wenn wir Klima- und Sozialpolitik von Anfang an zusammendenken. Mit einem Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge, Ordnungsrecht, gezielter Förderung und einem sozial gestaffelten Klimageld ermöglichen wir eine positive Teilhabe an der Transformation für alle, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Akzeptanz von Klimaschutz insgesamt.“ So könnten sowohl die Klimaziele erreicht als auch gesellschaftliche Teilhabechancen gesichert werden. Im Gutachten werden fünf Lösungsansätze vorgestellt, die besonders geeignet sind, um diese Ziele zu erreichen und damit ein ‚sozial-ökologisches Existenzminimum‘ sicherzustellen.
Renate Krause, Aktive in der Selbstvertretung von Menschen mit Armutserfahrung, ergänzt: „Auch Menschen, die in Grundsicherung oder im Bürgergeldbezug leben, sind entschlossen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aber diese Mitwirkung ist nicht ohne Extra-Kosten möglich. Eine energetisch sanierte Wohnung ist gut für den Klimaschutz, aber der Umbau kann von Menschen mit wenig Geld nicht bezahlt werden. Viel zu häufig sind wir, besonders auf dem Land, auf das Auto angewiesen. Gut ausgebaute Infrastruktur und ein deutschlandweites Sozialticket fehlen immer noch. Gesunde und ökologisch produzierte Lebensmittel sind nicht finanzierbar. So können in Armut Lebende den Weg zur Klimaneutralität nicht unterstützen, der Weg bleibt verschlossen! Nur ein ‚sozial-ökologisches Existenzminimum‘ sichert die Möglichkeit zur Teilhabe an dieser Transformation! Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein.“
Weitere Informationen:
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Diakonie Deutschland vom 11.02.2025
djb: Europäisches Recht im Netz konsequent zum Schutz von Mädchen und Frauen durchsetzen
Anlässlich des diesjährigen Safer Internet Day (SID) fordert der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) eine stärkere Regulierung der Social-Media-Anbieter*innen sowie Betreiber*innen von Online-Plattformen und die konsequente Durchsetzung der EU-Daten- und Digitalgesetze. Der SID ist ein Aktionstag, um die Sicherheit für Kinder und Jugendliche im Internet zu verbessern. Die Koordinierung läuft über die EU-Initiative klicksafe zum diesjährigen Thema „Keine Likes für Lügen! Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz“.
„Die Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen ist dringend notwendig, aber nicht ausreichend. Social Media-Anbieter*innen sowie Betreiber*innen von Online-Plattformen müssen für das rechtswidrige Ausspielen jugendgefährdender und antifeministischer Inhalte spürbar zur Verantwortung gezogen werden“, erläutert Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb.
In Europa und auch in Deutschland mehren sich Einzelpersonen und Personengruppen, die den Feminismus zum Feindbild erklären. Zu dieser gesellschaftlichen Stimmung tragen Social-Media-Anbieter*innen sowie Betreiber*innen von Online-Plattformen mit gezielter werblicher (Online)-Ansprache bei. Die Folgen sind dramatisch. Der Alltag von Mädchen und Frauen in den sozialen Netzwerken ist geprägt von Beschimpfungen, Drohungen, sexueller Belästigung und der Angst vor Demütigungen. „Der djb sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert ein Verbot der Beobachtung des Nutzer*innenverhaltens und politischer werblicher (Online)-Ansprache,“ betont Anke Stelkens, Vorsitzende der Kommission Digitales. Zu der Tatsache, dass die gängige Praxis gegen die Regelungen der DSGVO verstößt, hat sich der djb umfänglich geäußert. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, sondern muss für alle Generationen und Geschlechter ein sicherer Ort sein.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 11.02.2025
djb: Heute Gesetzentwurf umsetzen, für reproduktive Gerechtigkeit
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) unterstützt den fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs und fordert anlässlich der heutigen Anhörung im Rechtsauschuss dessen zeitnahe Umsetzung. In seiner aktuellen Stellungnahme bekräftigt der djb, dass der Entwurf eine längst überfällige Reform darstellt, die die reproduktiven Rechte von Frauen und trans*, inter* und nichtbinären Personen stärkt. Die Entscheidung über diesen Entwurf muss noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. „Es ist ein Erfolg zivilgesellschaftlicher Initiativen, dass diese Anhörung überhaupt stattfindet. Jetzt liegt es am Gesetzgeber, diesen ersten notwendigen Schritt zur reproduktiven Gerechtigkeit in der letzten Sekunde dieser Legislatur zu gehen,“ so Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb.
Der Gesetzentwurf sieht vor, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen nach einer Beratung zu legalisieren und damit aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Zudem sollen schwangere Personen nach dieser Frist grundsätzlich straffrei bleiben. Dies entspricht auch den langjährigen Forderungen des djb. Der Entwurf setzt damit zumindest teilweise internationale Empfehlungen um und korrigiert bestehende rechtliche Widersprüche.
„Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen hat noch nie zu mehr Schutz ungeborenen Lebens geführt, sondern vielmehr dazu, dass Abbrüche unsicher sind. Eine Neuregelung ist daher nicht nur juristisch möglich, sondern auch dringend notwendig,“ betont Dilken Çelebi, LL.M., Vorsitzende der Kommission für Strafrecht im djb.
Der djb fordert jedoch, dass diese Reform nur als erster Schritt verstanden wird. Langfristig müssen auch die verpflichtende Beratung und die bestehende Frist von zwölf Wochen entfallen, um reproduktive Rechte umfassend zu gewährleisten und abzusichern.
„Es besteht seit Jahren ein breiter gesellschaftlicher und fachlicher Konsens über die Notwendigkeit einer Neuregelung. Der Bundestag muss diese Chance jetzt nutzen, um einen Paradigmenwechsel einzuleiten und das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung endlich ernst zu nehmen,“ so Céline Feldmann, Vorsitzende der interkommissionellen Arbeitsgruppe Schwangerschaftsabbruch im djb.
Der djb appelliert an alle demokratischen Abgeordneten, die Umsetzung des Entwurfs zu unterstützen und den Weg für eine gerechte und längst überfällige Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs zu ebnen.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e. V. vom 10.02.2025
DKHW zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit: Bekämpfung von Kinderarmut in Deutschland endlich zur Chefsache machen
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit Bund, Länder und Kommunen auf, die Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland endlich zu priorisieren. Nach dem Scheitern der Kindergrundsicherung sieht die Kinderrechtsorganisation vor allem das Spitzenpersonal der nächsten Bundesregierung in der Verantwortung. Kein Kind zurücklassen bedeutet in diesem Zusammenhang, allen Kindern ein gutes und gesundes Aufwachsen sowie gleichwertige Lebensverhältnisse unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer sozialen Herkunft zu ermöglichen. Dies kann aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes nur durch das Zusammenspiel einer eigenständigen finanziellen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit einer gleichzeitigen Absicherung ihrer Bildungs- und Teilhabebedarfe durch ein chancengerechtes, leicht zugängliches und armutspräventives Angebot in ihrem Lebensumfeld gelingen.
„Alle Kinder und Jugendlichen haben gemäß Artikel 26 und 27 der UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf ein gutes Aufwachsen, bestmögliche Entwicklungschancen und soziale Sicherheit. Das Leben armutsbetroffener Kinder zeichnet sich demgegenüber von Beginn an durch finanzielle Engpässe, schlechtere Wohnverhältnisse, ungesündere Ernährung und Verzicht aus. In allen Bereichen können von Armut betroffene Kinder und Jugendliche ihre Potentiale nicht ausschöpfen – und das seit Jahren, mit dramatischen Konsequenzen für sie selbst aber auch unsere Gesellschaft insgesamt.
Zugleich sehen wir mit großer Sorge, dass die Mittel für die präventive
Kinder- und Jugendhilfe immer weiter gekürzt werden und Kürzungen im sozialen Bereich oben auf der politischen Agenda stehen. Davor darf die kommende Bundesregierung nicht weiter die Augen verschließen, wir brauchen endlich konsequente, tragfähige Lösungen als Hilfe für die betroffenen Kinder“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.
„Armutsbetroffene Kinder und Jugendliche leben viel häufiger in Stadtteilen, in denen es an Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen sowie gut ausgestatteten Schulen mangelt. Die erlebte und objektive Chancenungleichheit erschwert es betroffenen Kindern und Jugendlichen, einen guten Schulabschluss zu erwerben, da dieser wesentlich mit dem Einkommen und dem Abschluss der Eltern zusammenhängt. Ein schlechter oder gar kein Schulabschluss erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, selbst im Erwachsenenalter in Armut zu leben. Hier müssen also dicke Bretter gebohrt werden, um endlich Abhilfe zu schaffen“, so Hofmann weiter.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert deshalb die nächste Bundesregierung auf, konkrete Maßnahmen zur Reduktion der Kinderarmut vorzunehmen. So sollten der Kinderzuschlag und die Leistungen der Grundsicherung auf Basis eines neu berechneten kindlichen Existenzminimums, das sich zukünftig an der Mitte statt am unteren Fünftel der Gesellschaft orientieren sollte, erhöht werden. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) müssen in diesem Kontext ebenfalls erhöht werden. Zudem bedarf es einer flächendeckenden Kampagne, damit anspruchsberechtigte Familien endlich wissen, was ihnen zusteht. Trotz des Scheiterns der Kindergrundsicherung, die aus der Holschuld der Familien eine staatliche Bringschuld machen wollte, muss die nächste Bundesregierung dafür sorgen, dass Ansprüche schnell und möglichst unbürokratisch geltend gemacht werden können. Als Mitglied des Bündnisses Kindergrundsicherung fordert das Deutsche Kinderhilfswerk weiterhin, am Ziel der Kindergrundsicherung festzuhalten.
Zudem muss der kindzentrierte Blick auf Armutsprävention und -bekämpfung gestärkt werden. Voraussetzung hierfür ist die ressortübergreifende Zusammenarbeit aller Ebenen vom Bund über die Länder bis hin zu den Kommunen. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert dementsprechend eine Gesamtstrategie, die monetäre Leistungen und Infrastrukturmaßnahmen zusammendenkt sowie bestehende Leistungen und Unterstützungssysteme auf Wirksamkeit und Zugänglichkeit bzw. Inanspruchnahme überprüft. Der Bund hat hierbei eine koordinierende Aufgabe, die er endlich federführend wahrnehmen muss. Schließlich müssen Konzepte einer armutssensiblen Pädagogik in
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen verankert werden, um klassistischen Diskriminierungen und Ausschlüssen aufgrund sozioökonomischer Benachteiligungen entgegenzuwirken. Dabei steht die Frage an vorderster Stelle, wie von Armut betroffene Kinder von Beginn an beteiligt und wie Stigmatisierungen und Vorannahmen wirksam bekämpft werden können. Konzepte einer armutssensiblen Praxis zielen hier sowohl auf die Reflektionsfähigkeiten des pädagogischen Personals als auch auf eine Sensibilisierung der Kinder für diese Themen. Konzepte zum Umgang mit Armut in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sollten dabei in den Ausbildungscurricula fest verankert werden.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. vom 20.02.2025
DKHW, Kinderschutzbund, UNICEF und Deutsche Liga für das Kind: Aktionsbündnis fordert: Kinderrechte gehören endlich ins Grundgesetz!
Das Aktionsbündnis „Kinderrechte ins Grundgesetz“ plädiert im Vorfeld der Bundestagwahl noch einmal nachdrücklich für die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Mit einer solchen verfassungsrechtlichen Verankerung der Kinderrechte im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention besteht die große Chance, dass Kinderrechte stärker als bisher zu einem Kompass für politisches Handeln werden. Langfristig wird damit eine tragfähige Grundlage für ein kinder- und familienfreundlicheres Land geschaffen. Kinder in Deutschland können so besser geschützt sowie Staat und Gesellschaft stärker in die Verantwortung für das Kindeswohl genommen werden. Gerade in Krisenzeiten wird deutlich, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen ansonsten nicht ausreichend Berücksichtigung finden. Kinderrechte im Grundgesetz stärken die Rechte der Eltern zum Wohle ihrer Kinder und die Interessen von Familien in unserer alternden Gesellschaft. Die Beteiligung der jungen Generation stärkt unsere Demokratie.
Das Aktionsbündnis „Kinderrechte ins Grundgesetz“ weiß mit seiner Forderung eine große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland hinter sich. In einer vor kurzem veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage für das Deutsche Kinderhilfswerk hatten 73 Prozent der Befragten die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz als wichtige Aufgabe für die nächste Bundesregierung gesehen.
Prof. Dr. Sabine Andresen, Präsidentin des Kinderschutzbundes:
„Kinder haben Rechte – und die müssen endlich im Grundgesetz verankert werden. Wir rufen alle Parteien dazu auf, sich im Bundestagswahlkampf klar für die Aufnahme der Kinderrechte einzusetzen. Nur so stellen wir sicher, dass das Wohl von Kindern bei politischen Entscheidungen wirklich im Mittelpunkt steht und sie den Schutz und die Förderung bekommen, die sie brauchen.“
Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes:
„Die Interessen der Kinder und Jugendlichen dürfen auch im Hinblick auf eine zukunftsfähige Gesellschaft nicht außer Acht gelassen werden. Deshalb braucht es im Grundgesetz einen eigenen Artikel für die Kinderrechte, die unabhängig von den Elternrechten und ohne mit ihnen in Konflikt zu geraten gegenüber dem Staat gelten. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Kinderrecht auf Beteiligung zu. Die Beteiligung von Kindern ist ein zentraler Wert einer demokratischen Gesellschaft. Das muss auch im Grundgesetz klar zum Ausdruck kommen.“
Georg Graf Waldersee, Vorsitzender UNICEF Deutschland:
„Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist ein wichtiger Baustein für eine zukunftsorientierte Politik. Damit würde die Mitsprache von Kindern und Jugendlichen gewährleistet und ihre Anliegen in politischen Entscheidungen gehört. Investitionen in ihr Recht auf Schutz, Bildung und Gesundheit sind zugleich Investitionen in die Stabilität und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.“
Sabine Walper, Präsidentin der Deutschen Liga für das Kind:
„Noch immer leben zu viele Kinder in Deutschland in Armut und zu viele müssen Diskriminierung, Gewalt oder Vernachlässigung erleiden. Nach wie vor hängen die Bildungschancen eines Kindes und ein gesundes Aufwachsen zu stark von seiner sozialen Herkunft ab. Die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz wären ein wichtiger Schritt, um die Folgen sozialer Ungleichheiten endlich abzubauen, denn jedes Kind hat das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit und auf volle Entfaltung seiner Begabungen und Fähigkeiten, zuhause und in den Bildungseinrichtungen, und zwar von Anfang an.“
Seit 1994 setzt sich das Aktionsbündnis Kinderrechte (Deutsches Kinderhilfswerk, Der Kinderschutzbund, UNICEF Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Liga für das Kind) für die vollständige Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland und die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz ein. Der vom Aktionsbündnis Kinderrechte initiierte Appell „Kinderrechte ins Grundgesetz – aber richtig!“ wurde im Jahre 2021 von mehr als 100 Organisationen aus der Kinder- und Jugendhilfe, Medizin, Pädagogik und anderen Bereichen unterstützt.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Der Kinderschutzbund Bundesverband, UNICEF Deutschland und Deutsche Liga für das Kind vom 13.02.2025
DKHW und UNICEF: Motto zum Weltkindertag 2025: Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!
Der Weltkindertag am 20. September 2025 steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“. UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk unterstreichen damit, wie wichtig die Umsetzung der Kinderrechte für unser aller Zukunft und als Fundament der Demokratie ist. Kinder und Jugendliche, die ihre Rechte kennen und leben, verstehen besser, wie Demokratie funktioniert und wie sie sich aktiv einbringen können. Die beiden Kinderrechtsorganisationen fordern im Wahljahr 2025 dazu auf, die Rechte der jungen Generation stärker als bisher bei politischen Entscheidungen miteinzubeziehen – für ein zukunftsfähiges und kinderfreundlicheres Land.
„Das Motto des Weltkindertages 2025 unterstreicht die fundamentale Bedeutung der Kinderrechte für unser Zusammenleben“, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. „Um unsere 14,3 Millionen Demokratinnen und Demokraten von Morgen zu stärken, braucht es eine Politik, die Kinder, ihre Chancen und die Verwirklichung ihrer Rechte gezielt fördert. Mit umfassenden Investitionen in Bildung, der Förderung benachteiligter junger Menschen vom Kita-Alter an und der Beteiligung der jungen Generation an politischen Entscheidungen können wir die Zukunftsfähigkeit des Landes vorantreiben und zugleich unsere demokratische Gesellschaft stärken.”
„Es braucht dringend konsequente politische Initiativen und Entscheidungen für eine Politik, die alle Generationen in den Blick nimmt. Denn bisher werden die Belange der Kinder und Jugendlichen in Deutschland an zu vielen Stellen systematisch ausgeblendet. Wir sehen tagtäglich, dass unsere Demokratie an vielen Stellen herausgefordert wird wie lange nicht. Deshalb ist es dringend angezeigt, unsere Demokratie zusammen mit der jungen Generation mit Leben zu füllen, ihre Voraussetzungen zu bewahren und sie offensiv gegen Bedrohungen zu verteidigen. Dafür braucht es auch die konsequente Umsetzung der Kinderrechte in allen Bereichen unserer Gesellschaft“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.
Zum Weltkindertag am 20. September 2025 ist eine gemeinsame bundesweite Mitmach-Aktion von UNICEF Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk geplant. Dabei werden die Kinderrechte als Bausteine für Demokratie im Fokus stehen. Hinzu kommen zahlreiche Initiativen mit lokalen Demonstrationen, Aktionen, Festen und anderen Veranstaltungen. Dabei werden sich Menschen aus ganz Deutschland für Kinder, deren Rechte und Bedürfnisse stark machen. Alle Informationen zum Weltkindertag gibt es unter http://www.unicef.de/weltkindertag und http://www.dkhw.de/weltkindertag.
Im September 1954 empfahlen die Vereinten Nationen ihren Mitgliedstaaten die Einführung eines weltweiten Tages für Kinder. Sie wollten damit den Einsatz für Kinderrechte stärken, die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen auf der Welt fördern und die Regierungen auffordern, die weltweite UNICEF-Arbeit zu unterstützen. Inzwischen wird der Weltkindertag in über 145 Staaten gefeiert; seit 1989 sind die Kinderrechte mit einer UN-Konvention für jedes Kind verbrieft.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. und UNICEF vom 12.02.2025
DKSB: Smartphones und Kinder: Bildung und Begleitung vor Verboten und Kontrolle
Anlässlich des morgigen Safer Internet Day veröffentlicht der Kinderschutzbund ein neues Haltungspapier zur Nutzung von Smartphones bei Kindern und Jugendlichen. Der Verband empfiehlt, dass Kinder frühestens ab einem Alter von zehn Jahren ein eigenes Smartphone erhalten sollten. Entscheidend dabei sei jedoch die individuelle Entwicklung des Kindes sowie das Kindeswohl.
„Ein Smartphone bedeutet für Kinder nicht nur neue Möglichkeiten der Teilhabe, sondern auch Risiken. Deshalb müssen Eltern ihre Kinder aktiv begleiten und Jugendschutzeinstellungen konsequent nutzen“, betont Joachim Türk, Vizepräsident des Kinderschutzbundes.
Laut aktuellen Studien haben bereits viele Kinder im Grundschulalter Zugang zu Smartphones – sei es über Familiengeräte oder eigene Endgeräte. Der Kinderschutzbund warnt jedoch davor, Kinder zu früh allein mit der digitalen Welt zu lassen. Neben der elterlichen Begleitung sind Schutzmaßnahmen wie Filtereinstellungen und altersgerechte Inhalte essenziell.
Empfehlungen des Kinderschutzbundes
- Bis zum dritten Lebensjahr möglichst bildschirmfrei aufwachsen.
• Vor der Grundschule kein eigenes Smartphone.
• Erst ab zehn Jahren ein eigenes Smartphone – mit aktiver elterlicher Begleitung und Jugendschutzeinstellungen.
• Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Eltern.
„Ein generelles Smartphone-Verbot für Kinder halten wir nicht für zielführend. Vielmehr muss die Medienkompetenz in Familien, Kitas und Schulen gestärkt werden, damit Kinder sicher und selbstbestimmt digitale Angebote nutzen können“, so Türk weiter.
Der Kinderschutzbund fordert zudem eine stärkere Verantwortung der Anbieter: Plattformbetreiber, Gerätehersteller und die Werbewirtschaft müssten mehr für den Schutz von Kindern tun. „Kinderschutz muss von Anfang an mitgedacht werden – durch sichere Voreinstellungen und klare Altersgrenzen“, erklärt Türk.
Das vollständige Haltungspapier ist ab sofort unter Kinderschutzbund.de verfügbar.
Quelle: Pressemitteilung Der Kinderschutzbund Bundesverband e.V. vom 11.02.2025
ver.di: Schluss mit Verzögerungen: ver.di fordert Schwangerschaftsabbrüche noch vor der Bundestagswahl zu legalisieren
Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland noch immer eine Straftat. Frauen, die abtreiben, werden hier daher immer noch kriminalisiert – und das seit mehr als 150 Jahren! Das muss sich ändern, fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zusammen mit mehr als 70 Organisationen und Verbänden, die am kommenden Montag (10. Februar 2025) an einer Verbändeanhörung des Deutschen Bundestages mitwirken. Dort wird ein interfraktioneller Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen beraten, der von 328 Abgeordneten unterzeichnet wurde. Eigentlich hätte der Entwurf längst im Plenum des Bundestages beraten werden sollen, aber Union und FDP blockieren das Gesetzverfahren.
Dazu sagt der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke: „Wir erwarten, dass Union und FDP den Wunsch einer mit 80 Prozent Zustimmung großen Mehrheit der Bevölkerung für straffreie Schwangerschaftsabbrüche nicht weiter blockieren und fordern sie auf, den Gesetzesentwurf der 328 Abgeordneten direkt nach der Verbändeanhörung an den Rechtsauschuss und noch in dieser Woche ins Plenum zur Gesetzesverabschiedung zu überweisen. Deutschland hat eins der restriktivsten Abtreibungsgesetze in Europa. Das ist nicht zeitgemäß und muss geändert werden.“
Silke Zimmer, im ver.di-Bundesvorstand zuständig für Frauen‐ und Gleichstellungspolitik, ergänzt: „Partei- und Wahltaktik dürfen den Weg zu einer überfälligen Neuregelung nicht blockieren. Die Politik muss endlich handeln und die Bevormundung von Frauen beenden. Die jetzige Gesetzesinitiative ist ein guter erster Schritt. Schwangerschaftsabbrüche müssen endlich entkriminalisiert werden.“
ver.di fordert neben der Streichung des Paragraphen 218 den Ausbau freiwilliger Beratungsangebote zu Schwangerschaftsabbrüchen, die Aufnahme von Schwangerschaftsabbrüchen als festen Bestandteil der medizinischen Ausbildung im Bereich Gynäkologie sowie die Verpflichtung staatlicher Krankenhäuser, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Denn dadurch, dass immer weniger Ärztinnen und Ärzte wegen der Stigmatisierung Schwangerschaftsabbrüche durchführen, müssten ungewollt Schwangere lange Wege und hohe Kosten auf sich nehmen, wenn sie ihr Recht auf Gesundheitsversorgung wahrnehmen wollten. Dies müsste ein modernes Gesetz für die Zukunft anders und zu Gunsten der Betroffenen regeln.
Quelle: Pressemitteilung ver.di-Bundesvorstand vom 07.02.2025
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
Fachtagung zum „Recht auf Nahrung“
Termin: 21. Februar 2025
Veranstalter: Diakonie Deutschland Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Ort: Online
Ernährungsarmut ist ein wachsendes gesellschaftliches Problem mit gravierenden Auswirkungen auf Gesundheit, soziale Teilhabe und Chancengleichheit. Jüngst schockierte eine repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag von Save The Children unter Eltern minderjähriger Kinder. Fast ein Viertel (23 Prozent) der Eltern mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 3.000 Euro sagten, sie würden häufig bei gesundem Essen sparen.
Am 21. Februar organisiert der Ernährungsrat Berlin in Kooperation mit der Nationale Armutskonferenz (NAK), der Diakonie Deutschland und dem Deutsche Institut für Menschenrechte eine Fachtagung unter dem Titel Ernährungsarmut überwinden, das Recht auf Nahrung stärken – für eine gerechte und nachhaltige Ernährungspolitik, die alle erreicht! Die Tagung selbst ist bereits ausgebucht, aber wir empfehlen euch den Live-Stream mit den Auftaktreden, von 10:30 bis ca. 12:00, u.a. mit:
Michael Windfuhr (Stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte)
Heike Towae (Armutsaktivistin)
Ulrike Arens-Azevêdo (Ökotrophologin und ehemalige Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.)
Material zur Konferenz kann auch nach der Veranstaltung noch im Netz aufgerufen werden.
Der Live-Stream kann auch über www.nationale-armutskonferenz.de aufgerufen werden.
Statistisches Bundesamt: Dashboard Integration: Aktuelle Daten zum Integrationsgeschehen auf einen Blick
Termin: 05. März 2025
Veranstalter: Statistisches Bundesamt
Ort: Berlin
Das Statistische Bundesamt lädt Sie herzlich zum Fachgespräch ein, das wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) durchführen:
Im Jahr 2023 lebten in Deutschland 16,2 Millionen Eingewanderte und 5 Millionen Nachkommen, bei denen beide Elternteile eingewandert sind: Für ein gutes Viertel der Bevölkerung gehört damit ihre Einwanderungsgeschichte zur Lebenswirklichkeit. Die Integration eingewanderter Menschen und ihrer Nachkommen betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche und ist Grundvoraussetzung für Teilhabe und Zusammenhalt.
Mit dem Dashboard Integration bietet das Statistische Bundesamt einen umfassenden Überblick zu den statistischen Trends des Integrationsgeschehens in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Dashboard Integration wurde in
Kooperation mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, als neuer eigenständiger Bereich des Dashboards Deutschland entwickelt und
aufgebaut. Damit wird der Integrationsbericht 2024 der Beauftragten erstmals um das Dashboard Integration ergänzt, das einen einfachen und interaktiven Zugang zu den im Bericht dargestellten Indikatoren und Daten bietet.
Interaktive Grafiken zu 60 Indikatoren in 14 Themenfeldern geben Antworten auf Fragen dazu, wie häufig und in welcher Form eingewanderte Menschen am Arbeitsmarkt aktiv sind, welche schulischen Kompetenzen und Bildungsabschlüsse sie aufweisen, wie sie ihren Gesundheitszustand einschätzen, wie zugehörig sie sich zu Deutschland und wie sicher sie sich in ihrem Wohnumfeld fühlen. Das Dashboard enthält dabei neben Ergebnissen der amtlichen Statistik
auch Daten von Behörden und der wissenschaftlichen Forschung. Die dargestellten Indikatoren wurden für den 14. Integrationsbericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) entwickelt.
In der Veranstaltung zeigen wir, wie Sie das Dashboard zur Informationssuche nutzen können. Wir stellen dabei die wichtigsten Trends des Integrationsgeschehens in ausgewählten Themenfeldern vor.
Im Anschluss gibt es bei einem kleinen Snack und Getränken die Möglichkeit zum fachlichen Austausch.
Weitere Informationen » www.destatis.de/hauptstadt
Anmeldungen per Mail » hauptstadt-events@destatis.de
Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, ob Sie online oder in Präsenz teilnehmen möchten.
TUSCH Festival
Termin: 18. bis 21. März 2025
Veranstalter: TUSCH und TUSCH Koproduktion
Ort: Berlin
Vom 18. bis 21. März 2025 findet wieder das TUSCH Festival im Podewil in Berlin-Mitte statt. Rund 400 junge Menschen verschiedener Schulformen beschäftigen sich in 16 Theaterproduktionen mit kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Hintergründen:
Erwachsen-Werden und das Überwinden von Angst, mit Schubladen, Hierarchien, Gefühlen u. v. m. Wichtiges Merkmal des TUSCH Festivals ist, dass immer zwei Kooperationen in einem Programmblock aufführen. So spielt eine Gruppe von Schüler*innen während die andere zuguckt und anschließend spielt die andere Gruppe, während die eine zuguckt. So können die Schüler*innen nicht nur Theater Spielen selbst erleben, sondern schauen auch Theater von Schüler*innen für Schüler*innen.
In einem anschließenden, spielerisch gestalteten Nachgespräch tauschen sich die jungen Spieler*innen über das Gesehene aus und stellen sich Fragen zur Stückentwicklung und der Präsentation.
Das Programm und weitere Informationen unter: www.tusch-berlin.de

