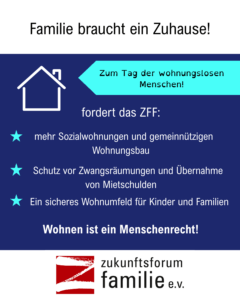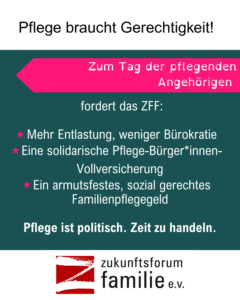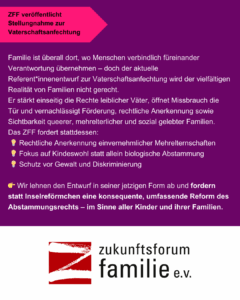AUS DEM ZFF
ZFF: Stellungnahme Vaterschaftsanfechtung und Stellungnahme Alleinerziehende
Stellungnahme Vaterschaftsanfechtung
Das BMJV hat dem ZFF den Referent*innenentwurf zur Umsetzung des BVerfG-Urteils zum Anfechtungsrecht leiblicher Väter übersandt und um Stellungnahme gebeten. Wir bedanken uns für die Möglichkeit und nehmen hierzu Stellung:
Familie ist überall dort, wo Menschen verbindlich füreinander Verantwortung übernehmen – doch der aktuelle Referent*innenentwurf zur Vaterschaftsanfechtung wird der vielfältigen Realität von Familien nicht gerecht. Er stärkt einseitig die Rechte leiblicher Väter, öffnet Missbrauch die Tür und vernachlässigt Förderung, rechtliche Anerkennung sowie Sichtbarkeit queerer, mehrelterlicher und sozial gelebter Familien. Wir lehnen den Entwurf in seiner jetzigen Form ab und fordern statt Inselreförmchen eine konsequente, umfassende Reform des ihrer Familien.
Stellungnahme Alleinerziehende
Der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags hat dem Zukunftsforum Familie e. V. die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme zum Antrag des SSW „Situation Alleinerziehender und ihrer Kinder umfassend und nachhaltig verbessern“ abzugeben. Wir haben uns sehr über diese Gelegenheit gefreut und haben sie gerne wahrgenommen.
Über 80 % der Alleinerziehenden in Trennungsfamilien sind Frauen. Sie und ihre Kinder sind im Vergleich zu anderen Familienformen deutlich häufiger von Armut betroffen. Zwar sind rund 71 % der Alleinerziehenden erwerbstätig – viele davon in Vollzeit oder vollzeitnaher Teilzeit –, doch reicht ihr Einkommen oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu sichern. Das ZFF begrüßt daher den umfangreichen Antrag der SSW Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag und die darin geforderten Maßnahmen für eine bessere Unterstützung und Anerkennung von Alleinerziehende auf Landes- und Bundesebene.
FES-Publikation und Veranstaltung zur Arbeitszeitdebatte | Wir erwarten mehr: Zeit für eine entschlossene Gleichstellungspolitik!
Die Debatte um Arbeitszeit ist in vollem Gange – und sie wird kontrovers geführt. Geplante Reformen versprechen mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch Fakt ist: Deutschland hat ein strukturelles zeitpolitisches Gleichstellungsproblem.
Erwerbstätige Frauen leisten 8 Stunden mehr unbezahlte Sorgearbeit pro Woche als Männer. Gleichzeitig arbeiten sie 7 Stunden weniger in bezahlter Erwerbsarbeit.
Das Impulspapier „Wir erwarten mehr: Zeit für eine entschlossene Gleichstellungspolitik!“ zeigt: Ein direkter Zusammenhang zwischen längerer Arbeitszeit und mehr Wohlstand ist nicht belegt – im Gegenteil. Überlange Arbeitszeiten gefährden Produktivität und Gesundheit. Was als Maßnahme zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf gedacht ist, kann das Gegenteil bewirken.
Was es stattdessen braucht, ist eine entschlossene Gleichstellungspolitik, die Geschlechterungleichheiten wirksam bekämpft.
Das Papier ist ein Impuls des Netzwerks „Gerechte Zeiten“ der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ZFF ist Teil des Netzwerks.
Jetzt das Papier lesen und teilen: https://library.fes.de/pdf-files/a-p-b/22313.pdf
Jetzt anmelden: Digitales Mittagsgespräch zur Arbeitszeitdebatte
Diskutieren Sie das Papier, die zentralen Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen mit den Autorinnen sowie der Journalistin und Autorin Teresa Bücker und Bettina Kohlrausch, Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung – kompakt in der Mittagspause am 9. Oktober von 12.30-13.15 Uhr via Zoom.
Zur Anmeldung: https://www.fes.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetail/285607/anmelden
AWO BV Hannover: Alleinerziehend, Alleingelassen? Wenn Elternschaft zum Armutsrisiko wird.
Nikola Schopp, Referentin im ZFF, wird an diesem Tag in Hannover mit dabei sein und mutig, unbequem und laut mitdiskutieren.

Podcast zum Thema Familienvielfalt & politische Sichtbarkeit
Zum Reinhören: Sophie Schwab, Geschäftsführerin des ZFF, spricht im Podcast „Nicht vorgesehen – Wenn Familien durchs Raster fallen“ über vielfältige Familienformen und Familienarmut und wie sie das ZFF als Lobbyverband auf Bundesebene für mehr Sichtbar aller Familien einsetzt.
Nicht vorgesehen – Wenn Familien durchs Raster fallen – PAblish
SCHWERPUNKT I: Tag der wohnungslosen Menschen
Bündnis 90/Die Grünen: Wohnen ist ein Menschenrecht – Nationalen Aktionsplan-Wohnungslosigkeit konsequent umsetzen
Anlässlich des Tages der wohnungslosen Menschen am 11.09.2025 erklärt Sylvia Rietenberg, Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen:
„Die letzte Bundesregierung hat unter bündnisgrüner Beteiligung mit dem Nationalen Aktionsplan Wohnungslosigkeit 2024 den richtigen und dringend notwendigen Weg eingeschlagen. Er eröffnete die Chance, dem Ziel näherzukommen, Wohnungslosigkeit in Deutschland bis 2030 zu überwinden. Diese Gelegenheit darf die aktuelle Bundesregierung nicht ungenutzt verstreichen lassen. Dafür braucht es verbindliche Maßnahmen, die konsequente Einbindung der Betroffenen und den Mut, ressortübergreifend und föderal zusammenzuwirken.
Die Bundesregierung muss gemeinsam mit den Ländern Wege finden, die Finanzierung der Kosten der Wohnungsgewinnung abzusichern. Ebenso wichtig ist der Aufbau eines echten Best-Practice-Austauschs – gezielt für die Verwaltungen in den Kommunen. Nur so können erfolgreiche Ansätze – von wirksamer Prävention bis hin zu Housing-First-Projekten – bundesweit verbreitet und dauerhaft verankert werden. Schwarz-Rot sollte die Zuschüsse des Bundes für die wichtige Arbeit insb. der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe und des Housing First Bundesverbandes im Bundeshaushalt verstetigen. Der aktuelle Entwurf für den Bundeshaushalt 2026 sieht an dieser Stelle jedoch eine empfindliche Absenkung um insgesamt 750 000 € vor.“
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 10.09.2025
AWO: Wohnungslosigkeit sichtbar machen – für ein solidarisches Miteinander
Zum morgigen Tag der wohnungslosen Menschen macht der AWO Bundesverband auf die wachsende soziale Notlage vieler Menschen in Deutschland aufmerksam. Dazu erklärt Michael Groß, Präsident der Arbeiterwohlfahrt:
„Bezahlbares Wohnen ist ein Grundrecht. Wohnungslose Menschen zu übersehen und ihnen gesellschaftliche Teilhabe vorzuenthalten, ist nicht akzeptabel. Sie haben Anspruch auf Schutz, Würde und gesellschaftliche Solidarität. Wir rufen Politik, Zivilgesellschaft und jeden einzelnen Menschen dazu auf, gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft einzustehen, in der niemand ohne Dach über dem Kopf leben muss. Wohnungslosigkeit ist kein individuelles Versagen, sondern Ausdruck struktureller Probleme: fehlender bezahlbarer Wohnraum, unzureichende soziale Sicherungssysteme, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und mangelnde Prävention. Besonders betroffen sind junge Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte und Alleinerziehende.“
Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren zum Stichtag 31. Januar 2025 rund 474.700 Menschen aufgrund von Wohnungslosigkeit in Unterkünften untergebracht – ein Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr.
Diese Zahl bildet jedoch nur einen Teil der Realität ab: Menschen in verdeckter Wohnungslosigkeit – etwa jene, die bei Freund*innen, Bekannten oder in prekären Wohnverhältnissen leben – werden nur alle zwei Jahre erfasst. Die nächste umfassende Erhebung ist erst für 2026 geplant.
Wohnungslosigkeit ist eine direkte Folge von Armut. Wer von Armut betroffen ist, hat kaum Chancen auf dem angespannten Wohnungsmarkt, ist häufiger krank, sozial isoliert und in vielen Lebensbereichen benachteiligt. Besonders betroffen sind Menschen mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, junge Erwachsene und Menschen mit Migrationsgeschichte.
„Besonders alarmierend ist die zunehmende Gewalt gegen obdachlose Menschen. Immer wieder werden sie Opfer von Übergriffen – verbal, strukturell und körperlich“, so Groß weiter, „Diese Gewalt ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas, das von Ausgrenzung, Gleichgültigkeit und wachsender sozialer Kälte geprägt ist. Die politische Fixierung auf Sparen um jeden Preis befeuert ein solches Klima noch.“
Die AWO fordert deshalb:
- mehr bezahlbaren Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen
- gemeinnütziges und genossenschaftliches Wohnen stärken
- stärkere Präventionsmaßnahmen, um Wohnungsverlust frühzeitig zu verhindern
- Schutz vor Gewalt und diskriminierungsfreie Zugänge zu Hilfesystemen
- gesellschaftliche Teilhabe statt Ausgrenzung – durch niedrigschwellige Angebote, Beratung und Unterstützung
- ein sozial gerechtes Mietrecht, das Mieter*innen besser vor Kündigung, Verdrängung und Mietwucher schützt
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 10.09.2025
BAG W: Wohnungsnot als strukturelle Krise nur politisch lösbar! BAG Wohnungslosenhilfe im Gespräch mit Politik anlässlich des Tages der wohnungslosen Menschen
Unter dem Motto „Politik in die Pflicht nehmen – Wohnungsnot beenden“ ruft die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) die Einrichtungen und Dienste der Wohnungsnotfallhilfe dazu auf, von den politischen Entscheidungsträger*innen entschlossene Maßnahmen gegen die wachsende Wohnungsnot einzufordern. Auch die BAG W sucht das Gespräch: Im Rahmen eines parlamentarischen Frühstücks im Deutschen Bundestag am 12. September 2025 geht sie mit der Politik in den Dialog.
Wohnen ist ein fundamentales Menschenrecht
Die Wohnungsnot ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Wohnen ist ein Menschenrecht, doch für über 600.000 Menschen in Deutschland bleibt es unerfüllt. Mit ihrem Fünf-Punkte-Plan fordert die BAG W deshalb bedarfsgerechten sozialen Wohnraum, wirksame Instrumente wie Mietpreisbremse und Schonfristzahlung, eine klare Strategie zur Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 2030, den Abbau von Stigmatisierung sowie präventive Hilfen und menschenwürdige Unterbringung.
„Wohnen ist ein Menschenrecht und kein Luxus. Wir brauchen endlich eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik, die für bezahlbaren Wohnraum sorgt und die Menschen schützt, die am stärksten unter der Krise leiden“, betont Susanne Hahmann, Vorsitzende der BAG W.
Parlamentarisches Frühstück im Bundestag am 12. September 2025
Auf Einladung von der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner (CSU) veranstaltet die BAG W ein parlamentarisches Frühstück zu den Themen Prävention und niedrigschwellige Zugänge im Bundestag.
Emmi Zeulner selbst betont: „Bedürfnisse wohnungsloser Menschen müssen in den Blick genommen werden. Der heutige Tag der wohnungslosen Menschen ist ein guter Anlass, darauf aufmerksam zu machen. Alle Menschen in Deutschland sollen ein sicheres Zuhause finden und ein selbstbestimmtes Leben führen können – daran wollen wir arbeiten. Entscheidend sind die Prävention sowie der Ausbau niedrigschwelliger Zugänge, um Menschen in prekären Lebenslagen frühzeitig zu erreichen, ihnen eine Perspektive zu bieten und sogar den Verlust der Wohnung zu vermeiden. Ich danke allen Fachkräften für ihren täglichen Einsatz für die Menschen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, und dabei einen wichtigen Beitrag leisten, dass diese wieder dort hinfinden können.“
Erfahrungsexpertin Astrid Thielo, Mitglied der Facharbeitsgemeinschaft Partizipation, bekräftigt: „Eine verantwortungsvolle, alle Menschen gleichermaßen fördernde und in ihren Grundrechten achtende Haltung in der Politik ist überfällig, damit das Leiden (ehemals) wohnungsloser Menschen ein Ende hat!“
Über 80 Einrichtungen und Dienste beteiligen sich mit Aktionen
Dem Aufruf der BAG W, sich aktiv in die politischen Debatten einzubringen, sind zahlreiche Einrichtungen und Dienste der Wohnungsnotfallhilfe gefolgt. Mit über 80 Aktionen wird bundesweit deutlich gemacht, dass Wohnungsnot nur durch entschlossenes politisches Handeln überwunden werden kann. Alle Veranstaltungen wie Lesungen, Fotoausstellungen und Flashmobs sind auf der Aktionslandkarte der BAG W zu finden.
„Wir brauchen eine Politik, die Menschen in Not unterstützt und ihnen echte Perspektiven auf ein sicheres Zuhause gibt. Die Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe leisten dabei täglich unverzichtbare Arbeit“, ergänzt Sabine Bösing, Geschäftsführerin der BAG W.
Quelle: Pressemitteilung BAG W – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V vom 11.09.2025
Diakonie: Bezahlbares Wohnen wichtiger als Bau-Turbo
Zum Tag der Wohnungslosen am 11. September fordert die Diakonie Deutschland von Bund, Ländern und Gemeinden, mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Statt vor allem auf einen beschleunigten Wohnungsbau zu setzen, müsse die Politik vorrangig dafür sorgen, dass Wohnen für alle bezahlbar ist.
Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: „Tempo allein löst die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht. Es fehlt nicht an hochpreisigen Luxuswohnungen, sondern an ausreichend sozialen und gemeinnützigen Wohnungen, die auch ökologische Standards erfüllen. Darauf muss die Politik ihren Fokus legen.“
Die bundesweite Wohnkrise spitzt sich weiter zu: Immer mehr Menschen haben keine eigene Wohnung – selbst, wenn sie arbeiten. Laut aktuellem Statistikbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) sind bereits 13 Prozent der Klient:innen der Wohnungsnotfallhilfe erwerbstätig, bei nicht-deutschen Klient:innen sogar 20 Prozent. Zudem sind viele Familien wohnungslos: Elf Prozent aller erfassten Personen leben mit mindestens einem Kind zusammen.
„Wer arbeitet, muss sich auch eine Wohnung leisten können. Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Insbesondere Kinder müssen vor Wohnungslosigkeit geschützt werden. Sie brauchen eine stabile Umgebung und ein sicheres Zuhause. Als Diakonie fordern wir, überall Fachstellen einzurichten, die Menschen beraten, wenn sie von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Das schützt Betroffene – und senkt die Kosten für die Kommunen deutlich“, so Elke Ronneberger. Eine von Teilen der Politik geforderte Pauschalierung der Unterkunftskosten lehnt die Diakonie Deutschland ab. Sie würde die Lage verschärfen, weil sie zu weiteren Wohnungsverlusten und damit auch zu höheren Unterbringungskosten führen würde.
Elke Ronneberger bei Aktionstag in Bremen
Anlässlich des Tags der Wohnungslosen besucht Elke Ronneberger am 11. September die Aktion „Gemeinsam zu Tisch“ der Diakonie in Bremen. Vor und in der Kirche „Unser Lieben Frauen“ wird sie ein öffentliches Mittagessen mit Menschen in prekären Lebenslagen besuchen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Aktionstages der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V statt: Aktionswebseite.
Weitere Informationen
- Wissen Kompakt: Wohnungs- und Obdachlosigkeit
- Blog: Die Deckelung der Unterkunftskosten von Bürgergeldempfänger*innen kostet mehr und hilft nicht
- Statistik-Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W): Erwerbstätige Personen und Familien immer häufiger von Wohnungsnot betroffen
Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Diakonie Deutschland vom 10.09.2025
DKSB: 137 000 Minderjährige in Deutschland wohnungslos
Zum Tag der Wohnungslosen macht der Kinderschutzbund auf die dramatische Situation wohnungsloser Kinder und Jugendlicher aufmerksam.
Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts lebten am 31. Januar 2025 insgesamt rund 130 000 Minderjährige in Notunterkünften. Weitere rund 6600 Kinder und Jugendliche lebten in sogenannter verdeckter Wohnungslosigkeit, also provisorisch bei Freunden, Bekannten oder Großeltern. 2000 Minderjährige leben vollständig auf der Straße. Fast jeder Dritte von Wohnungslosigkeit betroffene Mensch ist unter 18 Jahre alt.
„Kinder brauchen ein Zuhause, um gesund aufzuwachsen, Freundschaften zu pflegen und in der Schule anzukommen. Ein Leben in Notunterkünften bedeutet Unsicherheit, Stigmatisierung und fehlende Teilhabe. Und es hat Auswirkungen auf das gesamte Leben: Angefangen bei guter Gesundheit, ausreichend Schlaf und Rückzugsmöglichkeiten. Wir dürfen nicht länger hinnehmen, dass so viele Kinder und Jugendliche ohne feste Wohnung aufwachsen“, erklärt Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes.
Kinderschutzbund: Gerechtes Wohnen für Kinder und Familien
In einem aktuellen Positionspapier fordert der Kinderschutzbund konkrete Maßnahmen für bezahlbaren, inklusiven und kinderfreundlichen Wohnraum:
- Engagement für bezahlbaren Wohnraum: Mehr sozialer Wohnungsbau, Mietpreisregulierung, Leerstandsmanagement und Förderung alternativer Wohnformen.
- Unterstützung von Careleavern: Junge Menschen, die aus der Jugendhilfe kommen, brauchen spezielle Hilfen beim Zugang zu Wohnraum.
- Wohnraum für junge Menschen: Ausbildungs- und Studierendenwohnheime müssen ausgebaut werden, damit Jugendliche den Schritt in die Selbstständigkeit schaffen.
- Mehrgenerationenwohnen fördern: Gemeinschaftliche Wohnprojekte stärken Zusammenhalt und bieten stabile Lebensräume für Kinder und Familien.
- Öffentlichkeit sensibilisieren: Der Zusammenhang von Wohnkosten, Wohnungsnot und Armut muss stärker in Politik und Gesellschaft diskutiert werden.
„Die Zahlen zeigen deutlich: Kinder sind in erheblichem Maße betroffen – ihre Perspektive fehlt aber fast völlig in der öffentlichen Debatte. Das muss sich dringend ändern“, so Grein weiter.
Das vollständige Positionspapier kann hier heruntergeladen werden.
Quelle: Pressemitteilung Der Kinderschutzbund Bundesverband e.V. vom 11.09.2025
SCHWERPUNKT II: Neuregelung Vaterschaftsanfechtung
djb kritisiert Referentenentwurf zur Vaterschaftsanfechtung
Mit dem Referentenentwurf zur Vaterschaftsanfechtung verpasst das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) eine erneute Chance, das Abstammungsrecht grundlegend zu modernisieren. Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) kritisiert in seiner aktuellen Stellungnahme, dass der Entwurf die grundlegenden Probleme des Abstammungsrechts nicht beseitigt. „Mit dem aktuellen Referentenentwurf werden die bestehenden rechtlichen Unsicherheiten für Kinder und Familien verschärft“, so Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb.
Der djb kritisiert insbesondere, dass mit dem Referentenentwurf einseitig die Rechte von leiblichen Vätern gestärkt werden – zu Lasten der rechtlichen und sozialen Familie des Kindes. Eine umfassende Interessenabwägung, die auch die Perspektive des Kindes, der Mutter sowie des rechtlichen und sozialen Vaters einbezieht, findet nicht statt. Der djb ist insbesondere alarmiert, weil der Referentenentwurf nicht ausdrücklich klarstellt, dass Samenspender nicht vom personellen Schutzbereich des Elternrechts aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG umfasst sind und ihnen folglich auch kein Anfechtungsrecht zusteht. Auch bei der vom Bundesverfassungsgericht geforderten „zweiten Chance“ für den Anfechtungsberechtigten geht der Referenten-entwurf ohne Not und vor allem zu Lasten der Rechtssicherheit der betroffenen Kinder und ihrer rechtlichen Eltern zu weit und destabilisiert das grundlegende familienrechtliche Prinzip der Statussicherheit. Der djb sieht hier die Gefahr von zukünftigen „Kettenverfahren“, die die betroffenen Familien über Jahre belasten und dem Kindeswohl konkret schaden.
„Was wir brauchen, ist ein modernes und kohärentes Abstammungsrecht, das alle Familien-formen in den Blick nimmt“, betont Prof. Dr. Anna Lena Göttsche, Vorsitzende der djb-Kommission Familien-, Erb- und Zivilrecht. Der djb fordert den Gesetzgeber auf, die Reform nicht auf die sogenannte Sekundärebene zu beschränken, sondern endlich die überfällige Neuregelung der rechtlichen Eltern-Kind-Zuordnung auf der Primärebene anzugehen. Die familien-rechtliche Realität in Deutschland ist vielfältig – das Recht muss ihr endlich gerecht werden.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) vom 15.08.2025
eaf: Soziale Väter geraten bei Neuregelung der Vaterschaftsanfechtung ins Hintertreffen
eaf fordert Nachbesserungen an Referentenentwurf
Ein aktueller Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums sieht zum einen vor, dass Familiengerichte künftig im Einzelfall abwägen sollen, ob die rechtliche Vaterschaft beim sozialen Vater bleiben oder auf den biologischen Vater übergehen soll, wenn beide Anspruch darauf erheben und eine sozial-familiäre Beziehung zum Kind haben. Zum anderen sieht der Referentenentwurf vor, dass die Interessen des sozialen Vaters und dessen Beziehung zum Kind in zwei nicht seltenen Szenarien dabei völlig unzureichend berücksichtigt werden.
Die aktuelle Rechtslage schützt ausnahmslos die soziale Familie und die sozial-familiäre Beziehung des rechtlichen Vaters zum Kind. Mit der Neuerung bezüglich besserer Möglichkeiten für biologische Väter für Einzelfallentscheidungen setzt der Referentenentwurf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts um. Dies begrüßt die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) in ihrer Stellungnahme grundsätzlich, warnt aber im Interesse des Kindes davor, die Rolle des sozialen Vaters zu stark abzuwerten.
Der Schutz der Rolle der sozialen Väter soll laut Entwurf in zwei Fällen komplett entfallen: Ist das Kind noch nicht älter als 6 Monate, soll der biologische Vater durch die Anfechtung immer auch rechtlicher Vater des Kindes werden. Ist das Kind bereits volljährig und widerspricht der Vaterschaftsanfechtung nicht aktiv – aus Unwissenheit oder fehlender Priorität für diese Dinge in der Lebensphase als junge/r Erwachene/r – soll der biologische Vater ebenfalls immer den sozialen Vater als rechtlichen Vater verdrängen.
„Diese beiden Ausnahmen sehen wir sehr kritisch“, erläutert eaf-Präsident Prof. Dr. Martin Bujard. „Sie stärken die Rechte biologischer Väter in einem verfassungsrechtlich nicht erforderlichen Maße. Auch bei sehr jungen Kindern sollte bei zwei Vätern mit starkem Interesse an einer rechtlichen Vaterschaft eine Kindeswohlprüfung stattfinden, damit die Grundrechte und Interessen aller Beteiligten Berücksichtigung finden können, beispielsweise in Fällen mit Gewaltkontext. Und der Gesetzgeber würde das Kind vollends mit dem Bade ausschütten, wenn selbst volljährige Kinder, die lediglich einen Widerspruch verpeilen, über Nacht einen neuen rechtlichen Vater bekämen.“
Genau das aber sieht der aktuelle Entwurf vor. „Hier plädieren wir dafür, dass ohne die Zustimmung des Kindes keine Rechtsänderung eintritt“, betont Bujard. „Stellen Sie sich vor, Sie haben 18 Jahre lang für ein Kind gesorgt, ihm abends vorgelesen, Fahrradfahren beigebracht und mit ihm die Pubertät durchlitten; nur weil dieses Kind die Tragweite einer Vaterschaftsanfechtung nicht erkennt, soll es über Nacht nicht mehr mit Ihnen verwandt sein? Hier muss der Gesetzesentwurf dringend nachgebessert werden!“
Die rechtliche Verwandtschaft ist unter anderem die Grundlage für Unterhaltsansprüche und Erbrechte und beim minderjährigen Kind auch für das Sorgerecht, das alle wichtigen Entscheidungen für das Kind betrifft. Eine gute Begleitung und Beratung für alle Beteiligten hält die eaf deshalb in allen Abstammungssachen für außerordentlich wichtig.
„Eine gewisse Sicherheit und Verlässlichkeit ist für soziale Väter zentral, um ihre Rolle bei der Erziehung, der finanziellen Sicherung und der emotionalen Bindung zum Kind einzunehmen. Der Gesetzgeber riskiert mit der Neuregelung, dass Männer ihre aufwändige Rolle als sozialer Vater nicht annehmen, da sie Sorge haben, die rechtliche Vaterrolle für das Kind kann ihnen irgendwann leicht weggenommen werden“, warnt Bujard. „Für Kinder, die mit einem sozialen Vater aufwachsen, wäre dies von erheblichem Nachteil.“
Stellungnahme der eaf zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung vom 15. August 2025.
Quelle: Pressemitteilung evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) vom 20.08.2025
LSVD+: Keine weitere Biologisierung des Abstammungsrechts!
LSVD⁺ nimmt Stellung zur geplanten Reform der Vaterschaftsanfechtung
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat einen Entwurf zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung vorgelegt. Der LSVD⁺– Verband Queere Vielfalt hat mit Fokus auf queerpolitische Aspekte Stellung genommen. Dazu erklärt Patrick Dörr aus dem Bundesvorstand des LSVD⁺:
Der vorliegende Referentenentwurf sieht eine weitere biologistische Verschiebung des Abstammungsrechts vor, während eine kohärente Gesamtreform weiterhin fehlt. Die geplanten Änderungen gehen z.T. erheblich über die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinaus. Deutlich wird eine einseitige Privilegierung der Rechtsstellung des „leiblichen“ Vaters gegenüber den Interessen des Kindes, der rechtlichen Mutter und des rechtlichen Vaters. Damit wird die Bedeutung sozialer Elternschaft und die gelebte Realität vieler Familien verkannt. Insbesondere das geplante weite Anfechtungsrecht auch für private Samenspender bei gleichzeitigem Fehlen der Möglichkeit rechtsverbindlicher vorgeburtlicher Vereinbarungen birgt große Risiken für queere Familien. Die vom Bundesverfassungsgericht eingeräumte Möglichkeit der Einführung von Mehrelternschaften wurde nicht hinreichend geprüft.
Wir kritisieren, dass das Bundesverfassungsgericht vor Bearbeitung der „Nodoption“-Verfahren über das Anfechtungsrecht entschieden hat. Der Ausschluss von v.a. Zwei-Mütter-Familien wird in mittlerweile sieben Normenkontrollanträgen und einer Verfassungsbeschwerde als verfassungswidrig bewertet. Die Verfahren der „Nodoption“-Familien sind z.T. seit 2021 beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Noch immer hat das Gericht nicht über diese Fälle entschieden, mittlerweile sind sogar Verzögerungsrügen erfolgt.
Wir fordern nun von der Legislative, keine weitere biologistische Teillösung zu schaffen, sondern endlich ein verfassungskonformes Gesamtkonzept für die Reform des Abstammungsrecht vorzulegen, das sich maßgeblich am Kindeswohl orientiert.
Hier zur ausführlichen queerpolitischen Stellungnahme.
Weiterlesen:
- Weiteres Gericht hält das Abstammungsrecht für verfassungswidrig
- Regenbogenfamilien anerkennen
- Wollen CDU/CSU und SPD auch Verantwortung für LSBTIQ* übernehmen?
Quelle: Pressemitteilung LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 14.08.2025
NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT
BMBFSFJ: Bildung in Deutschland: OECD-Studie sieht Deutschland stark in MINT und Ausbildung, warnt aber vor sozialer Ungleichheit
OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick 2025“ erschienen
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat heute mit der Publikation „Education at a glance – Bildung auf einen Blick 2025“ einen umfassenden Vergleich der Bildungssysteme aller OECD-Staaten sowie weiterer Beitrittsländer und Partnerstaaten veröffentlicht. Die Ergebnisse aus dem Länderbericht für Deutschland stellte die OECD gemeinsam mit dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), und der Kultusministerkonferenz (KMK) in der Bundespressekonferenz vor.
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär: „Es ist wichtig und ermutigend, dass die OECD-Studie zeigt: Deutschland ist ein hochqualifiziertes MINT-Land. In keinem anderen Land der Welt macht ein höherer Anteil der Absolventinnen und Absolventen im Tertiärbereich einen Abschluss in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Deutschland ist also MINT-Weltmeister! Das ist der große Standortvorteil Deutschlands. Dieses Potenzial gilt es, weiter zu heben – mit der Weiterentwicklung des MINT-Aktionsplans, mit MissionMINT sowie durch eine große BAföG-Reform, die die Reichweite der Förderung ausbaut und die Leistungen verbessert. Wir werden das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren, für verlässlichere Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir setzen mit dem 1.000-Köpfe-Plus Programm ein Zeichen für Wissenschaftsfreiheit und bauen die Attraktivität des Standortes Deutschland weiter aus. Und wir brauchen eine rasche und kraftvolle Umsetzung der Hightech-Agenda Deutschland, die wir vor wenigen Wochen im Kabinett beschlossen haben. Unser Ziel: Deutschland soll wieder an die Weltspitze in Schlüsseltechnologien. Neue Technologien sollen zum Markenzeichen Deutschlands werden. Durch mehr Investitionen in Zukunftstechnologien, durch bessere Rahmenbedingungen, durch Anreize, schneller von der Forschung in die Anwendung zu kommen. Die Hightech Agenda Deutschland hilft, sichere Arbeitsplätze zu schaffen, Abhängigkeiten zu reduzieren und den Alltag der Menschen zu verbessern.“
Parlamentarische Staatssekretärin im BMBFSFJ Mareike Wulf:„Deutschland steht im internationalen Vergleich besonders gut da, wenn es um berufliche Bildung und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen geht. Doch die Studie zeigt auch: Wir haben noch zu viele geringqualifizierte Menschen und Defizite bei den Grundkompetenzen. Die vielen jungen Menschen ohne beruflichen Abschluss sind ein Risiko, sowohl für die ökonomische Leistungsfähigkeit unseres Landes als auch für den sozialen Zusammenhalt. Wir werden nachqualifizierende Wege zu einem Berufsabschluss ausbauen und bekannter machen – mit der Standardisierung und dem Ausbau von Teilqualifikationen. Wir werden die Übergänge von Schule in die Ausbildung weiter stärken und die berufliche Bildung insgesamt zukunftsfest gestalten. Zum Beispiel mit der geplanten Fortführung der Initiative Bildungsketten und mit dem Ausbau des Berufsorientierungsprogramms. Eine solide Ausbildung bleibt der Schlüssel für gute Perspektiven – beruflich und persönlich. Unser Ziel ist ein Bildungssystem, in dem Bund, Länder und Kommunen so gut zusammenarbeiten, dass das System faire Chancen bietet – von der Kita über die Schule bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter. Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, allen Menschen in Deutschland eine gute Perspektive als künftige Fachkraft zu schaffen! Das sollte unser gemeinsamer Anspruch sein.“
Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz Bettina Martin: „Die Ergebnisse der diesjährigen OECD-Studie zeigen, dass sich die Anstrengungen von Bund und Ländern der vergangenen Jahre gelohnt haben. Sie haben aber neben dem Licht auch noch einige Schatten. So ist es gelungen, den Anteil der jungen Erwachsenen mit einem Hochschul- oder Meisterabschluss (tertiär) von 33 auf 40 Prozent stark zu erhöhen. Das ist eine gute Entwicklung, denn wir brauchen zunehmend hochqualifizierte Fachkräfte in Deutschland – gerade auch im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich, wo der Anteil derer mit einem Abschluss in Fächern international am höchsten ausfällt. Auch sind die deutschen Hochschulen in den vergangenen zehn Jahren für ausländische Studierende immer attraktiver geworden. Ihre Anzahl hat sich mehr als verdoppelt. Diese positive Entwicklung werden wir Länder gemeinsam mit dem Bund mithilfe der Internationalisierungsstrategie der KMK weiter vorantreiben.
Damit der Hochschulstandort Deutschland auch zukünftig attraktiv bleibt, muss u.a. massiv in die Infrastruktur investiert werden. Ich begrüße daher sehr, dass die Bundesregierung eine Schnellbauinitiative im Hochschulbau angekündigt hat. Denn wir brauchen eine Infrastruktur, die auf dem neuesten Stand ist, vom Labor über den Hörsaal bis zur Mensa.“
Katharina Günther-Wünsch, Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, äußert sich als Vertreterin der Bildungsministerkonferenz: „Die OECD-Studie zeigt: Deutschland verfügt über starke Säulen – unsere duale Ausbildung eröffnet jungen Menschen Perspektiven, die frühkindliche Bildung erreicht immer mehr Kinder, und unsere Hochschulen ziehen internationale Talente an. Gleichzeitig macht der Bericht deutlich, wo wir handeln müssen: Chancengerechtigkeit stärken, Abschlüsse sichern und dem Lehrkräftemangel entschlossen begegnen, gerade in den MINT-Fächern. Noch immer verlassen zu viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss, und die Herkunft prägt den Bildungserfolg nach wie vor zu stark. Deshalb investieren die Länder gezielt in Sprachförderung, Ganztagsangebote und moderne Wege der Lehrkräftegewinnung. Zugleich bauen wir die berufliche Bildung weiter aus, damit sie auch künftig eine verlässliche Brücke in Beschäftigung und Studium schlägt. Unser Ziel ist klar: Ein starkes Bildungssystem, das Leistung fördert, Qualität sichert und die Fachkräfte hervorbringt, die Deutschland für seine Zukunft braucht.“
Zentrale Ergebnisse „Bildung auf einen Blick 2025“
Der jährlich erscheinende OECD-Bericht „Education at a Glance“ hat das Ziel, anhand von quantitativen Indikatoren einen Vergleich der Bildungssysteme von 38 OECD-Staaten sowie weiteren Beitrittsländern und Partnerstaaten zu ermöglichen. Schwerpunktthema des diesjährigen Berichts ist die tertiäre Bildung.
Deutschland zeigt im internationalen Vergleich starke Ergebnisse bei beruflicher Bildung und Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen. 59 Prozent der 18- bis 24-Jährigen befinden sich in Ausbildung oder Studium, deutlich mehr als der OECD-Durchschnitt von 53 Prozent. Nur 10 Prozent sind weder in Bildung noch Beschäftigung, deutlich weniger als der OECD-Wert von 14 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt mit 2,7 Prozent ebenfalls unter dem OECD-Durchschnitt.
Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil an MINT-Abschlüssen: 35 Prozent der Hochschulabsolventinnen und -absolventen schließen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik ab – ein Spitzenwert weltweit. Zudem investiert Deutschland mit rund 19.500 US-Dollar pro Studierendem mehr als der OECD-Durchschnitt in die Hochschulbildung.
In den letzten fünf Jahren gab es positive Entwicklungen: Die Erwerbsquote von 25- bis 34-Jährigen ohne Sekundarabschluss stieg von 59 auf 61 Prozent, der Anteil mit Bachelor-Abschluss von 21 auf 23 Prozent. Weiterbildungsmaßnahmen werden zunehmend genutzt, besonders von Erwachsenen mit mittlerem Bildungsabschluss und hoher IT-Nutzung (54 Prozent gegenüber 49 Prozent OECD-Durchschnitt). Diese Trends zeigen die Wirksamkeit bildungspolitischer Maßnahmen für lebenslanges Lernen.
Trotz der Fortschritte bleiben Herausforderungen: Die Nichterwerbsquote bei geringqualifizierten Erwachsenen ist weiterhin hoch, und nach wie vor bestehen soziale Ungleichheiten beim Zugang zu frühkindlicher Bildung.
Politische Maßnahmen
Die Kultusministerkonferenz und der Bund setzen auf gezielte Programme wie „Schule macht stark“ und das Startchancen-Programm, um besonders benachteiligte Schulen zu unterstützen. Gegen den Lehrkräftemangel, vor allem in MINT-Fächern, fördern die Länder Quereinsteiger, nutzen außerschulische Lernorte und stärken digitale Bildungsangebote.
Im Hochschulbereich engagieren sich Bund und Länder gemeinsam für mehr Chancengerechtigkeit und Qualität. Das „Professorinnenprogramm“ fördert Gleichstellung und den Anteil von Frauen in Spitzenpositionen. Zudem unterstützen Maßnahmen wie das Tenure-Track-Programm die bessere Vereinbarkeit von Wissenschaftskarrieren und Familie. Mit dem 1.000-Köpfe-Plus-Programm bauen wir die internationale Attraktivität des deutschen Wissenschaftsstandortes weiter aus.
Zur Ländernotiz Deutschland: https://www.oecd.org/de/publications/bildung-auf-einen-blick-2025_b1cc11a5-de/deutschland_9a449e27-de.html
Zur vollständigen Studie: https://www.oecd.org/de/publications/bildung-auf-einen-blick-2025_9783763979257.html
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 09.09.2025
BMBFSFJ: Weiterhin hoher Bedarf an Kindertagesbetreuung, trotz sinkender Geburtenzahlen
Bund investiert rund 3,8 Milliarden in den Ausbau der Angebote
Die Nachfrage nach Kindertagesbetreuung bleibt trotz rückläufiger Geburtenzahlen hoch. Das zeigen aktuelle Zahlen aus der heute veröffentlichten Broschüre „Kindertagesbetreuung Kompakt“. Der Anteil der Kinder in Kitas und Kindertagespflege steigt in allen Altersgruppen. Gleichzeitig bestehen weiterhin deutliche Lücken zwischen dem Betreuungsangebot und dem tatsächlichen Bedarf von Eltern.
Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien:
„Kitas geben Kindern frühe Bildungschancen und die Möglichkeit Gemeinschaft zu erleben – hier wird der Grundstein für den weiteren Erfolg in Schule und Beruf gelegt. Fast jedes Kind zwischen drei Jahren und Schuleintritt besucht eine Kita und auch bei den unter Dreijährigen steigt die Betreuungsquote stetig. Eltern brauchen Kitas als verlässliche Partner. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir die Kindertagesbetreuung weiter ausbauen, modernisieren und erhalten. Aus dem Sondervermögen stellt allein der Bund 6,5 Milliarden für Bildung und Betreuung bereit. Davon sollen rund 3,8 Milliarden Euro in ein Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung fließen. Denn jedes Kind verdient gute Startchancen – Investitionen in frühe Bildung sind Investitionen in unsere gemeinsame Zukunft.“
Zentrale Ergebnisse der „Kindertagesbetreuung Kompakt“:
Die Betreuungsquote ist erneut gestiegen: 37,4 Prozent der unter 3-jährigen Kinder besuchten 2024 eine Kita – 2023 waren es noch 36,4 Prozent. Bei gleichzeitig rückläufiger Geburtenentwicklung bedeutet dies: Besonders in Ostdeutschland rückt der Erhalt der vorhandenen Plätze in den Vordergrund, während in Westdeutschland eine weitere Ausweitung des Angebots notwendig ist.
Nahezu alle Eltern (98 Prozent) wünschen sich für ihre Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt eine Kindertagesbetreuung. 91,6 Prozent haben tatsächlich einen Platz in einer Kita oder Kindertagespflege. Bei den unter 3-jährigen Kindern fällt der Bedarf noch deutlich größer als das Angebot: Die Lücke zwischen Angebot und Bedarf beträgt hier weiterhin 14,6 Prozentpunkte.
Bund unterstützt den Ausbau der Kita-Infrastruktur und -Qualität
Das Bundeskabinett hat beschlossen, aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität insgesamt 6,5 Milliarden Euro in die Kindertagesbetreuung und digitale Bildung zu investieren. Davon sollen rund 3,8 Milliarden Euro in ein Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung fließen. Um die Qualität von Kitas und Kindertagespflege weiterzuentwickeln, unterstützt der Bund die Länder außerdem mit dem Kita-Qualitätsgesetz. Dafür stehen bis 2026 jährlich rund zwei Milliarden Euro bereit. Diese Mittel können die Länder in Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und auch in Fachkräftesicherung investieren. Der Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode sieht vor, das Kita-Qualitätsgesetz durch ein Qualitätsentwicklungsgesetz abzulösen.
Fachkräfte als Erfolgsfaktor für Kita-Ausbau und Qualitätsentwicklung
Fachpersonal bleibt der Schlüssel für qualitative und quantitative Erweiterung der Kindertagesbetreuung: In Westdeutschland hängt der weitere Ausbau maßgeblich davon ab, ob es gelingt, pädagogisches Personal zu gewinnen und langfristig zu halten. In Ostdeutschland könnten durch zusätzliche Fachkräfte bestehende Angebote stabilisiert und verbessert werden. Auch hier müssen Familien derzeit mit ungeplanten Schließzeiten in Kindertageseinrichtungen aufgrund von Personalmangel rechnen. Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften sind daher von besonderer Bedeutung.
Mit dem „Kompass Erziehungsberufe“ können am Beruf Interessierte online ihre Möglichkeiten checken, wie der Berufseinstieg in Kita oder Ganztag am besten gelingen kann: https://www.kompass-erziehungsberufe.de
Hintergrund zur Broschüre „Kindertagesbetreuung Kompakt“
Die zehnte Ausgabe von „Kindertagesbetreuung Kompakt“ enthält Daten zum bundesweiten Ausbaustand und zum elterlichen Bedarf in der Kindertagesbetreuung. Sie zeigt die Entwicklung im Zeitverlauf und beleuchtet die Situation in den Bundesländern.
Die aktuelle Ausgabe von „Kindertagesbetreuung Kompakt“ finden Sie hier: https://www.bmbfsfj.bund.de/Kindertagesbetreuung Kompakt
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 21.08.2025
CDU/CSU: Zum Start der Sozialstaatskommission
„Unser Sozialstaat braucht ein Update. Nur so können wir auch in Zukunft zielgerichtet all denen helfen, die Hilfe benötigen. Es geht jetzt darum, das Wirrwarr an Vorschriften aufzulösen um den Sozialstaat klarer, genauer und zielgerichteter auszugestalten. Der Einsatz finanzieller Mittel muss zukünftig besser und sinnvoller erfolgen. Wir müssen Einsparpotentiale identifizieren und Gelder für diejenigen einsetzen, die diese Mittel auch tatsächlich brauchen.
Seit jeher ist die Soziale Marktwirtschaft Markenkern der Union. Deshalb werden wir bei allen Reformvorschlägen Wirtschaft und Soziales zusammendenken und zusammenführen. Außerdem wollen wir die Chancen der neuen Technologien stärker nutzen, um mit Digitalisierung und KI Prozesse zusammenzuführen und unseren Sozialstaat noch leistungsfähiger zu machen.“
Quelle: Pressemitteilung CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 01.09.2025
Bündnis 90/Die Grünen: Elsa-Studie bestätigt - Die Versorgungslage für ungewollt Schwangere ist katastrophal
Zur Veröffentlichung der Elsa-Studie erklären Ulle Schauws, Sprecherin für Frauenpolitik, und Kirsten Kappert-Gonther, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit:
Es wurde Zeit, dass Ministerin Warken nun endlich nach langem Zurückhalten die Elsa-Studie veröffentlicht hat. Gerade in der so aufgeheizten Diskussion um Paragraf 218 sind die Ergebnisse dieser breit aufgestellten Verbundstudie wichtige, fundierte und sachliche Informationen über die verschlechterte Versorgungslage in Deutschland. Die Ergebnisse zeichnen ein dramatisches Bild. Wörtlich heißt es im Kurzbericht der Studie: „Auf dem Weg zum Schwangerschaftsabbruch stießen vier von fünf Frauen und damit die Mehrheit auf mindestens eine Barriere, jede dritte Frau sogar auf drei und mehr Barrieren.“ Wir müssen die Studie nun ausführlich und seriös auswerten.
Unstrittig steht aber für uns fest, dass die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen die Versorgungslage verbessern würde. Dadurch wird nicht nur endlich die Stigmatisierung der betroffenen Frauen beendet. Die Entkriminalisierung erleichtert auch eine Kostenübernahme der Eingriffe durch die Krankenkassen und sie kann die Ausbildung von Ärzt*innen verbessern. Die Ergebnisse sind ein klarer Handlungsauftrag für alle demokratischen Fraktionen nun gemeinsam konstruktiv, an einer Lösung für die Entkriminalisierung zu arbeiten.
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 14.08.2025
Bündnis 90/Die Grünen: Gerichtsurteil zu Schwangerschaftsabbrüchen
Zum Urteil des Arbeitsgerichts Hamm zur Untersagung von Schwangerschaftsabbrüchen in einer katholischen Klinik, erklären Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende, und Ulle Schauws, Sprecherin für Frauenpolitik:
Britta Haßelmann:
„Dies ist kein guter Tag für die Frauen in Lippstadt und in ganz Deutschland. Schon jetzt ist es so, dass die Versorgungslage für Schwangere in Deutschland immer schlechter wird. Das betrifft Frauen, die ihre Schwangerschaft vor der 12. Schwangerschaftswoche beenden wollen, aber auch Schwangere, die aus gesundheitlichen Gründen eine gewollte Schwangerschaft nicht fortsetzen können. Diese Fälle sind besonders tragisch und für alle Beteiligten keine einfache Entscheidung. Dass diese Frauen nun durch die Dienstanweisung eines Bistums in Lippstadt nicht mehr versorgt werden, ist das Gegenteil von christlicher Nächstenliebe. Von der katholischen Kirche ist ein Umdenken in dieser Frage erforderlich. Dass Ärztinnen und Ärzte in diese unmögliche Lage gebracht werden – ihrem medizinischen Eid verpflichtet und gleichzeitig vom Arbeitgeber angewiesen –, ist unhaltbar und muss dringend reformiert werden. Mein größter Respekt gilt deshalb Prof. Volz. Ihn und seine Kolleginnen und Kollegen dürfen wir in so einer Lage nicht alleine lassen.“
Ulle Schauws:
„Es kann nicht sein, dass die medizinische Versorgung von Schwangeren verschlechtert wird, weil die katholische Kirche Schwangerschaftsabbrüche ablehnt. Es kann nicht sein, dass es ein überholtes katholisches Arbeitsrecht mit Sonderbefugnissen in unserem Land gibt, statt einer flächendeckenden guten, medizinischen Behandlung von Schwangeren. Wenn das Arbeitsrecht hier über der medizinischen Versorgung steht, dann muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass die Versorgung von Schwangeren über andere Wege gesichert wird. Frauen dürfen in dieser Situation nicht alleingelassen werden. Die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs wäre ein entscheidender Schritt, um die Versorgungslage für alle Schwangeren zu verbessern. Zugleich dürfen wir Ärztinnen und Ärzte, wie Prof. Volz, in dieser unmöglichen Situation nicht alleine lassen. Sie benötigen Rechtssicherheit und die Unterstützung von Gesellschaft und Politik.“
Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 08.08.2025
Deutscher Bundestag: Kinderkommission zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August 2025
Seit 1999 soll der von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag der Jugend deutlich machen, welche Bedeutung das Engagement von Jugendlichen in Staat und Gesellschaft in Bildung, Beruf und Privatleben hat. Der Tag soll außerdem auf das Aktionsprogramm der Vereinten Nationen für Jugendliche sowie auf die Situation von jungen Menschen weltweit aufmerksam machen.
Der Vorsitzende der Kinderkommission im Deutschen Bundestag, Michael Hose, MdB, erklärt: „Junge Menschen sind unsere Zukunft. Unsere Politik von heute hat direkte Auswirkungen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen. Es geht um Familie, Schule, Ausbildung, aber auch um Themen wie Mitbestimmung, soziale Gerechtigkeit, Umwelt und Klima.
Oft zeigen sich die Folgen politischer Entscheidungen erst über Generationen hinweg. Gerade deshalb ist es unerlässlich, nicht über, sondern mit jungen Menschen über die Zukunft zu sprechen, zum Beispiel beim Umgang mit Social Media oder der Aufarbeitung von Corona. Sie müssen mit ihren Anliegen, ihren Ideen und ihrem Engagement Gehör finden.“
Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages ruft die Jugendlichen auf und will sie ermutigen, sich in ihrem Umfeld zu engagieren und ihre Interessen und Anliegen in politische und gesellschaftliche Jugendorganisationen einzubringen. Sie appelliert aber auch an Politikerinnen und Politiker, den Kindern und Jugendlichen zuzuhören, ihre Anliegen ernst zu nehmen und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Kinder und Jugendliche aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 07.08.2025
Bundestag: Fachkräftegewinnung in der Bildung
Die Bundesregierung bekräftigt ihre Absicht, die Fachkräftegewinnung für Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu stärken. In einer Antwort (21/1312) auf eine Kleine Anfrage (21/1098) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verweist sie dabei mehrfach auf den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD. So sei es unter anderem ein Ziel, „die duale Ausbildung für Erzieherberufe unter Beibehaltung des anerkannten Qualifikationsrahmens“ einzuführen, um die Attraktivität der Aus- und Weiterbildung in den Erziehungsberufen durch vergütete und praxisnahe Modelle in Anlehnung an die duale Ausbildung wie die hieran orientierten dualisierten Länderformate zu steigern. Die Regierung betont darüber hinaus, die Anerkennungsfrist für ausländische Berufsabschlüsse deutlich verkürzen zu wollen. Aus der Antwort geht ferner hervor, dass von 2020 bis 2024 in insgesamt 257.072 Fällen eine Förderung der Aufstiegsfortbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in auf Grundlage des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) erfolgte. Die Regierung betont, eine Weiterentwicklung des AFBG im Blick zu haben.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag – Arbeit und Soziales, Bildung, Familie und Gesundheit – Nr. 84 vom 27.08.2025
Bundestag: Digitalisierung an Schulen
Im grundsätzlichen Diskurs zur Digitalisierung muss zwischen der Nutzung privater Endgeräte, insbesondere Smartphones, einerseits und andererseits der Nutzung von für das Lernen technisch-pädagogisch optimierten Endgeräten an den Schulen unterschieden werden. Auch in Dänemark treffe man diese Unterscheidung, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (21/1335) auf eine Kleine Anfrage (21/1108) der AfD-Fraktion schreibt. Darin hatte die Fraktion nach der Digitalisierungsstrategie für Schulen vor dem Hintergrund gefragt, dass es in Dänemark und anderen Ländern eine gewisse Abkehr von der Nutzung digitaler Geräte im Unterricht gibt. Die Umsetzung des Digitalpakts Schule in den Bundesländern erfolge wie geplant. Gleichwohl verfolge auch die Bundesregierung den wissenschaftlichen Diskurs zu diesem Thema intensiv, heißt es in der Antwort.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag – Arbeit und Soziales, Bildung, Familie und Gesundheit – Nr. 84 vom 27.08.2025
Bundestag: Die Linke fragt nach Altersarmut
Für die Themen Altersarmut und Alterssicherung interessiert sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (21/1241). Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich in den vergangenen zehn Jahren der Anteil der Erwerbsminderungsrenten mit Abschlägen an allen Erwerbsminderungsrenten sowie die durchschnittliche Höhe der Abschläge in Deutschland insgesamt und nach Ländern aufgeschlüsselt entwickelt hat.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag – Arbeit und Soziales, Bildung, Familie und Gesundheit – Nr. 81 vom 20.08.2025
Bundestag: Aussetzung des Familiennachzugs
Um die Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (21/1242). Wie die Fraktion darin schreibt, trat das Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten am 24. Juli 2025 in Kraft. Wissen will sie unter anderem, was mit den bei Inkrafttreten des Gesetzes existierenden Wartelisten geschieht.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag – Inneres und Recht – Nr. 105 vom 20.08.2025
Bundestag: Speicherung und Weitergabe früherer Geschlechtseinträge
„Speicherung und Weitergabe von persönlichen Daten von Menschen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch nehmen“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (21/1165). Danach hat das Bundesinnenministerium am 11. Juni 2025 einen Referentenentwurf für eine „Verordnung zur Umsetzung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag im Meldewesen“ in die Länder- und Verbändebeteiligung gegeben. Konkret sollten in den Datensatz für das Meldewesen neue Datenfelder eingeführt werden, mit denen frühere Geschlechtseinträge dauerhaft erfasst und gespeichert werden sollen sowie die Übermittlung der früheren Vornamen ausgeweitet werden soll. Darüber hinaus solle die Übermittlung dieser Daten von den Meldebehörden an die Rentenversicherung und das Bundeszentralamt für Steuern ausgeweitet werden.
Wissen wollen die Abgeordneten, warum nach Ansicht der Bundesregierung die bereits bestehende Speicherung früherer Personenstandsdaten nicht ausreicht. Auch fragen sie unter anderem, wie die Bundesregierung es rechtfertigt, „dass die im Entwurf zur Verordnung über das Meldewesen vorgesehene dauerhafte Speicherung und Weitergabe früherer Geschlechtseinträge ausschließlich für Personen gelten soll, die ihren Geschlechtseintrag und Vornamen nach dem Selbstbestimmungsgesetz ändern, während bei anderen Namensänderungsverfahren keine vergleichbaren datenschutzrechtlich sensiblen Maßnahmen vorgesehen sind“.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag – Inneres und Recht – Nr. 100 vom 12.08.2025
Bundestag: Keine Neuregelung bei Regenbogenflagge
Das Bundesinnenministerium hat mit seinem Schreiben vom 28. April 2025 an die Bundesministerien, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, an das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung sowie nachrichtlich an das Bundeskanzleramt keine Sachverhalte im Bezug zum Hissen der Regenbogenflagge neu geregelt, sondern lediglich für Klarstellungen gesorgt. Das erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (21/1022) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (21/932).
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag – Inneres und Recht – Nr. 97 vom 07.08.2025
Bundestag: Grüne fragen nach Expertengruppe Mietrecht
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich nach Zusammensetzung und Arbeitsweise der von der Bundesregierung eingesetzten Expertengruppe Mietrecht. In einer Kleinen Anfrage (21/1253) wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie die Mitglieder ausgewählt wurden und wie Mieterorganisationen im Verhältnis zur Immobilienwirtschaft eingebunden sind. Darüber hinaus fragt die Fraktion nach dem Zeitplan und den Themen der Expertengruppe. Auch die angekündigte Ausweitung der sogenannten Schonfristzahlung im Mietrecht sowie die Wirksamkeit der Mietpreisbremse sind Gegenstand der Anfrage.
Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 368 vom 27.08.2025
BiB: Dem Fachkräftemangel begegnen – konkrete Ansatzpunkte für den Arbeitsmarkt
Der Fach- und Arbeitskräftemangel stellt den Arbeitsmarkt in Deutschland heute schon vor große Herausforderungen – und aufgrund der sich wandelnden Altersstruktur der Bevölkerung wird das Problem weiter zunehmen. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) hat auf Basis aktueller Forschungsprojekte beispielhafte Ansätze identifiziert, wie sich der demografisch bedingte Rückgang an Erwerbspersonen auffangen ließe. Ausgehend von verschiedenen Szenarien zeigen die Forschenden auf, welche konkreten Potenziale es gibt und wie sie zur Stabilisierung des Arbeitskräfteangebots beitragen können.
Erwerbspersonenpotenzial wird demografisch bedingt sinken
„Mit dem Übergang der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre in den Ruhestand wird sich die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 67 Jahren deutlich reduzieren“, erklärt Prof. Dr. C. Katharina Spieß, Direktorin des BiB. Aktuellsten Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamts zufolge geht die Zahl der Erwerbspersonen von heute 51 Mio. auf 48 Mio. im Jahr 2040 zurück. „Eine zentrale Frage für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wird somit sein, wie wir den demografisch bedingten Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials durch ein steigendes Erwerbsvolumen auffangen oder gar ausgleichen können.“
Mehrere Szenarien zur Hebung des Arbeitsvolumens möglich
Eine szenariobasierte Vorausberechnung des BiB zeigt: Ohne Veränderungen in der Erwerbsbeteiligung wird das Arbeitsvolumen in Deutschland bis 2035 deutlich sinken. Unter Beibehaltung des Status quo könnte selbst eine sehr hohe Nettozuwanderung von jährlich über 450.000 Personen bis 2035 den Rückgang nicht vollständig verhindern. Allerdings bestehen Handlungsspielräume: Ein höheres Erwerbsvolumen von Frauen, vor allem in Westdeutschland, könnte den Rückgang um bis zu 2,6 Prozentpunkte dämpfen. Steigen zudem die Erwerbsumfänge der über 55-Jährigen, ließe sich das Minus je nach Annahmen um weitere 3,2 bis 4,1 Prozentpunkte reduzieren. „Mehr Erwerbstätigkeit von Frauen sowie von Älteren könnte den Rückgang spürbar abfedern“, fasst Spieß die Ergebnisse zusammen.
Steigerungspotenzial besteht vor allem bei Müttern
Wie aus Daten des Familiendemografischen Panels FReDA hervorgeht, ist die als ideal angesehene Arbeitszeit von Müttern mit minderjährigen Schulkindern deutlich höher als die tatsächliche – im Schnitt 5 bis 6 Stunden pro Woche. Würde aus dem Ideal Realität, entspräche das einem Plus von rund 645.000 Vollzeitstellen. Väter von jüngeren Kindern hingegen arbeiten im Schnitt 3 bis 4 Stunden mehr als ideal angesehen. Würde auch hierbei das Ideal an die Realität angepasst, käme das rechnerisch einem Minus von 320.000 Vollzeitstellen gleich. Unterm Strich ergäbe sich dennoch ein Plus von 325.000 Vollzeitäquivalenten – mit zusätzlichem Potenzial, wenn auch Mütter mit erwachsenen Kindern ihre Arbeitszeit ausweiten könnten. Diese Idealvorstellungen zu realisieren ist nicht leicht und hypothetisch; es verdeutlicht aber die großen Potenziale für den Arbeitsmarkt und könnte gleichzeitig zum Wohlbefinden von Eltern beitragen.
Kindertagesbetreuung als Schlüssel für höhere Erwerbsbeteiligung
Die Verfügbarkeit einer Kindertagesbetreuung ist ein Schlüsselfaktor für die Erwerbsbeteiligung von Müttern. Insbesondere für Kinder unter drei Jahren mangelt es insgesamt weiterhin an ausreichenden Betreuungsangeboten, trotz zuletzt sinkender Geburtenzahlen. Ergebnisse aus der Kinderbetreuungsstudie (KiBS) belegen, dass jede fünfte Familie mit Kindern zwischen einem und unter drei Jahren keinen Kita-Platz hat, obwohl dafür Bedarf besteht. Gerade bei Müttern, die nicht erwerbstätig sind oder in Teilzeit arbeiten, besteht ein hoher, bislang ungedeckter Bedarf. Berechnungen des BiB zeigen: Wenn alle Familien, die einen Kita-Platz wünschen, auch einen erhielten, könnte die Erwerbsquote von Müttern mit Kindern im Alter von ein bis unter drei Jahren um bis zu 11 Prozentpunkte steigen. Besonders groß ist das Erwerbspotenzial bei ressourcenschwächeren Familien, da hier der ungedeckte Bedarf nach einem Kita-Platz besonders hoch und Erwerbswünsche vielfach vorhanden sind.
Zugewanderte aus der Ukraine mit Erfahrungen in Engpassberufen
Auch in der Bevölkerungsgruppe der Zugewanderten bestehen erhebliche Potenziale, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Exemplarisch zeigt die BiB-Forschung dies an den aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg schutzsuchenden Menschen. Sie stellen mit rund 1,1 Mio. eine bedeutende Zuwanderergruppe in Deutschland dar. Ihre Integration in den Arbeitsmarkt hat in den vergangenen Monaten zugenommen: Von den bis Sommer 2022 nach Deutschland gekommenen Schutzsuchenden waren im vierten Quartal 2024 rund 43 Prozent erwerbstätig, mittlerweile ist der Anteil auf etwa 50 Prozent angestiegen. Ein zentrales Hindernis für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bleiben die fehlenden Sprachkenntnisse. 92 Prozent derjenigen, die aktuell nicht nach einer Arbeitsstelle suchen, begründen dies mit laufenden Sprachkursen oder unzureichenden Deutschkenntnissen. Weitere 37 Prozent verweisen auf die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen sowie auf die baldige Rückreise in die Ukraine (34 Prozent).
Dennoch bietet diese Bevölkerungsgruppe großes Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt: Rund die Hälfte der ukrainischen Schutzsuchenden verfügt über Berufserfahrungen in sogenannten „Engpassberufen“, wie insbesondere in Pflege- und Gesundheitsberufen sowie im Handwerk. Diese Tätigkeiten zählen bereits heute zu den Bereichen mit erheblichem Fachkräftemangel in Deutschland. In Kombination mit einem weiterhin bestehenden Weiterbildungsbedarf, insbesondere im Bereich der Sprachförderung, bedeutet dies perspektivisch ein weiteres Potenzial für den Arbeitsmarkt.
Realistische Einschätzung der Lebensdauer kann neue Erwerbspotenziale bei Älteren eröffnen
Um die Erwerbspotenziale älterer Menschen besser abschätzen zu können, ist die Planung des Erwerbsaustrittsalters von zentraler Bedeutung. Aus Analysen des Deutschen Alterssurveys (DEAS) geht hervor, dass das geplante Erwerbsaustrittsalter bei Männern des Jahrgangs 1955 durchschnittlich etwa 63 Jahre betrug; für den Jahrgang 1970 ist es auf 65 Jahre angestiegen. Bei Frauen erhöhten sich die Vergleichswerte von knapp 63 auf 65 Jahre. Damit liegt das geplante Erwerbsaustrittsalter bei den geburtenstarken Jahrgängen der Babyboomer im Schnitt zwei bis drei Jahre unterhalb der gesetzlichen Regelaltersgrenze.
Neben klassischen Faktoren wie Gesundheit, Einkommen, Ausbildung, Arbeitsmarktlage oder gesetzlichen Vorgaben spielt die persönliche Einschätzung der eigenen Lebensdauer eine wichtige Rolle für den geplanten Ruhestand. Menschen, die ihr Leben eher kürzer einschätzen, planen ihren Ausstieg aus dem Erwerbsleben im Schnitt rund ein Jahr früher als jene, die von einer realistischeren oder längeren Lebensdauer ausgehen. Besonders betroffen sind hier ältere Frauen: Sie arbeiten häufiger in Teilzeit und tendieren stärker als Männer dazu, ihre Lebenserwartung zu unterschätzen. Eine realistischere Selbsteinschätzung könnte daher gerade bei Frauen zusätzliche Erwerbspotenziale erschließen.
Zusammenfassung
„Das Erwerbspotenzial der in Deutschland lebenden Männer und Frauen ist noch lange nicht ausgeschöpft“, fasst Spieß zusammen. Gerade bei Frauen, und hier insbesondere bei Müttern, bestehen erhebliche Spielräume, die etwa durch ungedeckte Bedarfe bei der Kindertagesbetreuung eingeengt werden. Auch bei Frauen mit Zuwanderungsgeschichte können durch vereinfachte Anerkennung von Berufsabschlüssen zusätzliche Chancen erschlossen werden. Schutzsuchende aus der Ukraine bringen zudem Qualifikationen mit, die in vielen Engpassberufen dringend gebraucht werden. Darüber hinaus eröffnen eine steigende Lebenserwartung und unterschiedliche Pläne zum Renteneintritt Möglichkeiten für eine längere Erwerbstätigkeit. Maßnahmen, die die verschiedenen skizzierten Potenziale fördern, können dabei helfen, die Arbeitsmarktintegration zu stärken und Fachkräftelücken nachhaltig zu reduzieren.
BiB: Arbeitszeit pro Kopf auf Rekordhoch – Anstieg wird von Frauen getragen
Die Arbeitszeit pro Kopf ist in Deutschland in den letzten Jahren stark gestiegen. Sie liegt aktuell mit annähernd 29 Stunden pro Woche auf dem höchsten Niveau seit der Wiedervereinigung. Dies zeigen aktuelle Auswertungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB). Berechnet wurde die geleistete wöchentliche Arbeitszeit pro Kopf für die Gesamtbevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 Jahren. Hierdurch sind alle Personen in der Bevölkerung unabhängig von ihrem aktuellen Erwerbsstatus berücksichtigt. Der Anstieg geht insbesondere auf die Frauen zurück, bei welchen sich die Arbeitszeit pro Kopf in den letzten 15 Jahren deutlich erhöht hat. Bei Männern liegt die Arbeitszeit pro Kopf dagegen in etwa auf dem Niveau, das Anfang der 1990er Jahre verzeichnet wurde.
Frauen holen gegenüber den Männern auf
Während Frauen 1991 im Schnitt rund 19 Wochenarbeitsstunden leisteten, waren es 2022 bereits über 24 Stunden. „Dieser Anstieg wird durch eine höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen getragen. Die zunehmende Teilzeittätigkeit konnte durch eine starke Erhöhung des Anteils erwerbstätiger Frauen deutlich überkompensiert werden“, analysiert Harun Sulak vom BiB. So ist der Anteil erwerbstätiger Frauen innerhalb der letzten drei Jahrzehnte um fast ein Drittel gestiegen. Dennoch seien hier weitere Potenziale vorhanden: „So liegt die von Frauen und insbesondere Müttern als ideal angesehene Arbeitszeit nochmals höher als die aktuell realisierte Arbeitszeit. Familienpolitische Reformen wie der weitere bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung sind wichtige Rahmenbedingungen, damit Frauen und auch Männer Erwerbsarbeit und Familie besser vereinbaren können“, so Prof. Dr. C. Katharina Spieß, Direktorin des BiB.
Arbeitszeiten der Männer auf dem Niveau vom Anfang der 1990er Jahre
Im Vergleich zu den Frauen zeigen sich bei Männern über den Zeitraum seit 1991 nur geringe Veränderungen. Bedingt durch die wirtschaftliche Schwächephase nach der Wiedervereinigung mit zahlreichen Betriebsschließungen vor allem im Osten Deutschlands sank die durchschnittliche Wochenarbeitszeit zunächst ab und erreichte Mitte der 2000er Jahre ihren Tiefpunkt. Seitdem ist ein Wiederanstieg zu beobachten, der nur von der Coronapandemie unterbrochen wurde. „Die Daten belegen, dass Männer aktuell zwar häufiger erwerbstätig sind als 1991, und hier vor allem im höheren Alter. Allerdings arbeiten die erwerbstätigen Männer mittlerweile im Schnitt 2,6 Stunden pro Woche weniger. In der Summe gleichen sich die beiden Faktoren aus, sodass die Arbeitszeit pro Kopf bei Männern heute ziemlich genau auf dem Niveau von vor 30 Jahren liegt“, erklärt BiB-Forschungsdirektor Prof. Sebastian Klüsener.
Arbeitszeitangleichung als gesellschaftlicher Indikator
Insgesamt ergibt sich aus den Daten dennoch ein positiver Trend: Die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden pro Kopf sind gestiegen – vor allem durch die höhere Erwerbsbeteiligung bei Frauen. Der Abstand zwischen den Geschlechtern hat sich im Beobachtungszeitraum deutlich verringert. Während 1991 Frauen im Schnitt rund 14 Stunden weniger arbeiteten als Männer, beträgt der Unterschied heute nur noch gut 9 Stunden. „Diese Entwicklung ist nicht nur ein arbeitsmarktpolitisches Signal, sondern auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels“, so Klüsener.
Zur Methode: Die Berechnungen sind altersstandardisiert mit Bezug auf die Altersstruktur der Bevölkerung im Jahr 2022. Dies dient dazu, den Einfluss von Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung im Betrachtungszeitraum auf die beobachteten Trends herauszurechnen.
DIW: Familien und Freundeskreise sind größter Pflegedienst Deutschlands
Studie beleuchtet informellen Pflegebereich in Deutschland – Unbezahlte Pflege durch Angehörige ist zentrale Stütze des Pflegesystems – Pflegeleistende müssen stärker unterstützt und Strukturen der sozialen Pflegeversicherung auf Prüfstand gestellt werden
Die meisten Pflegebedürftigen in Deutschland werden von Angehörigen, Freund*innen oder Bekannten versorgt – unentgeltlich und oftmals ganz ohne professionelle Unterstützung. Von den derzeit rund fünf Millionen Pflegebedürftigen, die zu Hause leben, trifft das auf rund vier Millionen Menschen zu. Diese informelle Pflege nimmt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), von Forscherinnen des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) sowie der Technischen Universität Dortmund unter die Lupe. Dabei zeigt sich eine große Vielfalt – nicht nur mit Blick auf unterschiedliche Pflegekonstellationen, sondern beispielsweise auch, was zeitliche und finanzielle Aufwendungen, Alter, Bildungshintergründe und Einkommensquellen der Pflegeleistenden betrifft. „Angehörige und andere nahestehende Personen sind der größte Pflegedienst Deutschlands“, sagt Johannes Geyer, stellvertretender Leiter der Abteilung Staat im DIW Berlin und einer der Studienautoren. „Im Zuge des demografischen Wandels wird die informelle Pflege in den nächsten Jahren noch bedeutender werden.“
Pflege findet meist außerhalb des eigenen Haushalts statt
Die Studie zeigt, dass der überwiegende Teil der informellen Pflege außerhalb des eigenen Haushalts erfolgt, insbesondere durch Menschen im Alter zwischen 50 und 65 Jahren, die häufig ihre Eltern pflegen. Pflege innerhalb des eigenen Haushalts ist seltener und betrifft vor allem Partner*innen. Frauen übernehmen in beiden Fällen den größten Anteil der Pflege: 64 Prozent der Pflegenden sind weiblich, 36 Prozent männlich. Bei innerhäuslicher Pflege verfügen 83 Prozent der Pflegebedürftigen über einen anerkannten Pflegegrad, bei außerhäuslicher Pflege sind es 74 Prozent. Fast die Hälfte (47 Prozent) der außerhäuslich Pflegenden leistet drei Mal pro Woche oder häufiger Unterstützung, ein Drittel davon sogar in einem anderen Ort als dem eigenen Wohnort. Innerhäuslich Pflegende sind oft bereits im Ruhestand (45 Prozent), unter den außerhäuslich Pflegenden sind es hingegen nur 16 Prozent.
Viele pflegende Haushalte sind auch finanziell belastet. Bei innerhäuslicher Pflege entstehen in der Hälfte der Fälle zusätzliche Kosten, die im Schnitt 138 Euro pro Monat betragen. Bei außerhäuslicher Pflege tragen zwar nur 20 Prozent der Haushalte zusätzliche Kosten, diese fallen mit durchschnittlich 226 Euro pro Monat jedoch deutlich höher aus. „Pflege durch Angehörige und Freund*innen ist oft eine erhebliche Belastung für die Pflegenden, zeitlich wie finanziell“, sagt Ulrike Ehrlich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am DZA. „Diese müssen nicht selten ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder vorübergehend sogar ganz aufgeben, was häufig geringere Einkommen und einen verstärkten Bezug von Transferleistungen bedeuten kann.“
Familienpflegegeld nur ein erster Baustein
Um die Belastungen abzufedern, prüft die Bundesregierung ein Familienpflegegeld. Als mögliche Maßnahme wird die Einführung einer Lohnersatzleistung diskutiert. Diese soll pflegende Angehörige finanziell unterstützen, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren oder aussetzen müssen. „Ein Familienpflegegeld kann helfen, die finanzielle Lage von Pflegenden zu stabilisieren. Es greift aber zu kurz, wenn langfristige Pflegesituationen oder Menschen außerhalb des Erwerbslebens nicht berücksichtigt werden“, betont Peter Haan, Leiter der Abteilung Staat im DIW Berlin. Da der absehbar steigende Pflegebedarf nach Ansicht der Studienautor*innen nicht allein durch Familien und Freundeskreise aufgefangen werden könne, müsse die Pflegeinfrastruktur gestärkt werden. Dazu gehöre nicht nur der Ausbau professioneller Pflegeangebote, sondern auch eine finanzielle Stabilisierung der sozialen Pflegeversicherung. „Um private Pflegenot zu verhindern, muss die Pflegeversicherung mehr Mittel und Möglichkeiten erhalten. Informelle Pflege ist unverzichtbar, darf aber nicht überfordert werden“, so Haan.
- Studie im DIW Wochenbericht 37/2025
- Infografik in hoher Auflösung (JPG, 0.8 MB)
- Interview mit Studienautor Johannes Geyer
- Audio-Interview mit Johannes Geyer (MP3, 15.73 MB)
Hans-Böckler-Stiftung: Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit: Knapp drei Viertel der Beschäftigten fürchten negative Folgen sehr langer Arbeitstage
Knapp drei Viertel der Beschäftigten befürchten negative Folgen für Erholung und Gesundheit, für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienleben sowie die Organisation ihres Alltags, wenn generell Arbeitstage von mehr als zehn Stunden möglich werden. Das wäre eine Folge der von der Bundesregierung favorisierten Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit. Frauen rechnen noch deutlich häufiger mit negativen Wirkungen als Männer, was daran liegen dürfte, dass sie deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit zusätzlich zum Erwerbsjob leisten. Das ergibt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Sie basiert auf einer Online-Befragung vom Juli 2025 unter mehr als 2000 Beschäftigten.* Um Aussagen über die Gesamtheit der Arbeitnehmer*innen in Deutschland treffen zu können, wurden die Daten gewichtet. Die Befragungsergebnisse unterstreichen auch, dass sehr lange und flexible Arbeitszeiten in Deutschland längst verbreitet sind. Immerhin 12 Prozent der vom WSI Befragten arbeiten wenigstens an einzelnen Tagen in der Woche länger als zehn Stunden. Und knapp 38 Prozent der Beschäftigten nehmen zumindest ab und zu abends nach 19 Uhr ihre Erwerbsarbeit nochmal auf, nachdem sie sie tagsüber aus privaten Gründen unterbrochen haben, etwa, wenn die Kinder aus der Schule kommen. „Die vorliegenden Ergebnisse zeigen: Eine Abschaffung der gesetzlichen täglichen Arbeitszeitgrenze ist weder erforderlich noch sinnvoll“, lautet daher das Fazit der Studienautorinnen Dr. Yvonne Lott und Dr. Eileen Peters vom WSI.
Die Bundesregierung und Arbeitgeberverbände wollen mehr Möglichkeiten für sehr lange Arbeitstage schaffen, indem die Höchstarbeitszeit für den Erwerbsjob nicht mehr pro Tag, sondern pro Woche geregelt wird. Damit würden kurzfristig generell Erwerbsarbeitstage von mehr als zehn Stunden, im Extremfall sogar von mehr als 12 Stunden möglich, die dann über einen längeren Zeitraum auf durchschnittlich acht Stunden ausgeglichen werden müssen. Aktuell ist der Acht-Stunden-Tag der gesetzliche Referenzrahmen, allerdings kann die Arbeitszeit ohne Rechtfertigung auf bis zu zehn Stunden täglich ausgeweitet werden, wenn innerhalb von sechs Monaten ein Ausgleich erfolgt. Darüber hinaus lässt das Arbeitszeitgesetz zahlreiche branchen- bzw. tätigkeitsbezogene Abweichungen und Ausnahmen zu, die auch in erheblichem Umfang genutzt werden. Diese müssen aber transparent geregelt sein durch einen Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder durch behördliche Erlaubnis, wobei im Regelfall ein entsprechender Zeitausgleich gewährleistet sein muss.
Trotz dieser erheblichen Gestaltungsmöglichkeiten argumentieren Befürworter*innen einer generellen Deregulierung unter anderem mit mehr Flexibilität, die nicht nur im Interesse von Arbeitgebern sondern auch von Beschäftigten sei.
Weniger als 10 Prozent der Befragten sehen mögliche Vorteile
Das sieht eine große Mehrheit der potenziell Betroffenen jedoch ganz anders: 72,5 Prozent jener befragten Arbeitnehmer*innen, die bislang noch nicht länger als zehn Stunden an einzelnen Tagen in der Woche arbeiten, sagen, dass auch schon einzelne derart lange Arbeitstage ihre Fähigkeit, nach Feierabend abzuschalten und sich zu erholen, etwas bis deutlich verschlechtern würden. Nur sechs Prozent erwarten eine Verbesserung (siehe auch Abbildung 1 in der pdf-Version dieser PM; Link unten). Die kritische Einschätzung deckt sich mit Erkenntnissen aus der Arbeitsmedizin. Danach kommt es bei sehr langen täglichen Arbeitszeiten langfristig häufiger zu stressbedingten Erkrankungen. Es steigt sowohl das Risiko für psychische Leiden wie Burnout und Erschöpfungszustände, als auch für körperliche Probleme, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zusätzlich wächst auch das Unfallrisiko ab der 8. Arbeitsstunde exponentiell an, so dass Arbeitszeiten über zehn Stunden täglich als hoch riskant eingestuft werden (mehr in unserem Forschungsüberblick; Link am Ende der PM).
Sogar 75 Prozent der Befragten rechnen damit, dass Arbeitstage über zehn Stunden für sie die Möglichkeit verschlechtern, familiäre oder private Verpflichtungen zu erfüllen. 73,5 Prozent erwarten negative Auswirkungen auf gemeinsame familiäre oder private Aktivitäten, 71,6 Prozent sehen die Gestaltung ihres Alltags erschwert. Der Anteil der Befragten, die hier Positives erwarten, liegt jeweils unter zehn Prozent. „Eine Aufhebung der täglichen Arbeitszeitgrenze droht, die Work-Life-Balance der Beschäftigten zu verschlechtern“, fassen die WSI-Forscherinnen Lott und Peters die Sicht der meisten Arbeitnehmer*innen zusammen.
Deregulierung könnte Unwucht bei der Sorgearbeit noch weiter verschärfen – und so Erwerbstätigkeit von Frauen behindern
Die Deregulierung könne zudem Geschlechterungleichheiten verschärfen – weibliche Beschäftigte befürchten noch häufiger Verschlechterungen als Männer (siehe auch die Abbildungen 2 und 3 in der pdf-Version). Ein wesentlicher Grund dürfte nach Analyse der WSI-Expertinnen darin liegen, dass Frauen in Beziehungen neben ihrem Erwerbsjob deutlich mehr als Männer unbezahlte Arbeit in Haushalt, Pflege von Angehörigen oder mit Kindern leisten. Realistisch ist, dass diese Unwucht weiter wächst, wenn der Partner künftig noch länger arbeitet.
Das legen auch die Aussagen jener 12 Prozent der Beschäftigten nahe, die bereits jetzt zumindest an einzelnen Tagen in der Woche länger als zehn Stunden im Erwerbsjob arbeiten. 48 Prozent von ihnen berichten, dass am Abend die Partnerin oder der Partner schon gelegentlich oder häufig bei Hausarbeiten oder der Kinderbetreuung für sie einspringen mussten. Bei den Befragten ohne Zehn-Stunden-Tage sagen das gut 17 Prozentpunkte weniger. Da die befragten Männer fast doppelt so häufig wie die Frauen zumindest gelegentlich mehr als 10 Stunden im Erwerbsjob arbeiten (15,4% gegenüber 8 %), bleibt die häusliche Mehrarbeit vor allem an Frauen hängen.
„Das ist nicht nur ein individuelles Problem der direkt Betroffenen, sondern es macht es insbesondere Müttern noch schwerer, ihre Arbeitszeit auszuweiten“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Damit könnte die Deregulierung der Höchstarbeitszeit ausgerechnet den Zuwachs bei der Erwerbstätigkeit von Frauen bremsen, der in den vergangenen Jahren wesentlich zu Rekordwerten bei Erwerbstätigkeit und Arbeitsvolumen in Deutschland beigetragen hat. Gleichzeitig könnte sie Probleme bei Gesundheit und Demografie verschärfen, höhere Krankenstände begünstigen und die Entscheidung für Kinder schwerer machen. Die Deregulierung erscheint damit auch wirtschaftlich kontraproduktiv.“
Ohnehin ist die Flexibilität, mit der berufliche und private Anforderungen unter einen Hut gebracht werden sollen, bereits jetzt hoch und offenbar mit dem geltenden Arbeitszeitrecht vereinbar. So geben 37,6 Prozent der Befragten an, dass es zumindest gelegentlich bei ihnen vorkommt, dass sie die Arbeit tagsüber aus privaten Gründen für mehrere Stunden unterbrechen und dafür nach 19 Uhr weiterarbeiten.
Wichtige Gründe für Unterbrechungen sind Haushalt/Besorgungen, Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. Dass sie nach 19 Uhr die Erwerbsarbeit fortsetzen, begründen 60 Prozent der Befragten mit derart „fragmentierten“ Arbeitstagen damit, dass sie sonst nicht ihre Arbeit schaffen würden. Jeweils ein gutes Drittel sagt zudem, dass es die Arbeit erfordere, beispielsweise, weil sie mit beruflichen Kontakten in anderen Zeitzonen kommunizieren müssen, oder dass sie sonst nicht auf ihre Arbeitszeit kommen. Bei einem knappen Viertel der Befragten, die nach 19 Uhr noch einmal loslegen, erwarten das die Vorgesetzten.
Gut 60 Prozent der Befragten, die zumindest gelegentlich nach 19 Uhr noch einmal die Erwerbsarbeit aufgreifen, geben an, dass sie im Gegenzug „immer“ oder „meistens“ am Folgetag später mit der Arbeit beginnen können, weitere knapp 23 Prozent sagen, das sei „in Ausnahmefällen“ möglich. Wenn der Arbeitsbeginn entsprechend später erfolgt, kann die im Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene und für die Gesundheit wichtige Ruhezeit von 11 Stunden zwischen zwei Arbeitstagen eingehalten werden.
Allerdings geben Beschäftigte mit „fragmentierten“ Arbeitstagen deutlich häufiger als andere an, dass abends die Partnerin oder der Partner schon bei Haushalt oder Kinderbetreuung für sie einspringen mussten. „Wir wissen auch aus anderen Studien, dass fragmentierte Arbeitstage und Arbeit am Abend für viele Beschäftigte bestenfalls eine Not- und keine Wunschlösung sind. Häufig sind sie verbunden mit hohem Stress und Zeitdruck“, sagt WSI-Arbeitszeitexpertin Yvonne Lott. „Sie werden aber genutzt, um Vereinbarkeitskonflikte zu entschärfen, und offenbar funktioniert das mit dem aktuellen Arbeitszeitgesetz. Die von der Bundesregierung angekündigte Deregulierung dürfte hingegen das fragile Verhältnis von Flexibilität und notwendigen Begrenzungen aus dem Gleichgewicht bringen, weil es gleichzeitig sehr lange und fragmentierte Arbeitstage begünstigt.“
Anstelle der Abschaffung der täglichen Arbeitszeitgrenze seien vielmehr Reformen nötig, die Work-Life Balance und Partnerschaftlichkeit unterstützen, analysieren die Wissenschaftler*innen. Zu den zentralen arbeitszeitpolitischen Maßnahmen zählen sie:
- Die Verlängerung der Partnermonate beim Elterngeld, wie im aktuellen Koalitionsvertrag vorgesehen
- Bessere Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige, wie sie der Unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf empfiehlt
- Eine Reform der Brückenteilzeit, indem Schwellenwerte abgeschafft, individuelle Arbeitszeitwünsche stärker berücksichtigt und flexible Anpassungen während der Laufzeit ermöglicht werden
Da sich Zeitwünsche und -bedarfe im Lebensverlauf der meisten Beschäftigten verändern, brauche es darüber hinaus Arbeitszeitmodelle, die Beschäftigten mehr Kontrolle über Dauer, Lage und Verteilung ihrer Arbeitszeit sowie über den Arbeitsort ermöglichen.
Die Pressemitteilung mit Abbildungen.
Forschungsüberblick zu weiteren Folgen der Deregulierungspläne.
Statistisches Bundesamt: 13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter
- Mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel der heutigen Erwerbspersonen verloren
- Jüngere Altersgruppen werden ältere zahlenmäßig nicht ersetzen
- Erwerbstätigenquote älterer Menschen steigt stärker als in anderen Altersgruppen
Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine wichtige Rolle. Innerhalb von 15 Jahren werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in den Ruhestand gegangen sein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024 mitteilt, werden bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht knapp einem Drittel (31 %) aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zur Verfügung standen.
Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht ersetzen können. Obwohl die 60- bis 64-Jährigen bereits im Übergang zum Ruhestand waren, stellten sie im Jahr 2024 noch 4,4 Millionen Erwerbspersonen. Das entsprach einer Erwerbsquote von 68 % in dieser Altersgruppe. Von den jüngeren Babyboomern im Alter von 55 bis 59 Jahren war ein deutlich höherer Anteil (85 %) noch am Arbeitsmarkt aktiv. Mit 5,6 Millionen stellten sie über alle Altersgruppen hinweg die meisten Erwerbspersonen. Beide Altersgruppen umfassten zusammen 10,0 Millionen Erwerbspersonen und damit mehr als die jüngeren Altersgruppen bis 54 Jahre. Zwar hatten sowohl die 45- bis 54-Jährigen als auch die 35- bis 44-Jährigen mit 90 % beziehungsweise 89 % die höchsten Erwerbsquoten, allerdings reichte die Zahl der Erwerbspersonen mit 9,3 beziehungsweise 9,8 Millionen nicht ganz an die der Babyboomer heran. Auch die 25- bis 34-Jährigen lagen mit 9,0 Millionen Erwerbspersonen deutlich unter der Zahl der Babyboomer. Gleiches galt für die beiden jüngsten Altersgruppen unter 25 Jahren, die sich teilweise noch in ihrer Ausbildungsphase befanden und erst nach Abschluss ihrer Ausbildung vollumfänglich für den Arbeitsmarkt aktiviert werden könnten.
Erwerbstätigenquote älterer Menschen seit 2014 um 10 Prozentpunkte gestiegen
Um dem künftigen Arbeitskräftemangel zumindest kurzfristig entgegenzuwirken, wird diskutiert, die geburtenstarken Jahrgänge umfassender im Berufsleben zu halten oder dafür zu reaktivieren. Die Erwerbstätigenquote von älteren Menschen ist in den vergangenen zehn Jahren bereits gestiegen: Während 2014 knapp zwei Drittel (65 %) der 55- bis 64-Jährigen einer Erwerbstätigkeit nachging, waren es 2024 bereits drei Viertel (75 %). Das entspricht einer Steigerung von 10 Prozentpunkten. Damit ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen deutlich stärker gestiegen als in jüngeren Altersgruppen. Bei den 15- bis 24-Jährigen nahm sie im selben Zeitraum um 5 Prozentpunkte auf zuletzt 51 % zu. Am geringsten fiel die Steigerung bei den 25- bis 54-Jährigen aus: Hier stieg die Erwerbstätigenquote von 83 % im Jahr 2014 auf 85 % im Jahr 2024.
Großteil der Erwerbstätigen geht weiterhin vorzeitig in Ruhestand
Trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit älterer Menschen, gehen nach wie vor viele von ihnen vorzeitig in den Ruhestand. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von gesundheitlichen Einschränkungen über versicherungsrechtliche Besonderheiten wie langjährige Beitragszahlungen oder Frühverrentungsangeboten von Unternehmen bis hin zum Wunsch nach mehr Freizeit. Waren mit 58 Jahren im vergangenen Jahr noch 82 % (2014: 74 %) erwerbstätig, lag die Quote bei den 60-Jährigen bereits bei 79 % (2014: 69 %). Ab 62 Jahren nimmt die Erwerbstätigkeit deutlicher ab: 70 % (2014: 56 %) gingen in diesem Alter einer Erwerbstätigkeit nach, mit 64 Jahren waren es noch 46 % (2014: 33 %). Mit 66 beziehungsweise 68 Jahren war ein Großteil der Erwerbstätigen aus dem Berufsleben ausgeschieden: Die entsprechenden Erwerbstätigenquoten lagen im vergangenen Jahr bei 22 % (2014: 15 %) und 16 % (2014: 11 %).
Methodische Hinweise:
Erwerbspersonen setzen sich aus Erwerbstätigen und Erwerbslosen zusammen. Die Erwerbsquote ist der Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung, die Erwerbstätigenquote hingegen der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung, jeweils an derselben Altersgruppe. Die Daten für das Jahr 2024 basieren auf den Erstergebnissen des Mikrozensus.
Weitere Informationen:
Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt.
Statistisches Bundesamt: Tag der Jugend: Anteil junger Menschen von 15 bis 24 Jahren bleibt mit 10,0 % auf historisch niedrigem Niveau
Der Anteil junger Menschen in Deutschland ist weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Gut 8,3 Millionen Menschen waren zum Ende des Jahres 2024 im Alter von 15 bis 24 Jahren. Demnach war jeder zehnte Mensch (10,0 %) in diesem Alter, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August mitteilt. Bereits seit dem Jahresende 2021 liegt der Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung nahezu unverändert bei einem Tiefstand von 10,0 %. Dass er seitdem nicht weiter gesunken ist, sondern sich stabilisiert hat, liegt vor allem an der Zuwanderung vorwiegend junger Menschen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022.
Anfang der 1980er Jahre war jede sechste Person im jugendlichen Alter
Den höchsten Anteil an der Gesamtbevölkerung hatten junge Menschen in der ersten Hälfte der 1980er Jahre, als die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer im jugendlichen Alter waren. 1983 waren auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik rund 13,1 Millionen Menschen 15 bis 24 Jahre alt. Das war jede sechste Person (16,7 %).
Zuwanderung wirkt der Alterung der Bevölkerung entgegen
Ohne Zuwanderung wäre der Anteil junger Menschen in der Gesamtbevölkerung noch niedriger. Betrachtet man die Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte, dann lag der Anteil junger Menschen von 15 bis 24 Jahren nach Ergebnissen des Mikrozensus 2024 nur bei 8,6 %. In der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte waren dagegen 12,0 % in dem Alter, also jede achte Person. Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind Personen, die entweder selbst oder deren beide Elternteile seit 1950 zugewandert sind.
Besonders hoch war der Anteil junger Menschen mit 20,7 % bei Nachkommen Eingewanderter – das heißt bei Menschen, die in Deutschland geboren wurden und deren Elternteile beide zugewandert sind. Ähnlich hoch war der Anteil mit 20,0 % bei Menschen mit nur einem eingewanderten Elternteil (einseitige Einwanderungsgeschichte). Bei Eingewanderten selbst waren 9,2 % im Alter von 15 bis 24 Jahren.
Anteilig weniger junge Menschen in ostdeutschen Bundesländern
Die Altersstruktur und damit auch der Anteil junger Menschen unterscheidet sich auch regional. Die Stadtstaaten Bremen (11,1 %) und Hamburg (10,5 %) sowie das Flächenland Baden-Württemberg (10,5 %) hatten Ende 2024 den höchsten Anteil an 15- bis 24-Jährigen. Anteilig die wenigsten jungen Menschen lebten in Brandenburg (8,7 %), gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (je 8,9 %).
In Deutschland leben anteilig weniger junge Menschen als im EU-Schnitt
Laut EU-Statistikbehörde Eurostat lebten zum Jahresbeginn 2024 in Deutschland (10,0 %) anteilig weniger junge Menschen als im Durchschnitt aller 27 EU-Mitgliedstaaten (10,7 %). EU-weit am höchsten war der Anteil der 15- bis 24-Jährigen in Irland (12,6 %), vor den Niederlanden (12,3 %) und Dänemark (12,2 %). Den geringsten Anteil junger Menschen innerhalb der EU verzeichneten Bulgarien (9,2 %) und Litauen (9,5 %).
Methodische Hinweise:
Die Zahlen zur Gesamtbevölkerung nach Alter stammen aus der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes und beziehen sich jeweils auf den Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres. Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland ab 1950 nach dem Gebietsstand seit dem 3. Oktober 1990. Ab 2011 handelt es sich um die Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011, ab 2022 basiert die Fortschreibung auf den Ergebnissen des Zensus 2022. Aufgrund der Umstellung der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 sind die Ergebnisse ab 2022 mit denen vor 2022 nur eingeschränkt vergleichbar. Gleiches gilt für die Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011.
Die Daten zur Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte stammen aus dem Mikrozensus. Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, wurden die Daten an den Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 hochgerechnet. Dargestellt sind die Erstergebnisse des Jahres 2024 zur Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten.
Stichtag für die Bevölkerungszahlen von Eurostat ist jeweils der 1. Januar des Jahres. Der Stand der Eurostat-Daten zum 1. Januar 2024 entspricht für Deutschland somit dem Stand der Bevölkerungsfortschreibung zum 31. Dezember 2023. Der Anteil junger Menschen im EU-Durchschnitt für 2024 ist vorläufig beziehungsweise enthält zum Teil Schätzungen.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse zur Situation der Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte in Deutschland bietet der Statistische Bericht Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte sowie das Dashboard Integration.
Statistisches Bundesamt: 4,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 2024 Mehrarbeit geleistet
- Mehrarbeit in der Finanz- und Versicherungsbranche und der Energieversorgung am weitesten verbreitet
- Knapp ein Fünftel der Betroffenen leistet unbezahlte Überstunden
Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gehören Überstunden zum Arbeitsalltag: Knapp 4,4 Millionen von ihnen haben im Jahr 2024 durchschnittlich mehr gearbeitet, als in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart war. Das entsprach einem Anteil von 11 % der insgesamt 39,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Dabei leisteten Männer mit einem Anteil von 13 % etwas häufiger Mehrarbeit als Frauen (10 %).
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Finanz- und Versicherungsbranche und der Energieversorgung leisten am häufigsten Mehrarbeit
Deutliche Unterschiede zeigten sich mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche. Am weitesten verbreitet war Mehrarbeit in den Bereichen Finanz- und Versicherungsleistungen und Energieversorgung, wo 17 % beziehungsweise 16 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon betroffen waren. Am niedrigsten war der Anteil mit 6 % im Gastgewerbe, gefolgt von der Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen wie etwa Wach- und Sicherheitsdienstleistungen oder Reinigungsdienstleistungen (8 %).
15 % der Betroffenen mit mindestens 15 Stunden Mehrarbeit pro Woche
Für die meisten Beschäftigten war der Umfang der Mehrarbeit auf wenige Stunden pro Woche begrenzt. 45 % gaben an, durchschnittlich weniger als fünf Überstunden geleistet zu haben. Bei insgesamt 73 % waren es weniger als zehn Stunden. Allerdings leisteten 15 % der Betroffenen mindestens 15 Stunden Mehrarbeit in der Woche.
Bei einem Großteil fließt die Mehrarbeit in ein Arbeitszeitkonto ein
Mehrarbeit kann in Form von bezahlten und unbezahlten Überstunden geleistet werden oder auf ein Arbeitszeitkonto einfließen, über das sie später wieder ausgeglichen werden kann. Von den Personen, die 2024 mehr gearbeitet hatten als vertraglich vereinbart, leistete knapp jede oder jeder Fünfte (19 %) unbezahlte Überstunden. 16 % wurden für ihre Überstunden bezahlt. 71 % nutzten ein Arbeitszeitkonto für die geleistete Mehrarbeit. Mehrarbeit wurde teilweise über eine Kombination der drei Formen geleistet.
Methodische Hinweise:
Die Daten basieren auf den Erstergebnissen der Arbeitskräfteerhebung des Mikrozensus für das Jahr 2024.
Mehrarbeit bezieht sich auf die abhängig Beschäftigten im Alter ab 15 Jahren, die angaben, in der Berichtswoche in ihrer Haupttätigkeit mehr Stunden als vertraglich vereinbart gearbeitet zu haben. Diese Personen konnten weiterhin angeben, ob diese Stunden auf ein Arbeitszeitkonto einflossen oder als Überstunden entweder vergütet wurden oder unbezahlt waren. Es wurde berücksichtigt, dass Mehrarbeit auch über eine Kombination der drei Arten von Überstunden geleistet werden konnte. Abhängig Beschäftigte arbeiten auf Basis eines Arbeitsvertrages für einen Arbeitgeber und erhalten hierfür eine Vergütung. Dazu zählen Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, Beamtinnen und Beamte sowie Auszubildende.
INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN
AWO: Pflegende An- und Zugehörige mehr entlasten
Zum heutigen bundesweiten Tag der pflegenden Angehörigen erklärt Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt: „Pflegende An- und Zugehörige sind das Rückgrat der häuslichen Pflege. Darum gilt es, ihnen an diesem Tag nicht nur Dank zu sagen, sondern vor allem auch bessere Unterstützung einzufordern.“
Rund 80% der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause versorgt, mit und ohne Unterstützung ambulanter Pflege- und Betreuungsdienste. Diese Aufgabe ist nicht nur körperlich, psychisch und emotional herausfordernd, sondern oft auch mit finanziellen und organisatorischen Herausforderungen verbunden.
„Pflegende Angehörige brauchen Entlastung, aktuell wird aber unter dem verklärenden Begriff von „mehr Eigenvorsorge“ politisch das Gegenteil diskutiert, nämlich ein Abbau von Hilfe: Pflegebedürftige und ihre Familien sollen künftig weniger unterstützende Leistungen erhalten, dafür noch mehr selbst pflegen und mehr selbst zahlen. Die Folgen sind absehbar: Pflegebedürftige, deren Zustand sich schneller verschlechtert, Pflegende, die unter massiver Erschöpfung und anderen gesundheitlichen Folgeschäden leiden. Damit sind häusliche Pflegearrangements gefährdet. Den Familien bleibt als Alternative zur Bewältigung der persönlichen Situation nur noch das Pflegeheim.“
Die Arbeiterwohlfahrt fordert, pflegende An- und Zugehörige zu entlasten, und zwar durch
- den Ausbau von Pflege- und Entlastungsangeboten sowie pflegerischer Notfallversorgung;
- die vertragliche Sicherstellung eines einheitlichen, flächendeckenden und niedrigschwelligen Zugangs zu Kursangeboten für pflegende Angehörige und Schulungen in der Häuslichkeit;
- die Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und Lückenschluss bei der rentenrechtlichen Absicherung
- die Einführung einer Lohnersatzleistung für Pflegepersonen analog des Elterngeldes
- die Reduzierung der Eigenbeteiligung im stationären und im ambulanten Bereich.
Hintergrund
Der Tag der pflegenden Angehörigen wird in Deutschland immer am 8. September begangen, um das Engagement der An- und Zugehörigen zu würdigen, die zu Hause pflegebedürftige Menschen unterstützen oder oft die Hauptversorgung leisten.
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e.V. vom 08.09.2025
Bundeselternrat, GMK, Deutsches Kinderhilfswerk, D64 fordern: Keine pauschalen Handyverbote an Schulen!
In einem gemeinsamen Offenen Brief sprechen sich der Bundeselternrat, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), das Deutsche Kinderhilfswerk sowie D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt klar gegen pauschale Smartphone-Verbote an Schulen aus. Stattdessen fordern sie eine bundesweite Bildungsoffensive für Medien- und Demokratiekompetenz sowie die aktive Beteiligung von Schüler:innen, Eltern und Lehrkräften an schulischen Regelungen.
Aline Sommer-Noack, stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, kommentiert: „Digitale Medien gehören heute zum Alltag von Kindern und Jugendlichen – und damit auch in eine zeitgemäße Schule. Pauschale Handyverbote greifen zu kurz. Statt symbolpolitischer Schnellschüsse braucht es klare, altersgerechte und gemeinsam erarbeitete Regeln, die pädagogisch sinnvoll sind und die Verantwortung von Schule, Eltern und Schülern gleichermaßen einbeziehen.“
Die Medienpädagogin Anke Dana Tretter, die Mitglied der AG Bildung von D64 ist, ergänzt: „Pauschale Verbote privater Smartphones nehmen Schulen die Chance, digitale Herausforderungen pädagogisch zu begleiten. Verbote behindern die Entwicklung von Selbstregulation, kritischem Denken und demokratischer Verantwortung. Kompetenz entsteht nicht durch Abwesenheit des Gegenstands.“
Für Rüdiger Fries, den Co-Vorsitzenden der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) ist klar: „Medienkompetenz entsteht nicht durch Weglegen der Smartphones, sondern durch reflektierte Begleitung und pädagogisch-didaktische Gestaltung. Wir müssen Kinder und auch Jugendliche gleichermaßen schützen, befähigen und beteiligen, damit sie ausprobieren und kreativ sein können. Hilfreich ist die gemeinsame Entwicklung differenzierter Regulierungsmaßnahmen in der Schule. Ein pauschales Verbot greift zu kurz. Es fokussiert auf das Gerät als Ursache, statt die tieferliegenden pädagogischen, gesellschaftlichen und sozialen Faktoren in den Blick zu nehmen.“
Kai Hanke, Geschäftsführer des Deutsches Kinderhilfswerkes e.V. ergänzt: „Pauschale Verbote entmündigen Kinder und Jugendliche und stehen in krassem Widerspruch zu ihrem in der UN-Kinderrechtskonvention garantierten Recht auf digitale Teilhabe sowie den Aufbau von Medienkompetenz. Beim Thema Medienkompetenz darf die Politik weder junge Menschen noch Familien alleinlassen. Deshalb braucht es statt allgemeiner Verbote endlich mehr Beteiligung junger Menschen und gute Lernbedingungen in der Schule sowie Verantwortungsübernahme von Anbietern, um bestehende Risken der Mediennutzung zu reduzieren.“
Im Brief heißt es: „Verbote schaffen keine Medienkompetenz – sie verschieben das Problem ins Private und lassen Eltern und Schüler:innen allein. Wir brauchen pädagogisch begleitete Erfahrungsräume, keine reflexartigen Verbote.“
Ziel müsse es sein, junge Menschen im Umgang mit digitalen Medien zu befähigen – nicht, sie davon auszuschließen. Schulen seien der zentrale Ort, um digitale Selbstregulation, kritische Informationsbewertung und demokratische Teilhabe zu erlernen. Pauschale Handyverbote stünden diesem Auftrag entgegen. Die unterzeichnenden Organisationen appellieren an die Kultusministerkonferenz, nicht länger auf kurzfristige Verbote zu setzen, sondern auf langfristige Bildungslösungen, die Kinder und Jugendliche ernst nehmen – und ihnen vertrauen.
Die zentralen Forderungen:
- Keine pauschalen Smartphone-Verbote, sondern pädagogisch begründete und lokal abgestimmte Regelungen
- Verankerung von Medienbildung als Querschnittsaufgabe oder als eigene Fach im Bildungssystem
- Verpflichtende Beteiligung der Schulgemeinschaft an der Regelentwicklung
- Investitionen in Infrastruktur, Lehrkräftefortbildung und außerschulische Medienpädagogik
- Gemeinsame Verantwortung von Politik und Bildungsakteur:innen für zeitgemäße Medienbildung
Der Offene Brief kann unter www.dkhw.de/medienkompetenz-statt-smartphone-verbote abgerufen werden.
Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Bundeselternrat, D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt und Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V. vom 27.08.2025
Caritas: Kinderschutz beginnt bei der Geburt
Caritas fordert eine gesetzliche Finanzierung von Babylotsen in Geburtskliniken
Mindestens jede fünfte Familie in Deutschland ist nach Einschätzung des Klinikpersonals so stark belastet, dass die gesunde Entwicklung des Kindes gefährdet sein kann. Das ist das Ergebnis des am 9. September veröffentlichten ZuFa-Monitorings 2024 des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen. Für den Deutschen Caritasverband ist klar: Familien in schwierigen Lebenslagen brauchen verlässliche Unterstützung – und Babylotsinnen und -lotsen leisten hierzu einen unverzichtbaren Beitrag.
Von den 648.221 Kindern, die 2023 in Deutschland geboren wurden, wachsen mindestens 140.000 in Familien mit erheblichen psychosozialen Belastungen auf. Besonders betroffen sind Kinder in Haushalten, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Dass der Anteil schwer belasteter Familien steigt, verdeutlicht den dringenden Handlungsbedarf.
Geburtskliniken sind zentrale Orte der frühen Hilfe: Hier lassen sich Belastungen erkennen und Eltern gezielt unterstützen. Babylotsinnen und -lotsen sind dafür speziell qualifiziert. Sie arbeiten eng mit dem medizinischen Team auf den Stationen zusammen, kennen das Hilfesystem vor Ort und sorgen dafür, dass aus Überforderung keine Kindeswohlgefährdung wird.
Doch trotz nachgewiesenem Erfolg ist die Finanzierung unsicher: Mehr als die Hälfte der Lotsendienste arbeitet auf befristeter Grundlage. Zwar beteiligen sich in 72 Prozent der Kliniken Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen, doch deren Budget stagniert seit 2012 bei 51 Millionen Euro – trotz steigender Kosten und wachsender Bedarfe. Dieses Missverhältnis gefährdet zentrale präventive Angebote.
Dabei liegen die Fakten auf dem Tisch: In 80 Prozent der Kliniken haben Lotsendienste die Zufriedenheit von Eltern und Fachkräften verbessert und die Vermittlung belasteter Familien in Hilfsangebote deutlich gestärkt. Allein 2024 wurden in rund 100 Kliniken über 40.000 Familien beraten, in 428 Fällen bestätigte sich der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
Unsere Forderungen an die Bundesregierung:
- Gesetzliche Regelfinanzierung von Lotsendiensten in Geburtskliniken – damit diese dauerhaft, flächendeckend und verlässlich wirken können,
- Sicherung ausreichender finanzieller Mittel für die Frühen Hilfen auf Bundes- und Landesebene.
Die Realität ist alarmierend: 2023 wurde bei mindestens 63.700 Kindern eine Kindeswohlgefährdung festgestellt – ein neuer Höchststand. Jeder einzelne Fall bedeutet Leid für die Betroffenen und verursacht volkswirtschaftliche Folgekosten von mindestens 400.000 Euro. Das summiert sich auf 25,48 Milliarden Euro.
Demgegenüber stehen Kosten von lediglich 56 Euro pro Geburt für einen Lotsendienst. Schon mit 38 Millionen Euro jährlich ließe sich eine bundesweite Regelausstattung sichern – eine Investition mit maximalem Nutzen für Kinder, Eltern und Gesellschaft.
Das ZuFa Monitoring Geburtskliniken 2024 des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen ist eine repräsentative Befragung von Mitarbeitenden in Geburtskliniken mit mehr als 300 Geburten im Jahr. Die Datenerhebung wurde vom Deutschen Krankenhausinstitut DKI durchgeführt. Eine vergleichbare Studie wurde bereits 2017 durchgeführt; die aktuellen Ergebnisse ermöglichen also auch einen Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre.
Der Deutsche Caritasverband setzt sich seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit der Stiftung SeeYou für Babylotsen in Geburtskliniken ein; unterstützt werden sie dabei von der Auridis Stiftung. Lotsendienste ermöglichen den Zugang zu fast allen Familien, weil 98% der Kinder in Geburtskliniken geboren werden. Sie bilden daher einen elementaren Baustein in der präventiven Arbeit für Familien, damit auch Kinder aus prekären Lebenslagen gesund aufwachsen können.
Mehr zum Programm Babylotse und zur Caritas-Studie: https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/familie/babylotsinnen–praeventive-beratung-rund?searchterm=Babylotsen+Studie
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Caritasverband e.V. vom 10.09.2025
Caritas: Schulstart wird zur Kostenfalle
Deutscher Caritasverband fordert höhere Pauschale und flächendeckende Lernmittelfreiheit
Das neue Schuljahr startet in vielen Bundesländern und wird für immer mehr Familien zur finanziellen Herausforderung. Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa: „Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder mit der Angst ins neue Schuljahr starten, die eigene Ausbildung werde für ihre Familie zur untragbaren Belastung. Wenn die Kosten für Bücher, Stifte, Hefte oder Malkasten für die Eltern nicht zu schultern sind, ohne bei anderen lebenswichtigen Ausgaben heftig zu sparen, werden die ökonomischen Sorgen der Eltern die Freude der Kinder am Lernen überschatten. Das Kinderrecht auf Bildung darf von solchen Schatten nicht in Frage gestellt werden. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sprechen eine klare Sprache: Die Kosten für Schulbücher steigen deutlich schneller als die allgemeine Inflation.“
Die Preise für Schul- und Lehrbücher sind den Zahlen des Amtes zufolge im Juni 2025 um 3,8 Prozent gestiegen, deutlich stärker als die allgemeine Inflation, die bei 2,0 Prozent liegt.
Schulbedarfspaket: Zu wenig und zu spät
Zwar erhalten Menschen im Bürgergeld-Bezug Zuschüsse für Schulbedarf, doch diese reichen bei weitem nicht aus. Das Schulstartpaket, aktuell bei 130 € zum Schuljahresbeginn und 65 € zum zweiten Halbjahr, deckt die tatsächlichen Ausgaben nicht ansatzweise ab.
„Die Preissteigerungen bei Schulmaterialien bringen gerade Familien mit mehreren Kindern an ihre Belastungsgrenze,“ mahnt Welskop-Deffaa. „Beim Wechsel von der Kita in die Grundschule oder auf eine weiterführende Schule braucht es eine neue Ausstattung, dafür reicht das Geld oft vorne und hinten nicht. Viel zu oft müssen die Familien die Kosten vorstrecken und wissen nicht wie.“
Schulbücher machen den Unterschied: Lernmittelfreiheit nicht überall gesichert
In vielen Bundesländern müssen Eltern die teuren Schulbücher selbst finanzieren, wo es keine Lernmittelfreiheit gibt. „Bildung, die von der Postleitzahl abhängig ist, darf nicht sein“, betont die Caritas-Präsidentin. „Leider wissen auch nicht alle Eltern, dass beim Jobcenter ein zusätzlicher ‚Mehrbedarf‘ für Schulbücher beantragt werden kann. Das Angebot muss dringend besser kommuniziert werden.“
Deutscher Caritasverband fordert: Sofortige Anpassung der Unterstützung
Eine realistische Anpassung der Schulbedarfs-Pauschale an die tatsächlichen Kosten, eine frühzeitige Auszahlung der Zuschüsse, damit die Familien nicht in Vorkasse gehen müssen und eine flächendeckende Lernmittelfreiheit, unabhängig vom Wohnort der Eltern sind dringend notwendig.
Hintergrund:
Preise für Schul- oder Lehrbücher sind im Juni 2025 +3,8% gestiegen (Inflation insgesamt: +2,0%, Quelle: Destatis).
In Bundesländern ohne Lernmittelfreiheit kann beim Jobcenter ein Mehrbedarf für Schulbücher beantragt werden.
Bereits aus einer Umfrage aus 2021* unter Caritas-Beraterinnen und -Beratern wurde berichtet, dass die Pauschale für das Schulbedarfspaket nie (44 %) oder nur manchmal ausreicht (43 %). Nur 13 % halten demnach die Pauschale insgesamt für ausreichend.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Caritasverband e.V. vom 12.08.2025
DGB-Umfrage – Arbeitgeber sind das größte Hindernis für flexible Arbeit
Mehr als die Hälfte der Beschäftigten will weniger arbeiten
Eine aktuelle repräsentative Umfrage des DGB-Index Gute Arbeit zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen den Arbeitszeitwünschen der Beschäftigten und der Realität: Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) würde die eigene Arbeitszeit gerne verkürzen. Gleichzeitig scheitern Wünsche nach längeren Arbeitszeiten häufig nicht am Arbeitszeitgesetz, sondern an betrieblichen Strukturen und der Ablehnung durch Arbeitgeber.
Die Umfrage unter mehr als 4.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zeigt: Je länger die tatsächliche Arbeitszeit, desto ausgeprägter der Wunsch nach Verkürzung. Besonders deutlich wird dies bei Beschäftigten mit überlangen Arbeitszeiten: 80 Prozent derjenigen, die mehr als 40 Wochenstunden arbeiten, wollen ihre Arbeitszeit reduzieren. Bei Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden wünschen sich die Beschäftigten sogar eine Verkürzung um durchschnittlich 14,8 Stunden pro Woche.
Wenn Beschäftigte hingegen mehr arbeiten wollen, scheitert das nicht an den Grenzen des bestehenden Arbeitszeitgesetzes, sondern an anderen Faktoren: 51 Prozent nennen starre betriebliche Abläufe als Hindernis, 40 Prozent die Ablehnung durch Vorgesetzte. Fehlende Stellen (31 Prozent) und mangelnde Kinderbetreuung (29 Prozent) folgen erst danach.
„Das Problem bei der Gestaltung von Arbeitszeiten ist nicht das Arbeitszeitgesetz, sondern sehr oft sind es die Arbeitgeber selbst“, erklärt Yasmin Fahimi, DGB-Vorsitzende. „Wir wissen, dass rund 2,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Teilzeit gerne mehr arbeiten würden, aber Vorgesetzte das oft ablehnen und starre Arbeitsabläufe hinderlich sind. Die unflexible Arbeitsorganisation durch Arbeitgeber ist dabei sogar ein noch größeres Problem als die fehlende Kinderbetreuung.“
Fahimi kritisiert die Forderungen der Arbeitgeberverbände scharf: „Es geht auch deshalb völlig an der Realität vorbei, dass die Arbeitgeberverbände das Arbeitszeitgesetz ändern wollen, um den 8-Stunden-Tag abzuschaffen. Damit wird kein Problem gelöst, sondern nur ein neuer Konflikt provoziert. Das ist das Letzte, was die Betriebe gebrauchen könnten.“ Sie fordert mehr Effizienz statt längerer Arbeitszeiten: „Die Arbeitgeber sind selbst in der Verantwortung, mehr flexible Möglichkeiten anzubieten. Damit könnten auch Teilzeitkräfte, die das gerne möchten, mehr arbeiten. Der Schlüssel zu mehr Produktivität ist mehr Effizienz bei der Arbeitsorganisation und keinesfalls eine Verlängerung der Arbeitszeiten. Es ist hinlänglich belegt, dass die Beschäftigten in Deutschland seit langem im roten Bereich arbeiten. Deshalb äußern ja auch so viele den Bedarf, Arbeitszeiten reduzieren zu wollen, vor allem diejenigen, die mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten.“
Die Auswertung basiert auf den Daten des DGB-Index Gute Arbeit 2025. Im Befragungszeitraum von Januar bis Mai 2025 wurden 4.018 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer telefonisch befragt. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Deutschland beträgt 36,3 Stunden, wobei Männer mit 39,9 Stunden deutlich länger arbeiten als Frauen mit 32,3 Stunden.
DGB-Index Gute Arbeit „Wöchentliche Arbeitszeiten“ zum Download
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 07.09.2025
djb: Ungerecht beurteilt: djb-Policy Paper zeigt, warum Frauen im öffentlichen Dienst seltener aufsteigen
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) hat ein Policy Paper zur geschlechtergerechten Bestenauslese im öffentlichen Dienst veröffentlicht. Darin wird deutlich: Frauen haben im Wettbewerb um Führungspositionen in der Bundesverwaltung weiterhin schlechte Karten. Zwar gibt es politische Bekenntnisse zur Gleichstellung, doch die Realität sieht anders aus: Das zentrale Auswahlinstrument für den beruflichen Aufstieg – die dienstliche Beurteilung – ist in vielen Fällen weder gendersensibel noch über Dienststellen hinweg vergleichbar.
„Solange berufliches Fortkommen von einem Beurteilungssystem abhängt, das überkommene Rollenbilder begünstigt, sind Frauen im Wettbewerb um Führungspositionen benachteiligt“, sagt djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-Kreuder.
Der djb weist in seiner Analyse auf tief verwurzelte Defizite hin: Unterschiedliche Beurteilungsrichtlinien in jedem Ressort der Bundesverwaltung, uneinheitliche Bewertungsskalen, mangelnde Transparenz und politisch besetzte Beurteilende ohne Fachqualifikation – all das erschwert faire Chancen für alle, insbesondere für Frauen. Zudem zeigen Studien, dass bestimmte Bewertungskriterien wie „Durchsetzungsfähigkeit“ oder „Belastbarkeit“ oft geschlechtsspezifisch interpretiert werden und dadurch ungewollt männlich konnotierte Verhaltensweisen bevorzugen.
Das Policy Paper formuliert ganz konkrete Reformvorschläge. Der djb fordert unter anderem eine einheitliche Beurteilungsrichtlinie für die gesamte Bundesverwaltung, geschlechtergerechte Kriterien mit Fokus auf Verantwortung statt Präsentismus sowie unabhängige, paritätisch besetzte Beurteilungskommissionen. Beamt*innen sollen zudem stärker in den Beurteilungsprozess eingebunden werden, zum Beispiel durch eigene Leistungsberichte oder regelmäßige Zwischengespräche.
„Ein modernes Beurteilungssystem muss Leistung sichtbar machen – nicht Stereotype verstärken“, sagt Dr. Marianne Czisnik, stellvertretende Vorsitzende der djb-Kommission Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung.
Gerade der öffentliche Dienst steht als zentraler Teil staatlichen Handelns in der besonderen Verantwortung, Gleichstellung konsequent umzusetzen, auch als Vorbild für andere gesellschaftliche Bereiche. Der djb fordert die Bundesregierung auf, jetzt die Weichen für ein gerechtes und zukunftsfähiges System der Bestenauslese zu stellen, denn nur so lässt sich ein leistungsstarker und vielfältiger öffentlicher Dienst verwirklichen und sichern.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 05.09.2025
djb: Gender Equality Strategy 2026–2030: Gleichstellung braucht klare Ziele und konsequente Umsetzung
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) hat eine Stellungnahme zur geplanten EU Gender Equality Strategy 2026–2030 der Europäischen Kommission vorgelegt. Der djb begrüßte bereits den strategischen Fahrplan vom 7. März 2025 ausdrücklich. In seiner aktuellen Stellungnahme hinsichtlich der kommenden EU Gender Equality Strategy fordert der djb nun, dass die erzielten Fortschritte – etwa bei Entgelttransparenz, Gewaltschutz und Gleichstellung in Führungspositionen – aktiv verteidigt und weiterentwickelt werden. Dazu brauche es eine starke Rolle der Europäischen Kommission und eine klare politische und finanzielle Unterstützung von Gleichstellungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten.
„Europäische Gleichstellungspolitik ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Demokratie und eine wichtige Grundlage zur Durchsetzung von Menschenrechten“, erklärt djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-Kreuder.
Der djb betont die Notwendigkeit eines ambitionierten Gender Mainstreamings in allen Politikfeldern und fordert verbindliches Gender Budgeting im kommenden EU-Haushalt. Die neue Strategie sollte außerdem überprüfbare Indikatoren enthalten, damit Gleichstellung nicht nur als Querschnittsziel, sondern als konkret messbares politisches Vorhaben verankert wird. Auch globale Perspektiven wie eine kohärente feministische Außenpolitik und die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Korruption wie Sextortion müssen stärker berücksichtigt werden.
Zentrale Handlungsfelder sieht der djb zudem in der Verbesserung des Schutzes vor geschlechtsbezogener Gewalt, im Abbau struktureller Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt, in der digitalen Gleichstellungspolitik sowie im Zugang zu (reproduktiver) Gesundheitsversorgung. Dabei müssen auch migrantisierte Frauen abgesichert werden. Denn die Europäische Kommission muss gewährleisten, dass soziale Sicherungssysteme grenzüberschreitend funktionieren.
„Die neue Gender Equality Strategy der Europäischen Kommission bietet eine Chance, auch in Zeiten des Backlashes ein klares Zeichen dahingehend zu setzen, dass Gleichstellung weder optional ist noch am Grenzzaun endet“, so Valentina Chiofalo, Vorsitzende der djb-Kommission Europa- und Völkerrecht.
Schließlich mahnt der djb eine konsequente Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Klimawandels an. Frauen und marginalisierte Gruppen sind nicht nur besonders von den Folgen betroffen, sondern spielen auch eine zentrale Rolle im Kampf für Klimagerechtigkeit. Eine erfolgreiche europäische Gleichstellungspolitik muss diese Perspektive systematisch einbeziehen.
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 12.08.2025
DKHW: Weltkindertag 2025: Recht auf Bildung: Geflüchtete Kinder bleiben auf der Strecke
Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisiert die nur sehr unzureichende Umsetzung des Rechts auf Bildung für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Deutschland. Eine Analyse der Kinderrechtsorganisation auf Grundlage von Befragungen der Landesregierungen zeigt auf, dass die derzeitig gültige EU-Aufnahmerichtlinie zum Bildungszugang vielfach nicht eingehalten wird. Demnach sind die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer unter Berücksichtigung des Völkerrechts verpflichtet, für geflüchtete Kinder und Jugendliche den Zugang zum Schul- und Bildungssystem spätestens drei Monate nach Äußerung des Asylbegehrens effektiv sicherzustellen. Aktuell warten viele geflüchtete Kinder und Jugendliche jedoch teils viele Monate oder sogar Jahre, bis sie ihr Recht auf Bildung durch den Besuch einer Regelklasse wahrnehmen können.
Mit der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, die noch vom Bundestag beschlossen werden muss, soll auch die Rechtslage diesbezüglich geändert werden: Der Zugang zum Bildungssystem soll demnach so bald wie möglich erfolgen und darf nicht länger als zwei Monate nach Asylantragsstellung hinausgezögert werden. Dabei ist eine Beschulung außerhalb des regulären Bildungssystems auf höchstens einen Monat zu beschränken.
„Die Bundesrepublik Deutschland und damit auch die Bundesländer haben sich entsprechend Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung für alle Kinder verpflichtet. Nach langem Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen vielerorts eine qualitativ unzureichende oder keine Beschulung stattfindet, kommt es auch nach der Umverteilung regelmäßig zu erheblichen Wartezeiten. Vorbereitungsklassen beginnen häufig erst danach und können bis zu zwei Schuljahre andauern. Insgesamt kann es für geflüchtete Kinder bis zu drei Jahre dauern, bis sie in einer Regelklasse unterrichtet werden. Damit bleiben diese Kinder bei der Bildung auf der Strecke. Das verstößt gegen ihre Rechte. Die langen Wartezeiten sind zudem ein bildungspolitisches Problem, denn sie erschweren eine effiziente Bildungsintegration und erfolgreiche Bildungsverläufe erheblich. Eine Verstärkung von Investitionen und Bemühungen zur Umsetzung einer schnellen Gewährleistung des Rechts auf Bildung rechnet sich langfristig für Schulen und Gesellschaft“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.
„Unbegleitete minderjährige Geflüchtete haben während des sogenannten Clearingverfahrens in der Regel keinen Zugang zur schulischen Bildung. Zwar sehen die gesetzlichen Regelungen für die vorläufige und reguläre Inobhutnahme Fristen von insgesamt fünf Wochen vor – jedoch haben die meisten Bundesländer kaum belastbare Daten zur tatsächlichen Dauer dieser Verfahren. Die Zahlen einiger weniger Bundesländer zeigen, dass diese dort durchschnittlich mehrere Monate dauern. Daher ist fraglich, ob der Zugang zur schulischen Bildung für diese besonders vulnerable Gruppe rechtskonform gewährleistet ist“, so Hofmann weiter.
Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht es zudem als sehr problematisch an, dass es in keinem Bundesland möglich ist, systematisch auf Grundlage von Daten zu überprüfen, wie der Bildungszugang geflüchteter Kinder in der Praxis umgesetzt wird – insbesondere wie viel Zeit zwischen Asylantragstellung, Schulaufnahme und Integration in die Regelklasse vergeht. Auch die genaue Dauer der Beschulung in Vorbereitungsklassen oder Sprachlernklassen bis zur Integration in Regelklassen ist bislang kaum bekannt. Ebenfalls braucht es dringend ausreichend Daten über Bildungsverläufe von geflüchteten Kindern, um die Wirkungen der unterschiedlichen Bildungssysteme erfassen zu können. Verlässliche Datenerhebungen und ein schnellerer Zugang zur schulischen Bildung sollten deshalb Kernziele einer gemeinsamen Strategie von Bund, Ländern und Kommunen sein.
Die Analyse „Einschränkungen beim Recht auf Bildung: Geflüchtete Kinder bleiben auf der Strecke“ fußt auf einer Befragung der Landesregierungen und wurde von der National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention unterstützt. Sie ist Teil des 2. „Kinderrechte-Index“ des Deutschen Kinderhilfswerkes, der voraussichtlich im Dezember dieses Jahres veröffentlicht wird. Im Kinderrechte-Index wird der Stand der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in verschiedenen Lebensbereichen von Kindern und den damit verbundenen Politikfeldern in den deutschen Bundesländern untersucht und verglichen.
Die Analyse „Einschränkungen beim Recht auf Bildung: Geflüchtete Kinder bleiben auf der Strecke“ kann unter www.dkhw.de//bildungszugang-gefluechtete-kinder heruntergeladen werden.
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Kinderhilfswerk e.V. vom 04.09.2025
DKHW: Weltkindertag 2025: Deutsches Kinderhilfswerk feiert einen ganzen Monat mit einem „Kinderrechte-Spezial“ auf www.kindersache.de
Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert den Weltkindertag 2025 einen ganzen Monat lang mit einem großen „Kinderrechte-Spezial“ für Kinder in ganz Deutschland. Ab heute dreht sich auf www.kindersache.de/weltkindertag im gesamten Monat September passend zum Weltkindertagsmotto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ alles um die Themen Kinderrechte, Demokratie und Teilhabe. Dabei können die Kinder auf kindersache.de in vielen interessanten Artikeln mehr über ihre Rechte erfahren und zudem selbst aktiv und kreativ werden. Der Fokus liegt dabei auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und über sie ins Gespräch zu kommen.
So können sich die Kinder an verschiedenen Rätseln und Challenges ausprobieren oder sich mit der kindersache-Community über ihre Wünsche und Fragen vor allem rund um die Themen Demokratie und Kinderrechte austauschen. Zudem wird die beliebte Videoreihe „Kinder fragen – Expert*innen antworten“ fortgesetzt und diesmal die Frage beantwortet: Wie können sich Kinder politisch einbringen und mitbestimmen? Darüber hinaus führt eine interaktive Kinderrechte-Rallye durch die verschiedenen Beiträge auf kindersache.de. Und: So wie überall auf kindersache.de wird auch beim „Kinderrechte-Spezial” die Beteiligung natürlich großgeschrieben – die Kinder können nicht nur kommentieren, sondern auch ganz eigene Beiträge und Ideen einreichen.
„Die breite Etablierung einer Kinderrechtsperspektive in allen Bereichen unserer Gesellschaft ist dringend notwendig, nicht nur am Weltkindertag am 20. September. Das Thema geht uns alle an: Politikerinnen und Politiker, Verantwortliche in der Wirtschaft, Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft, sie alle sind in der Pflicht, wenn es um die Verwirklichung kindgerechter Lebensverhältnisse und um bessere Entwicklungs- und Teilhabechancen für alle Kinder und Jugendlichen geht. Gerade in Zeiten multipler Krisen zeigt sich, dass es der Kinderrechte mehr denn je bedarf“, betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Hier möchten wir mit unserem ‚Kinderrechte-Spezial‘ auf kindersache.de ein klares Signal für die Kinderrechte setzen. Alle Kinder und Jugendlichen können hier beim Weltkindertag mitfeiern, egal, wo sie gerade sind, und das den ganzen September hindurch.“
Mit dem Motto des diesjährigen Weltkindertags „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ unterstreichen das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland, wie wichtig die Umsetzung der Kinderrechte für unser aller Zukunft und als Fundament der Demokratie ist. Kinder und Jugendliche, die ihre Rechte kennen und leben, verstehen besser, wie Demokratie funktioniert und wie sie sich aktiv einbringen können. Die beiden Kinderrechtsorganisationen dazu auf, die Rechte der jungen Generation stärker als bisher bei politischen Entscheidungen miteinzubeziehen – für ein zukunftsfähiges und kinderfreundlicheres Land.
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Kinderhilfswerk e.V. vom 01.09.2025
eaf: Von spürbarer Verbesserung keine Spur
eaf fordert sofortige Maßnahmen gegen Kinderarmut
Kinderarmut und finanzielle Nöte von Familien müssen dringend in den Fokus des Regierungshandelns rücken. Das fordert die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) mit Blick auf die besorgniserregenden Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Umfrage, die eine deutliche Zunahme der finanziellen Zukunftsängste von Eltern im Vergleich zum Januar zeigt. 25 Prozent der Befragten haben aktuell Sorge, dass sie die Grundbedürfnisse ihrer Familie (Heizung, Wohnen, Kleidung, Nahrung) nicht oder nicht mehr ausreichend decken können.
„Dem im Koalitionsvertrag formulierten Ziel, Kinderarmut wirksam zu bekämpfen, ist die Politik keinen Schritt nähergekommen. Auch die von der Regierung bis zum Sommer versprochene spürbare Verbesserung blieb bislang aus. Wenn Familien sich im Stich gelassen fühlen, verlieren sie das Vertrauen in die Politik, in Institutionen und in unsere Demokratie. Das ist fatal“, erklärt Bundesgeschäftsführerin Nicole Trieloff. „Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder gute Rahmenbedingungen und gerechte Teilhabechancen haben. Dafür braucht es ausreichende finanzielle Unterstützung im Bedarfsfall und eine soziale Infrastruktur mit hochwertigen Betreuungs- und Bildungsangeboten.“
Noch immer entscheiden Einkommen und Herkunft maßgeblich über Bildungswege und Zukunftschancen. Die eaf fordert deshalb eine Neudefinition des soziokulturellen Existenzminimums für Kinder. Ebenso wichtig sind deutliche Investitionen in eine funktionierende Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur: in Kitas und Schulen ebenso wie in Beratungs- und Freizeitangebote, Familienbildung und Sprachförderung. „Dabei geht es nicht um Wohltaten, sondern um das, was alle Kinder für ein gutes Aufwachsen brauchen“, so Trieloff. „Die Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Familien brauchen verlässliche Unterstützung im Alltag – nicht irgendwann, sondern jetzt!“
Quelle: Pressemitteilung evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) vom 08.09.2025
Familienbund der Katholiken: Immer weniger Geburten – jetzt ist die Familienpolitik gefragt!
Der Familienbund der Katholiken fordert angesichts der deutlich gesunkenen Geburtenrate, mit familienpolitischen Maßnahmen gegenzusteuern. Dabei müssen die Wünsche der Familien im Zentrum stehen. Ein zentraler Ansatzpunkt im Koalitionsvertrag ist das Elterngeld.
„Die aktuellen Zahlen zeigen eine alarmierende Entwicklung: In Deutschland ist die Geburtenrate weiter gesunken. Von Januar bis April 2025 wurden 7,5 % weniger Kinder geboren als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau liegt inzwischen nur noch bei 1,35 – so niedrig wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr“, erklärt Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes der Katholiken.
Besonders besorgniserregend ist die wachsende Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Während sich Paare in Deutschland weiterhin durchschnittlich 1,8 Kinder wünschen, bleibt die tatsächliche Kinderzahl deutlich darunter. Diese Entwicklung bedeutet nicht nur eine Einschränkung individueller Freiheit. Sie verschärft auch den Fachkräftemangel, erhöht den Druck auf das Rentensystem und hat langfristige Auswirkungen auf Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Hoffmann fordert verlässliche und flexible Rahmenbedingungen für Familien: „Wenn Eltern – je nach Lebenssituation – zwischen verschiedenen Modellen und Kombinationen von Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Erziehungsarbeit wählen können, ohne dadurch wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, entstehen echte Perspektiven für Familiengründung und -erweiterung. Eine moderne Familienpolitik muss dafür die Voraussetzungen schaffen“, so Hoffmann.
Eine Maßnahme, die den Wunsch nach Kindern unterstützt, ist das Elterngeld. Laut der „Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen“ stieg die Geburtenzahl 2012 durch das Elterngeld um 7 %. Da die Eckwerte des Elterngeldes aber seit 2007 nie an die Preissteigerungen angepasst wurden, erfüllt das Elterngeld seine Funktion nur noch eingeschränkt. Ulrich Hoffmann erläutert: „Der Mindestbetrag von 300 Euro hat 2007 noch das sächliche Existenzminimum eines Kindes abgedeckt. Dieses liegt mittlerweile bei über 500 Euro. Und der Höchstbetrag von 1.800 Euro begrenzt heute bereits bei Durchschnittseinkommen die eigentlich vorgesehene Lohnersatzrate von 65 %. Für viele Familien ist es daher finanziell nicht mehr möglich, dass auch die besserverdienende Person Elternzeit nimmt. Eine Inflationsanpassung ist daher beim Elterngeld dringend erforderlich.“
Um den Wunsch vieler Familien nach einer gleichmäßigeren Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zu unterstützen, fordert Ulrich Hoffmann zusätzliche Partnermonate, wobei die von beiden Eltern flexibel nutzbaren zwölf Monate erhalten bleiben müssten. „Die Flexibilität des Elterngeldes darf nicht eingeschränkt, sondern muss ausgebaut werden, auch durch die Möglichkeit eines Elterngeldbezugs in späteren Lebensphasen des Kindes. Das Wissen darum, in kritischen Situationen für das Kind da sein zu können, erleichtert Paaren die Entscheidung für Kinder.“
Damit das gewünschte Familienmodell auch nach dem Elterngeldbezug gelebt werden, braucht es eine verlässliche, flexible und qualitativ hochwertige Betreuungsinfrastruktur, gute Bildung, familiengerechte Steuern und Sozialabgaben und eine besondere Förderung von Familien mit kleinen Einkommen. „Wer heute Familien stärkt, sichert morgen die Zukunft unseres Landes“, betont Hoffmann und schließt mit: „Politik muss endlich die Weichen stellen – für mehr Zuversicht, mehr Kinder und eine solidarische Gesellschaft von morgen.“
Quelle: Pressemitteilung Familienbund der Katholiken – Bundesverband vom 23.07.2025
IG Metall unterstützt Klagen: Vereinbarkeitsrichtlinie muss vollständig umgesetzt werden!
Gewerkschaft unterstützt Väter vor Gericht +++ Vereinbarkeitsrichtlinie in Deutschland aus Sicht der Gewerkschaft nicht ausreichend umgesetzt +++ Zeit nach der Geburt entscheidende Phase für gesamte Erwerbsbiografie von Frauen
Die IG Metall unterstützt aktuell mehrere Väter, die gegen die Bundesrepublik Deutschland klagen. Die Väter wollen erstreiten, für den von ihnen genommenen Urlaub in den ersten Wochen nach der Geburt ihrer Kinder angemessen kompensiert zu werden. Sie stützen ihre Klagen auf die mangelnde Umsetzung der Richtlinie 2019/1158 der Europäischen Union (Vereinbarkeitsrichtlinie) durch die Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend der Vereinbarkeitsrichtlinie müssen die Mitgliedsstaaten einen Freistellungsanspruch von mindestens zehn Tagen anlässlich der Geburt eines Kindes für den Vater oder den nach nationalem Recht anerkannten zweiten Elternteil einführen. Damit alle Väter sich diese Freistellung leisten können, muss sie auch vergütet werden. Eine solche Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes ist in Deutschland bisher nicht eingeführt worden.
Das Landgericht Berlin II hat nun zwei dieser Klagen abgewiesen. Die IG Metall unterstützt die Väter weiterhin, die in die nächste Instanz gehen wollen.
Die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten gewährt Vätern entsprechend der Vereinbarkeitsrichtlinie einen spezifischen Freistellungsanspruch anlässlich der Geburt. Deutschland gehört zu den wenigen EU-Mitgliedsstaaten, die dem zweiten Elternteil bislang keine spezielle Freistellung anlässlich der Geburt gewähren.
Die IG Metall setzt sich dafür ein, dass es eine Freistellungsphase für den zweiten Elternteil im engen zeitlichen Zusammenhang zur Geburt geben sollte. Die Elternzeit und das Elterngeld können diesen speziellen Freistellungsanspruch nicht ersetzen, weil sie nicht im Zusammenhang mit der Geburt in Anspruch genommen werden müssen und auch keine separate, vergütete Freistellung von zehn Tagen ermöglichen. Die spezielle Freistellung anlässlich der Geburt entlastet die Mutter in der für ihre physische und psychische Gesundheit bedeutsamen Phase nach der Geburt und fördert die Bindung zwischen Kind und beiden Elternteilen in besonderem Maße. Eine frühe partnerschaftliche Aufteilung hat somit einen hohen emotionalen und gesundheitlichen Wert für Eltern und Kind. Sie fördert auch eine faire Aufteilung der Sorgearbeit in den späteren Lebensphasen des Kindes.
Care- oder Sorgearbeit wird noch immer zu großen Anteilen von Frauen geleistet – mit der Coronapandemie hat sich dieser Umstand weiter verstärkt. Dies birgt nicht nur eine größere zeitliche und körperliche Belastung für Frauen, sondern verschärft auch die sogenannte Teilzeit-Falle, also die unfreiwillige, reduzierte Erwerbstätigkeit von Frauen. Sie ist mit erheblichen finanziellen Einbußen in der gesamten Erwerbsbiografie von Frauen verbunden und ist eine wesentliche Ursache des Gender Pay Gaps, der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Phase nach der Geburt des ersten Kindes entscheidend für die gesamte Erwerbsbiografie ist.
Der Koalitionsvertrag sieht eine Reform des Elterngeldes vor, um eine stärkere Beteiligung des zweiten Elternteils, meist der Väter, und damit eine gerechte Verteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit gerade im Hinblick auf die Geburt des Kindes zu fördern. Aus Sicht der IG Metall kann diese Zielsetzung durch die Einführung der Freistellung des zweiten Elternteils anlässlich der Geburt des Kindes erreicht werden. Die Bundesregierung muss die Vereinbarkeitsrichtlinie vollständig umsetzen und diese Freistellung einführen.
Quelle: Pressemitteilung IG Metall vom 06.08.2025
LOLA e.V.: Meldestelle Antifeminismus veröffentlicht Kurzbericht 2024
Antifeministische Zustände in Deutschland 2024 – Eine massive Bedrohung für Betroffene und Zivilgesellschaft
Meldestelle Antifeminismus veröffentlicht Kurzbericht für das Jahr 2024
Trauriges Rekordhoch: Die „Meldestelle Antifeminismus“ registrierte im Jahr 2024 insgesamt 558 antifeministische Vorfälle. Dies entspricht einem Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Angriffe reichen von Beleidigung, Bedrohung und Hasskampagnen über Körperverletzung und Brandstiftung bis hin zu systematischer digitaler sexualisierter Gewalt.
Durchschnittlich 10 antifeministische Vorfälle pro Woche dokumentierte die Meldestelle Antifeminismus im vergangenen Jahr. Die nun als Kurzbericht veröffentlichte Auswertung der eingegangenen Vorfallsmeldungen und Betroffenen-Erfahrungen zeigt: Antifeminismus äußert sich zunehmend aggressiver.
Darauf weisen unter anderem die vielfältigen Angriffsformen hin. Sie reichten von Sachbeschädigung (77 Vorfälle) über konkrete verbale (96) und physische Gewalt (72), systematische Angriffe/Bedrohungen via E-Mail, Brief, Anrufen oder Hassnachrichten (57) bis hin zu geplanten oder umgesetzten Anschlägen (10), etwa in Form von Brandstiftung, Buttersäure-Anschlägen oder Angriffen mit Waffen.
Angriffe, die sich gegen Einzelpersonen richteten, trafen vor allem Frauen und (weitere) Menschen aus der LSBTIQA+-Community, insbesondere trans* Personen. Aber auch zivilgesellschaftliches Engagement für Frauenrechte, Gleichstellung sowie geschlechtliche, sexuelle oder familiäre Vielfalt stand massiv im Fokus. Dies belegen unter anderem die zahlreich gemeldeten, antifeministisch motivierten direkten Angriffe auf Organisationen (59), wie Gleichstellungs- und Beratungsstellen, Gewaltschutzverbände, Jugend- und Sportvereine und auf Veranstaltungen (102). Darunter registrierte die Meldestelle 92 Angriffe auf CSDs, ihre Teilnehmenden und Organisator*innen. Die hohe Zahl reiht sich ein in die Berichte und Statistiken zu Gewalt und extrem rechten Angriffen gegen CSDs im Jahr 2024 und macht erneut die feste Verankerung von LSBTIQA+-Feindlichkeit in antifeministischer Ideologie und Mobilisierung deutlich. Weitere Angriffe richteten sich gegen Kulturveranstaltungen oder solche zum 08. März.
Fast 30% der 2024 gemeldeten Vorfälle entfielen auf den digitalen Raum. So gab es zahlreiche Meldungen zu Online-Beiträgen, teils sogar ganzen Webseiten und Gruppen, die organisiert zu Gewalt gegen Frauen aufrufen und systematisch Bildmaterial von sexualisierter Gewalt, Vergewaltigungen, Femiziden verbreiten. Nicht nur hier übernimmt organisierter Antifeminismus die Funktion, Gewalt gegen Frauen und antifeministisch markierte Feindbilder zu propagieren, anzuleiten und letztendlich gesellschaftlich zu legitimieren. Das individuelle Sicherheitsgefühl hat sich für viele, vor allem mehrfachmarginalisierte, Betroffene deutlich verschlechtert. 2 Pressemitteilung: Meldestelle Antifeminismus veröffentlicht Kurzbericht für das Jahr 2024
Die 2024 dokumentierten Vorfälle verdeutlichen darüber hinaus, welche Auswirkung die breite antifeministische Mobilisierung auf die Gesellschaft hat. Meldestellen-Leitung Ans Hartmann erläutert: Antifeminismus muss in seiner Relevanz für extrem rechte Bewegungen und Radikalisierung sowie im Zusammenhang mit steigenden Zahlen von Hasskriminalität und geschlechtsspezifischer Gewalt problematisiert werden. Antifeminismus gefährdet große Teile der Bevölkerung und ist ein massives sicherheitspolitisches Risiko, das dringend gesamtgesellschaftlich angegangen werden muss.“
Wie konkret sich Bedrohungslagen und Einschränkungen für die Zivilgesellschaft mittlerweile zeigen, spiegelt sich auch in den in 2024 zahlreich durchgeführten Fachberatungen und Fortbildungen wider. Der Bedarf an Informationen und Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Präventions- und Sicherheitskonzepten war bei frauen-/gleichstellungspolitischen Organisationen und im Bereich queerer Selbstvertretung und Bildungsarbeit besonders hoch.
Der Kurzbericht „Antifeministische Zustände in Deutschland 2024 – Eine massive Bedrohung für Betroffene und Zivilgesellschaft“ ist zu finden unter:
https://antifeminismus-melden.de
Quelle: Pressemitteilung Lola für Demokratie e.V. vom 13.08.2025
LSVD+: Selbstbestimmung ist ein zentraler Baustein unserer Demokratie
Sie zu erhalten, liegt im Interesse aller Demokrat*innen
Zu den systematischen Angriffen auf das mühsam errungene Selbstbestimmungsgesetz erklären die Frauenhauskoordinierung e. V., der Bundesverband Trans*, der LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt e.V. und das Jugendnetzwerk Lambda e.V. gemeinsam:
Demokratien stehen für die Gleichheit aller Menschen und die Unverletzlichkeit der Menschenrechte. Werte wie Gleichheit, Freiheit und Menschenwürde bilden das Fundament einer Demokratie und garantieren Offenheit und Akzeptanz für verschiedene Lebensweisen, Perspektiven und Identitäten. In Zeiten, in denen antifeministische, autoritäre und rechtsextreme Stimmen lauter werden, werden diese Werte zunehmend angegriffen. Selbstbestimmung ist dabei eines der Themen, die als Konfliktfeld ins Zentrum gerückt werden und an denen sich zeigt: Nur wenn Menschenrechte Tag für Tag verteidigt werden, bleiben sie erhalten.
Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) gerät in diesem Hinblick immer wieder unter Beschuss. Dabei wird die Bedeutung des SBGG oft unterschätzt: Die öffentliche Debatte dreht sich hauptsächlich um Missbrauchsnarrative, anstatt den menschenrechtlichen Stellenwert des Selbstbestimmungsgesetzes in den Blick zu nehmen. Es bedeutet nicht nur einen menschenrechtskonformen Zugang zu Vornamens- und Personenstandsänderung für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen. Es drückt aus, dass jede Person das Recht hat, über das eigene Leben zu bestimmen und ihre Identität frei zu entfalten. Es bildet zudem ab, dass in unserer Gesellschaft weder Frauen noch Männer in starren Geschlechterbildern eingeschlossen werden sollen.
Die Geschäftsführerin von Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) Sibylle Schreiber erklärt: „Wie erwartet hat das SBGG an der Situation in Frauenhäusern nichts geändert. Vor der Verabschiedung des Gesetzes kursierte die angebliche Sorge, dass cis Männer sich durch schlichte Änderung des Vornamens oder Geschlechtseintrags missbräuchlich Zugang zu Frauenhäusern verschaffen könnten. Dieser unrealistischen Annahme haben wir schon damals widersprochen. Es werden hier immer wieder unnötig Schreckensszenarien konstruiert, während die alltägliche Gewalt durch cis Männer weitergeht – ohne dass es dafür eine aufwändige Änderung des Geschlechtseintrags braucht.
Ob ein Frauenhaus für eine gewaltbetroffene Frau und ihre Kinder in der jeweiligen Situation die adäquate Anlaufstelle ist und passende Unterstützung bieten kann, wird stets von den Fachkräften vor Ort im Einzelfall entschieden. Dies gilt unterschiedslos für die Aufnahme von cis Frauen wie von trans* Frauen oder nicht-binären Menschen. Trans* Frauen, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen finden in Deutschland bereits seit vielen Jahren Schutz in Frauenhäusern.
Gleichzeitig gehören trans* Frauen, intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen zu den besonders vulnerablen und in hohem Maße von Gewalt bedrohten Personengruppen. Deshalb ist es notwendig, bedarfsgerechte und intersektionale Angebote für Schutz und Unterstützung bei Gewalt zur Verfügung zu stellen. Den diskriminierungsfreien Zugang zu Schutz vor Gewalt halten wir für einen zentralen Gradmesser für die Verwirklichung eines gleichberechtigten Zusammenlebens in einer demokratischen Gesellschaft.“
Robin Ivy Osterkamp aus dem Vorstand des BVT* sagt dazu: „Eine Demokratie muss sich daran messen lassen, wie sie mit Gruppen umgeht, die Diskriminierung ausgesetzt sind. Stellt sie sich nicht schützend vor diese Gruppen, werden deren Menschenrechte als etwas Optionales dargestellt. Das widerspricht dem Grundgesetz. Ein strategischer Angriff auf das SBGG wie der von der rechtsextremen Person Liebich darf nicht dazu genutzt werden, das Selbstbestimmungsgesetz und damit auch die Grund- und Menschenrechte von trans*, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen insgesamt in Frage zu stellen. Anstatt die Existenz des Selbstbestimmungsgesetzes zu hinterfragen, müsste im Zentrum stehen, wie Diskriminierung, die in verschiedenen Paragrafen des SBGG fortgeschrieben wird, beendet werden kann.“
Nur Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit oder unbefristeten oder verlängerbaren Aufenthaltstiteln haben Zugang. Vornamens- und Personenstandsänderungen in zeitlicher Nähe zu einem Spannungs- oder Verteidigungsfall sind gesondert geregelt und werden im Hinblick auf die Verpflichtung zum „Dienst an der Waffe” unwirksam. Trans*, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen wird durch Anmeldefristen und Sperrfristen unterstellt, sie würden diese Angaben aus einer spontanen Laune heraus ändern. Es wird eine Bedrohung für Frauen und Kinder aus dem Selbstbestimmungsgesetz konstruiert, die in keinem der 16 Länder weltweit, die seit 2012 Selbstbestimmung für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen umgesetzt haben, eingetreten ist.
Julia Monro aus dem Bundesvorstand des LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt betont: „Für eine selbstbestimmte Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag vor dem Standesamt für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen hat die Community lange gekämpft. Die Zahlen offenbaren, wie sehnsüchtig viele auf diese vereinfachte und diskriminierungsarme Möglichkeit des Wechsels von Vornamen und Geschlechtseintrag gewartet haben. Die Statistiken zeigen, dass Verfahren nach dem Transsexuellengesetz zuletzt rückläufig waren und nach Inkrafttreten im November und Dezember 2024 rund zehntausend Verfahren nach dem Selbstbestimmungsgesetz durchgeführt wurden. Dadurch wird deutlich, für wie viele Menschen das Gesetz eine große Bedeutung hat – Demokrat*innen sollten diesen queerpolitischen Meilenstein nicht in Frage stellen.“
Oska Jacobs aus dem Bundesvorstand des Jugendnetzwerk Lambda sagt dazu: „Mit der Vulnerabilität junger Menschen zu argumentieren und gleichzeitig gegen das Selbstbestimmungsgesetz zu wettern, führt nicht nur in eine Sackgasse, sondern ist sogar im hohem Maße fahrlässig. Denn gerade um junge Menschen zu schützen, braucht es ein Gesetz, das es ermöglicht, ohne unnötige Hürden und menschenunwürdige Verfahren, über die eigene Identität bestimmen und diese behördlich verankern zu können. Viele junge queere, und vor allem trans* Menschen sind von psychischen Erkrankungen und großen mentalen Belastungen betroffen. Gerade in einer Lebensspanne die ohnehin von großen Veränderungen und Lebensfragen geprägt ist, an denen junge Menschen an Universitäten, Schulen und Ausbildungsplätzen jeden Tag damit konfrontiert werden, den offiziellen Namen angeben zu müssen, ist es umso entscheidender selbstbestimmt und barrierearm über die eigene Geschlechtsidentität entscheiden zu können. Das Selbstbestimmungsgesetz, und das zeigen auch die Zahlen, ist daher absolut unabdingbar und notwendig um die mentale Gesundheit junger Menschen gewährleisten zu können!“
Kontakt:
presse@frauenhauskoordinierung.de, presse@bv-trans.de, presse@lsvd.de, presse@lambda-online.de
Zum Weiterlesen:
- Broschüre zum Selbstbestimmungsgesetz, die auf wiederkehrende Fragen dazu eingeht: https://www.bundesverband-trans.de/publikationen/soll-geschlecht-abgeschafft-werden/
- Studie, die die Rechtslage in verschiedenen Ländern vergleicht, die Selbstbestimmung für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen umgesetzt haben: https://www.tgeu.org/files/uploads/2023/11/tgeu-self-determination-models-in-europe-2022-de.pdf
- Link zur Stellungnahme des Frauenhauskoordinierung e. V. zum Gesetzesentwurf über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag vom 01.06.2023: https://www.frauenhauskoordinierung.de/aktuelles/detail/stellungnahme-1
- Am heutigen Donnerstag, 11.09., plant die AfD-Fraktion, einen Gesetzentwurf „zur Aufhebung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag – Rechtsklarheit und Schutz vulnerabler Gruppen wie Frauen und Jugendlicher wieder herstellen“ (21/1547) in den Bundestag einzubringen. Weitere Informationen finden sich hier: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw37-de-selbstbestimmungsrecht-1099340
Quelle: Pressemitteilung LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 11.09.2025
LSVD+: 100 Tage Bundeskanzler Merz
Queere Sicherheit braucht politische Verantwortung
Heute ist Friedrich Merz seit 100 Tagen als Bundeskanzler im Amt. Der LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt zieht eine Zwischenbilanz. Alva Träbert vom Bundesvorstand des LSVD⁺ erklärt:
Die ersten 100 Tage der neuen Regierung unter Bundeskanzler Merz haben viel Verunsicherung in die queere Community gebracht. Noch ist es zu früh, um eine umfassende queerpolitische Bilanz zu ziehen – dennoch gibt es bereits dringenden Handlungsbedarf.
Mit Sorge beobachten wir die politische Diskussion um Regenbogenfahnen, um die Teilnahme von Bundestagsmitarbeiter*innen am CSD und “Genderverbote”. Hier wird inzwischen ein offener Kulturkampf geführt, in dem Teile der Regierung rechtsextreme Narrative rund um einen angeblichen Woke-ism aufgreifen und legitimieren. Die Debatte um gendergerechte Sprache und queere Sichtbarkeit schlägt mediale Wellen, und genau das ist ihr Ziel: Ablenkung von tatsächlichen sozialen und politischen Problemen, die Millionen von Menschen in Deutschland betreffen.
Die Pläne zur Änderung des Meldewesens anlässlich des Selbstbestimmungsgesetzes kritisieren wir scharf. Trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen werden bei der geplanten Reform des Bundespolizeigesetzes nur mangelnd berücksichtigt. Die Beendigung aller humanitären Aufnahmeprogramme betrifft auch queere Menschen aus Afghanistan, die sich auf die Aussagen der letzten Bundesregierung verlassen haben und nach Pakistan ausgereist sind, wo sie nicht bleiben können. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan droht ihnen Verfolgung und Tod. Deutschland muss hier Wort halten: Diese Menschen müssen in jedem Fall aufgenommen werden. Dass es mit Sophie Koch weiterhin eine Queerbeauftragte gibt, begrüßen wir sehr. Wir hoffen, dass es ihr gerade in dieser politisch herausfordernden Zeit gelingt, eine starke Stimme für die Bedürfnisse der Community zu sein.
Die Liste der dringenden queerpolitischen Aufgaben ist lang, und die Bundesregierung wird sich daran messen lassen müssen, wie ernst sie diese nimmt. Das Familien- und Abstammungsrecht muss reformiert werden, um endlich der Lebensrealität von Regenbogenfamilien gerecht zu werden – zum Wohle der Kinder. Artikel 3 Abs. 3 GG muss um den expliziten Schutz aller queeren Menschen ergänzt werden. Die steigende queerfeindliche Hasskriminalität muss bundesweit konsequent erfasst, verfolgt und öffentlich verurteilt werden.
Wir fordern ein Ende der politischen Angriffe auf die queere Community und die Umsetzung dieser jahrzehntealten und teils immer wieder gerichtlich angemahnten Forderungen. Die Regierung Merz muss Verantwortung auch für queere Menschen übernehmen!
Weiterlesen:
- Politisch motivierte Kriminalität und Queerfeindlichkeit auf neuem Höchststand
- Queere Sichtbarkeit ist kein Zirkus
- Wollen CDU/CSU und SPD auch Verantwortung für LSBTIQ* übernehmen?
Quelle: Pressemitteilung LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt vom 13.08.2025
Paritätischer Gesamtverband: Aktuelle Studie belegt: Kita-Politik zementiert soziale Ungleichheit
Armutsbetroffene Kinder werden deutlich seltener und in deutlich geringerem zeitlichem Umfang in Kitas betreut. Fehlende Kindertagesbetreuung verstärkt damit die soziale Spaltung der Gesellschaft.
Wer arm ist, hat deutlich schlechtere Chancen auf einen Kitaplatz, das belegt ein aktueller Bericht des Paritätischen Gesamtverbandes zum Thema Armut und Kita-Betreuung. Nur 19 Prozent der ein- bis zweijährigen Kinder aus armutsbetroffenen Familien besuchen eine Kita, während gleichaltrige Kinder aus nicht von Armut betroffenen Familien doppelt so häufig von einem Kitaplatz profitieren (41 Prozent). Der Bericht zeigt, dass die Kosten der Kinderbetreuung für viele armutsbetroffene Familien eine erhebliche Belastung darstellen und zahlreiche Familien daran hindern, Kindertagesbetreuung in Anspruch zu nehmen.
„Kinder aus armutsbetroffenen Familien werden beim Zugang zu frühkindlicher Bildung ausgebremst, weil finanzielle und regulative Hürden den Weg in die Kita versperren. Die Bundesregierung muss diese Ungerechtigkeit beenden und Kita-Betreuung für alle ermöglichen”, so der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Dr. Joachim Rock.
Für Eltern bedeute die fehlende Kindertagesbetreuung Einschränkungen bei der Erwerbsarbeit und damit schlechtere Möglichkeiten, ihre finanzielle Situation zu verbessern, mahnen die Autor*innen des Berichts. Bestehende soziale Ungleichheiten würden so verstärkt.
Beziehende von Sozialleistungen haben eigentlich einen Rechtsanspruch darauf, bei den Kita-Kosten entlastet zu werden. Der Bericht des Paritätischen zeigt aber, dass es bei der Umsetzung erhebliche Mängel gibt. Als Lösung schlägt der Verband vor, Eltern mit Sozialleistungsbezug automatisch von Kita-Gebühren zu befreien – ohne dass sie dafür einen Antrag stellen müssen.
Der Paritätische fordert zudem, dass der Bund sich dauerhaft finanziell an der Verbesserung des Kita-Systems beteiligt, da frühkindliche Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Dabei sei es entscheidend, dass der Zugang zu Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz, etwa die Kostenübernahme des Mittagessens in der Kita, erleichtert wird.
Die Publikation „Ungleichheit von Anfang an. Bericht zu Armut und Kita-Betreuung“ ist Teil einer neuen Reihe von Veröffentlichungen zum Thema Armut, die jeweils verschiedene Schwerpunkte setzen. Dabei stützt sich der Bericht insbesondere auf die Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen vom Statistischen Bundesamt MZ-SILC.
Dokumente zum Download
Ungleichheit von Anfang an: Bericht zu Armut und Kita-Betreuung (September 2025) (1 MB)
Quelle: Pressemitteilung Der Paritätische Gesamtverband vom 09.09.2025
Paritätischer Gesamtverband: Organisationen warnen vor weiteren Kürzungen in der Arbeitsmarktintegration
Paritätischer: Gemeinnützige Angebote in Gefahr
Es drohen erneut Kürzungen bei der Unterstützung für die Eingliederung benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt bei der Arbeitsmarktförderung. Die entsprechenden Titel im aktuellen Haushaltsentwurf der Regierung für 2025 konterkarieren das Vorhaben des Koalitionsvertrags, die Vermittlung in Arbeit zu stärken und sicherzustellen, dass die Jobcenter für die Eingliederung ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.
Der Paritätische Gesamtverband sieht darin mit zahlreichen Mitgliedsorganisationen, die aktiv in der Arbeitsmarktförderung sind und praktische Erfahrungen mit Beschäftigungsmaßnahmen für Langzeiterwerbslose haben, ein falsches Signal. Diese Stimmen der Praxis rufen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nun in einem Offenen Brief auf, die drohenden Kürzungen zu verhindern.
Die Verfasser*innen des Briefes erinnern daran, dass bereits in den Vorjahren starke Kürzungen in diesem Bereich vorgenommen wurden. So lagen die Haushaltsmittel für die Arbeitsmarktintegration 2021 noch bei 5 Milliarden Euro. In 2024 waren nur noch 4,15 Milliarden Euro geplant. In 2025 sollen sogar nur noch 4,1 Milliarden zur Verfügung stehen.
Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, hält diese Entwicklung für falsch: “Hilfen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind eine Investition in die nachhaltige Qualifizierung und Förderung von Menschen, die unsere Hilfe benötige und verdienen. Das lohnt sich, für alle. Die Bundesregierung darf deshalb nicht an der falschen Stelle sparen.
Der Paritätische fürchtet, dass weitere Kürzungen durch die Hintertür drohen. Hintergrund ist, dass die Verwaltungskosten der Jobcenter und der sog. Eingliederungstitel im Bundeshaushalt gegenseitig deckungsfähig sind. Das bedeutet: Jobcenter können das Geld aus der Arbeitsförderung auch für ihre Verwaltungskosten einsetzen. Das Verwaltungsbudget ist jedoch absehbar viel zu niedrig.
Die gemeinnützigen Organisationen berichten aus der Praxis, dass Jobcenter vielerorts bereits Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung ein oder bieten diese teils nicht mehr an. In der Folge seien die Zahlen der Teilnehmer*innen bereits stark zurückgegangen. Leidtragende seien die Menschen, die in den Qualifizierungsmaßnahmen ihre Chance für den Ein- und Aufstieg im Arbeitsmarkt sehen. Sozialen Einrichtungen und Diensten droht, dass sie ihre Dienstleistungen nun immer seltener anbieten können. Dies könne sogar existenzbedrohend werden.
“Der Paritätische mit seinen Mitgliedern weiß aus erster Hand, wie wichtig die Integrationshilfen in den Arbeitsmarkt für viele Menschen sind. Sie sind unverzichtbar. Daher fordern wir die Bundesregierung auf, diesen Posten im Haushalt nicht weiter auszudünnen. Im Gegenteil. Er muss stärker finanziert werden”, so Dr. Joachim Rock.
Dokumente zum Download
Offener Brief an den Deutschen Bundestag (68 KB)
Quelle: Pressemitteilung Der Paritätische Gesamtverband vom 27.08.2025
Save the Children: Umfrage: Finanzielle Sorgen von Familien in Deutschland nehmen zu – Eltern wünschen sich mehr Anstrengungen gegen Kinderarmut
- Drei Viertel halten Pläne von Schwarz-Rot gegen Kinderarmut für unzureichend
- Ein Viertel sorgt sich um finanzielle Zukunft – starker Anstieg seit Jahresbeginn
- Kinder von Geringverdienenden und Alleinerziehenden vermehrt emotional belastet
Familien in Deutschland sorgen sich zunehmend um ihre finanzielle Sicherheit und erwarten von der Bundesregierung wirksame Maßnahmen gegen Kinderarmut. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von Save the Children unter Eltern minderjähriger Kinder äußerten gut drei Viertel (76 Prozent) die Ansicht, dass die derzeitigen Pläne der Bundesregierung zur Bekämpfung von Kinderarmut nicht ausreichen.
„Die Erwartungen an die Politik sind hoch – und das Vertrauen in bestehende Strategien gering“, sagt Eric Großhaus, Experte für Kinderarmut bei Save the Children. „In den Familien nehmen die finanziellen Sorgen zu und Kinderarmut verharrt auf einem hohen Niveau. Aber die Bundesregierung verschließt die Augen und lässt ein familienpolitisches Gesamtkonzept vermissen, um Eltern und Kinder besser zu unterstützen. Auch der Koalitionsvertrag zeigt: Viele Ansätze gegen Kinderarmut bleiben bisher vage oder Stückwerk. Hier muss dringend nachgebessert werden. Wir brauchen endlich mehr Ambition in der Familienpolitik.“
Deutlich mehr Eltern als noch zu Jahresbeginn blicken pessimistisch auf ihre finanzielle Situation. 25 Prozent der Befragten äußerten mit Blick auf die kommenden zwölf Monate die Sorge, dass sie die Grundbedürfnisse ihrer Familie (Heizung, Wohnen, Kleidung, Nahrung) nicht oder nicht mehr ausreichend decken können, das bedeutet eine Steigerung um 10 Prozentpunkte. Denn in einer forsa-Umfrage für Save the Children vor der Bundestagswahl hatten noch 15 Prozent diese Sorge geteilt. Besorgniserregend ist die Entwicklung insbesondere bei Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 3.000 Euro: Hier geben 57 Prozent an, sich die Versorgung mit dem Notwendigsten nicht mehr leisten zu können – ein Anstieg um 21 Prozentpunkte seit Januar.
Fast die Hälfte (48 Prozent) der Familien mit weniger als 3.000 Euro netto im Monat können sich nie oder nur selten etwas wie Urlaub, Restaurantbesuche, Hobbys der Kinder oder neue Möbel leisten. Bei Alleinerziehenden sind es 33 Prozent. Ein Fünftel der Kinder aus diesen Gruppen reagiert mit seelischem Stress auf den finanziellen Druck.
„Die Ergebnisse bestätigen, dass Armut und finanzielle Sorgen große psychische Belastungen für Eltern, aber auch für Kinder und Jugendliche selbst sind“, kommentiert Prof. Dr. Julian Schmitz, Professor für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig, die Umfrage, die ihm Save the Children zur Einordnung vorgelegt hat. „Wir wissen aus anderen Studien, dass Kinder aus finanziell benachteiligten Familien häufiger von psychischen Störungen betroffen sind und gleichzeitig schwerer Unterstützung finden. Die Folgen sind langanhaltende hohe gesellschaftliche und individuelle Kosten. Es ist daher eine zentrale politische Aufgabe, Kinderarmut endlich mit Nachdruck zu bekämpfen.“
Eric Großhaus ergänzt: „In den anstehenden Diskussionen und Reformen zur Zukunft des Sozialstaates und des Bürgergelds muss eins klargestellt werden: Familien und Kinder sind keine Bittsteller – sie haben ein Recht auf umfassende Unterstützung. Geringverdienende und Alleinerziehende brauchen nicht nur bessere Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Sie sind auch auf mehr Unterstützung für das Aufwachsen ihrer Kinder angewiesen – etwa durch Bildungs- und Teilhabeangebote, den Abbau von Bürokratie bei Sozialleistungen oder auch teilhabesichernde Regelsätze in der Grundsicherung. Wir brauchen ein breites Bündel von Maßnahmen für Kinder. “
Im Januar hatten 88 Prozent der Eltern gesagt, dass Kinderarmut ein drängendes Problem sei, das die nächste Bundesregierung vorrangig angehen sollte – und die Erwartungen bleiben hoch: Quer durch alle Gruppierungen wünschen sich Eltern, dass die Politik mehr für Kinder tun sollte. Fast 90 Prozent halten mehr Investitionen in Bildung für „sehr wichtig“, zwei Drittel (66 Prozent) den Ausbau der Kinderbetreuung. Jeweils deutlich mehr als die Hälfte der Befragten sagten, ihnen seien kostenlose oder günstige Freizeitangebote für Kinder, Bürokratieabbau bei Familienleistungen und eine bessere finanzielle Unterstützung für Familien „sehr wichtig“.
Forderungen von Save the Children:
- Ein einfach zugängliches Sozialsystem für Familien sowie eine teilhabesichernde Neuberechnung des Existenzminimums von Kindern. Eine für alle Kinder gültige Kindergrundsicherung muss weiterhin das Ziel bleiben und bei allen Reformen des Bürgergelds müssen die Rechte und das Wohl der über 1,8 Millionen Kinder im Leistungsbezug geachtet werden.
- Eine politische Gesamtanstrengung und mehr Ambitionen gegen Kinderarmut. Ein wichtiger Ansatzpunkt dazu ist der Nationale Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ zur Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder. Der Bund sollte dieses Instrument stärken und mit finanziellen Mitteln ausstatten, um neue Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe von Kindern zu entwickeln. Zudem müssen alle föderalen Ebenen an einem Strang ziehen und gemeinsam an einer kohärenten Gesamtantwort auf die hohe Kinderarmut arbeiten. Es braucht sowohl eine armutsvermeidende Arbeitsmarktpolitik als auch monetäre Maßnahmen zur Vermeidung von Armut, Investitionen in die soziale Infrastruktur (vielfältige soziale Unterstützungsangebote für Kinder und Familien), Bildung und Zugang zu leistbarem Wohnraum und Gesundheitsversorgung.
- Gezielte Maßnahmen zur Stärkung der mentalen Gesundheit von Kindern. Die im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD vereinbarte Strategie „Mentale Gesundheit für junge Menschen“ sollte die Belange von armutsbetroffenen sowie -bedrohten Kindern besonders adressieren. Es muss sichergestellt werden, dass alle Kinder bundesweit flächendeckend Zugang zu qualitativ hochwertigen und armutssensiblen psycho-sozialen Unterstützungsangeboten erhalten. Dazu gehören sowohl niedrigschwellige Angebote, wie etwa Schulsozialarbeit oder Mental-Health-Coaches an Schulen, als auch die Behebung des bestehenden Therapieplatzmangels.
Hinweise für die Redaktion:
- Für die repräsentative Umfrage befragte forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im August 2025 insgesamt 1.003 Eltern minderjähriger Kinder in Deutschland.
- Die Umfrage und eine Einordnung der Ergebnisse finden Sie hier.
- Vorherige Umfragen von Save the Children zu Kinderarmut: Januar 2025; August 2024
- Save the Children ist Mitglied im Bündnis Kindergrundsicherung.
Quelle: Pressemitteilung Save the Children Deutschland e.V. vom 02.09.2025
VdK: Bentele zum Schulstart: „Teilhabe bleibt für viele Kinder auf der Strecke“
- VdK: Berechnung der Regelsätze und Bedarfe ist realitätsfern und veraltet
- VdK-Präsidentin: „Weitere Nullrunde nicht vertretbar“
Für immer mehr Familien wird der Schulstart zur finanziellen Belastung. VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert mehr Mittel, um die Teilhabechancen für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten zu verbessern:
„Das neue Schuljahr bringt für viele Familien eine weitere Hiobsbotschaft: Laut Statistischem Bundesamt sind die Kosten für Schul- und Lehrbücher binnen eines Jahres um satte 3,8 Prozent gestiegen. Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten verschärft sich dadurch ein strukturelles Problem. Ihre Teilhabe an Bildung wird zunehmend erschwert.
Die aktuelle Entwicklung zeigt erneut: In der Grundsicherung reichen die derzeitigen Regelsätze und die ergänzenden Bedarfe im Bildungs- und Teilhabepaket vielfach nicht aus. Sie sind realitätsfern, veraltet und nicht an die Lebensrealität der Menschen angepasst. Besonders hart trifft es wieder einmal Alleinerziehende und arme Familien mit mehreren Kindern.
Eine weitere Nullrunde bei der Höhe der Regelsätze und damit auch bei den Schulbedarfen ist nicht hinnehmbar. Sie verstärkt die seit Jahren bestehende Benachteiligung von Kindern aus einkommensschwachen Familien und trifft sie doppelt: durch sinkende Kaufkraft und eingeschränkte Teilhabechancen.“
Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 17.08.2025
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
BSFT: Dialogforum „Sorgearbeit ist der Normalfall: Zeit für Erwerbs- und Sorgearbeit“

Termin: 17. September 2025
Veranstalter: Population Europe und We-ID
Ort: Berlin und live im Stream
Kinder betreuen und versorgen, Angehörige und Freund*innen pflegen oder sich um den Haushalt kümmern: Sorgearbeit ist der Normalfall im Lebensverlauf – und muss mit Erwerbstätigkeit vereinbar sein. Politische Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und für mehr Erwerbstätigkeit müssen den Realitätscheck dieser Normalität berücksichtigen. Was hilft, damit die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit und die ökonomische Eigenständigkeit Realität werden – für Männer und für Frauen?
Im Austausch mit Vertreter*innen von Wirtschaft und Politik diskutieren wir, wie Gesellschaft und Wirtschaft durch bessere Vereinbarkeit, mehr Partnerschaftlichkeit und die faire Verteilung von Sorgearbeit gestärkt werden können.
Freuen Sie sich auf spannende Impulse u.a. von Dr. Astrid Pape (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V.), Prof. Dr. Katharina Wrohlich (DIW Berlin) und Michaela Hermann (Bertelsmann Stiftung), auf Erfahrungsberichte aus Betroffenenperspektive von Doreen Borchert (Verband alleinerziehender Mütter und Väter – Landesverband Bayern) und Martin Habedank (Vater und Führungskraft in Teilzeit) sowie aus Unternehmensperspektive von Linda König (Städtisches Klinikum Dresden).
Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Zusätzlich wird sie live auf www.sorgearbeit-fair-teilen.de gestreamt. Eine aktive Beteiligung per Live-Stream (z. B. per Chat oder Fragen) ist nicht möglich. Eine Anmeldung für den Stream ist nicht notwendig.
Anmeldung (Anmeldefrist verlängert bis Sonntag, 14. September 2025, 23.59 Uhr)
Bundeszentrum Kita- und Schulverpflegung: Tag der Schulverpflegung
Termin: 23. September 2025
Veranstalter: Bundeszentrum Kita- und Schulverpflegung
und die Vernetzungsstellen Schulverpflegung der Bundesländer
Ort: Online
Unter dem Motto „Ohne Schulverpflegung kein Ganztag: Gemeinsam gut lernen & essen“ möchten wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Schule, Kommune, Wissenschaft und Politik diskutieren, wie guter Ganztag gelingt.
Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme!
Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie dies noch bis zum 16. September 2025 unter folgendem Link nachholen:
👉 Zur Anmeldung
Alle Informationen und Beiträge rund um die Online-Veranstaltung sind abrufbar unter:
www.gemeinsamgutessen.de/bundeslaender/aktionstag
Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu unter gemeinsamgutessen@ble.de
ITAD e.V.: 7. Internationaler Tag Alleinerziehender
Termin: 28. September 2025
Veranstalter: Internationaler Tag Alleinerziehender
Deutschland e. V.
Ort: Berlin
Am 28. September 2025, möchten wir Sie erneut herzlich einladen, mit uns die Freude, den nun schon 7. Internationalen Tag Alleinerziehender, unter dem Motto: „Wir feiern uns selbst, weil uns niemand feiert!“ zu teilen. Dieser Tag bietet eine besondere Gelegenheit, die täglichen Herausforderungen und Leistungen von Singleeltern in den Fokus zu stellen.
Im Mittelpunkt stehen inspirierende Gespräche, wertvolle Impulse und der Austausch mit Gleichgesinnten. Ein Glas Sekt mit oder ohne Alkohol, hebt die gute Laune.
Wir freuen uns darauf, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu begehen und ein paar Stunden der Wertschätzung, dem Alltag von Alleinerziehenden zu entfliehen und mit Ihnen zu erleben.
Bitte kommen Sie und feiern Sie mit uns den 7. Internationalen Tag Alleinerziehender, den wir inzwischen in neun Ländern getragen haben. Dazu gehören neben uns Deutschen auch Österreich, die Schweiz, Norwegen, Kuba, Chile, Georgien, Ungarn, und Frankreich außerdem sind auch zwei weitere Bundesländer vertreten, nämlich Brandenburg und Baden-Württemberg.
28. September 2025, 13.00-15.00 Uhr, Berlin-Mitte, Alexanderplatz, Weltzeituhr
Population Europe und We-ID: Diskussionsveranstaltung: Die Gegenwart Europas: Vielfalt, Identität und Demokratie
Termin: 07. Oktober 2025 18 – 20 Uhr (mit anschließendem Empfang)
Veranstalter: Population Europe und We-ID
Ort: Berlin
Podiumsdiskussion mit:
Hildegard Bentele, Mitglied des Europäischen Parlaments
Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin
Prof. Dr. Claudia Neu, Inhaberin des Lehrstuhls für die Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel
Staatsministerin Natalie Pawlik, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie für Antirassismus
Die Veranstaltung wird von Dr. Andreas Edel, Executive Secretary von Population Europe | Max-Planck-Institut für Demografische Forschung, moderiert.
Im Mittelpunkt der Diskussion stehen folgende Fragen: Was definiert in Zeiten des demografischen Wandels und wachsender Bevölkerungsvielfalt politische Zugehörigkeit und Teilhabe in europäischen Demokratien? Wie kann ein inklusives und demokratisches Europa helfen, disruptiven und europakritischen Bewegungen zu begegnen? Welche Bedeutung hat dabei der ländliche Raum, und wie lassen sich diese Herausforderungen in einer Stadt wie Berlin gestalten?
Wer sind die Veranstalter?
Population Europe ist ein Netzwerk von über vierzig führenden Forschungseinrichtungen aus ganz Europa im Bereich der Bevölkerungswissenschaft mit Sitz im WissenschaftsForum Berlin, das sich der Politikberatung zu den Herausforderungen des demografischen Wandels verschrieben hat und von der Max-Planck-Gesellschaft getragen wird.
We-ID ist ein von der Europäischen Kommission im Rahmen von Horizon Europe gefördertes Forschungsprojekt mit Partnern aus Bulgarien, Deutschland, Italien, Kroatien, Schweden und dem Vereinigten Königreich, das sich mit den Schnittstellen von Migration, Integration, Identität und demografischem Wandel in Europa befasst und von der Universität Göttingen koordiniert wird.
Der Paritätische: Inforeihe Kinder, Jugend und Familie: Biologische Vielfalt schützen, Klima stärken – Impulse für die Jugendarbeit mit „Handeln JETZT!“
Termin: 16. Oktober 2025
Veranstalter: Der Paritätische Gesamtverband
Ort: Online
Klimakrise, Verlust biologischer Vielfalt und globale Ungleichheiten fordern unsere Gesellschaft heraus – und auch die Kinder- und Jugendhilfe steht vor der Frage: Wie können junge Menschen darin unterstützt werden, sich für eine gerechte und lebenswerte Zukunft einzusetzen? Wie lassen sich Themen wie biologische Vielfalt und Klimagerechtigkeit sinnvoll in pädagogische Angebote integrieren?
Das Projekt „Handeln JETZT!“ der Jugendumweltverbände BUNDjugend, Naturfreundejugend und Naturschutzjugend im NABU (NAJU) bietet konkrete Anregungen, um diese Themen in die Praxis zu bringen.
Mit dem „Young Impact Fund – Handeln JETZT! möglich machen“ unterstützt es junge Menschen dabei, selbst aktiv zu werden: Über diesen Förderfonds können Gruppen aus der Jugend(sozial)arbeit unkompliziert finanzielle Mittel beantragen, um eigene Projekte für biologische Vielfalt, Klimaschutz oder Klimagerechtigkeit umzusetzen.
In dieser Ausgabe der Inforeihe wird das Projekt „Handeln JETZT!“ vorgestellt. Im Anschluss ist Zeit für Rückfragen und Austausch:
- Welche Erfahrungen gibt es bereits?
- Wo bestehen Hürden?
- Und wie können ökologische Themen in der Jugendhilfe verankert werden?
Das Projekt „Handeln JETZT!“ wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.
Mit
Elena Sumser, Referentin der NAJU für “Handeln JETZT!“
Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Für die Teilnahme an der Fachveranstaltung werden keine Beiträge erhoben.
Verantwortlich für inhaltliche Fragen
Borris Diederichs, Referent Kinder- und Jugendhilfe, jugendhilfe(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 328
Verantwortlich für organisatorische Fragen
Sabine Haseloff, Sachbearbeitung Kinder- und Jugendhilfe, jugendhilfe(at)paritaet.org, Tel 030 / 246 36 327
bbt: Fachtagung "Wie weiter? Migrantische Familien in Armutslagen"
Termin: 06. November 2025
Veranstalter: Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung & Teilhabe (bbt)
Ort: Berlin und hybrid
Migrantische Familien sind in Deutschland besonders häufig von Armut betroffen.
Sie kämpfen gegen strukturellen Hürden und Benachteiligungen in Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung und erschwerter sozialer Teilhabe. Trotz neuer Maßnahmen und Leistungen steigt die Zahl der Familien in prekären Lebenslagen – und mit ihr der Handlungsdruck.
Die Herausforderungen sind bekannt – doch wie geht es weiter?
Die Tagung „Wie weiter? Zukunftspolitik für migrantische Familien in Armutslagen“ lädt dazu ein, über politische Verantwortung und konkrete Wege zu einer armutsfesten Familienpolitik ins Gespräch zu kommen. Als Abschlussveranstaltung des FamPower²-Projekts blicken wir auch hier gemeinsam nach vorne: Welche Impulse hat FamPower² gesetzt? Was bleibt und wie können die Erkenntnisse genutzt werden?
Teilnehmende erhalten fundierte Einblicke in aktuelle politische und wissenschaftliche Entwicklungen, begegnen praxiserprobten Lösungsansätzen und visionären Konzepten – und treten in Dialog mit Fachpersonen, politischen Akteur*innen und Vertreter*innen migrantischer Selbstorganisationen.
📩 Die ausführliche Einladung mit Programm folgt in Kürze.
Bitte merken Sie sich den Termin bereits jetzt vor – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Hier geht es direkt zum Projekt FamPower²: FamPower² – Workshops für Familien-Multiplikator*innen
Fröbel: Save the Date - 14. Plenum Frühpädagogik in Berlin
Termin: 20. – 21. November 2025
Veranstalter: Fröbel gemeinsam mit der Stiftung Kinder forschen, der Stiftung Lesen und dem Didacta-Verband.
Ort: Berlin
Das Vorschul-Experiment: Sind Kitas und Schulen gute Bildungspartner?
Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ein zentrales Ereignis im Leben eines Kindes – und ein Prüfstein für unser Bildungssystem. Was brauchen Kinder, damit sie vom ersten Schultag an mit Freude lernen, gut mitmachen und die Lerninhalte erfassen können? Wie gelingt es, faire Bildungschancen von Anfang an zu schaffen und Grundsteine für erfolgreiche Bildungsbiografien zu legen? Wie können Kitas und Grundschulen gemeinsam echte Verantwortung für diesen Übergang übernehmen? Was können sie mit Blick auf die Bedürfnisse von Kindern besser machen? Und wie kann Politik dabei helfen, dass sich zwei Bildungsorte zu echten Partnern entwickeln?
Darüber wollen wir mit Ihnen beim 14. Plenum Frühpädagogik debattieren. Wir freuen uns auf Ihre Perspektiven und auf einen offenen Austausch darüber, wie wir gemeinsam dazu beitragen können, dass alle Kinder stark und gut vorbereitet in ihre Schulzeit starten.
DV: Fachveranstaltung Aktuelle Fragen des Sozialhilferechts
Termin: 20. – 21. November 2025
Veranstalter: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
Ort: Berlin
Die Sozialhilfe hat weiterhin in erheblichem Umfang existenzsichernde Leistungen zu erbringen. Eine Zunahme der Bedeutung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wegen des zunehmenden Risikos unzureichender Rentenansprüche wird auch im Jahr 2025 erwartet. Zudem stellen Gesetzesänderungen und Rechtsprechung immer neue Herausforderungen an die Fachkräfte. So hat das Bürgergeld auch in der Sozialhilfe Veränderungen mit sich gebracht, auf die in der Veranstaltung eingegangen wird. Die Veranstaltung informiert zudem über aktuelle Fragen der Rechtsentwicklung, insbesondere über Veränderungen im Leistungsrecht des SGB XII sowie aktuelle Rechtsprechung und eröffnet den Teilnehmenden die Möglichkeit, im kollegialen Austausch die eigene Praxis zu reflektieren.
Um aktuelle Entwicklungen aufgreifen zu können, werden die inhaltlichen Schwerpunkte der Fachveranstaltung am 20.-21.11.2025 in Berlin kurzfristig festgesetzt.
Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Leitungskräfte von Trägern der Sozialhilfe und von freien Trägern.
Anmeldungen bitte bis 19.09.2025.
Den Link zur Onlineanmeldung sowie zum Veranstaltungsprogramm finden Sie unter:
https://www.deutscher-verein.de/events/detail/aktuelle-fragen-des-sozialhilferechts-1/
DV: Fachveranstaltung Pflegerische Versorgung sichern, Öffnung und Vernetzung im Quartier
Termin: 20. – 21. November 2025
Veranstalter: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
Ort: Hannover
Um den aktuellen und absehbar wachsenden Herausforderungen der Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu begegnen, müssen langfristige Strategien und belastbare Versorgungsstrukturen (weiter)entwickelt werden. Zentral ist dafür die Stärkung der häuslichen Pflege, die Unterstützung pflegender An- und Zugehöriger und die Gestaltung flexibler und vernetzter Angebotsstrukturen. In der Fachtagung werden gute Beispiele aus der Praxis zur Öffnung und Vernetzung ins Quartier vorgestellt und diskutiert. Ziel ist es, Impulse für die Entwicklung und Gestaltung einer zukunftsfähigen Pflegeinfrastruktur zu geben. Ein fachlicher Austausch zwischen den Teilnehmenden steht im Vordergrund.
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Leistungserbringende, freie Wohlfahrtspflege, Pflegefachverbände und Pflegeberatung, Vertreter*innen aus Bundesländern und Kommunen, Pflegekassen, Interessenvertretungen älterer und pflegebedürftiger Menschen, Pflegewissenschaft.
Anmeldeschluss ist spätestens am 19. September 2025.
Den Link zur Onlineanmeldung sowie zum Veranstaltungsprogramm finden Sie unter:
WEITERE INFORMATIONEN
Positionspapier Armut und Gesundheit
Die Nationale Armutskonferenz ruft die demokratischen Fraktionen des 21. Deutschen Bundestages zu einer aktiven Politik der Armutsbekämpfung auf. Es gilt, die aktuell bestehende Kausalität „Armut macht krank, Krankheit macht arm“ endlich aufzulösen. Dazu benötigt es konkrete Handlungen in unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitsvorsorge und -versorgung für armutsgefährdete und -betroffene Menschen.
Das aktualisierte Positionspapier ging heute an alle Abgeordneten im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages: 25-08-01 Nationale Armutskonferenz_Positionspapier Armut macht krank